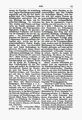Hahn auf dem Glockenturme [Goetzinger-1885]
Hahn auf dem Glockenturme kommt schon im 10. Jahrh. zu St. Gallen vor, er erinnert an die Wachsamkeit in Beobachtung der kanonischen Stunden. Vor Erfindung der Uhren richtete man sich mit dem Anfange des Frühgottesdienstes nach dem Hahnenschrei. Statt des Hahnes erschienen ...
rda00147 [Goetzinger-1885]
Fig. 94. An der Staffelei von Franz von Mieris. Auflösung: 1.434 ... ... Malerei Fig. 94. An der Staffelei von Franz von Mieris. ...
Öl [Goetzinger-1885]
Öl. Für die ewigen Lampen , die schon um das Jahr ... ... den Wunsch aus, es sollten am Tabernakel 3–5, am Hochaltar 3, an den Nebenaltären eine Lampe brennen und zwar Tag und Nacht. Sämtliche sollten ...
Hut [Goetzinger-1885]
Hut als Rechtssymbol ist Symbol der Übertragung von Gut und Lehen; der Übertragende oder an seiner Statt der Richter pflegte den Hut zu halten, der Erwerbende hinein zu greifen oder einen Halm darein zu werfen. Der Hut war, gleich der Fahne . Feldzeichen; ...
Kuss [Goetzinger-1885]
... wenn der Wächter den Morgen verkündet und es nun an ein Scheiden der Geliebten geht: urloup nâh und nâher baz mit kusse ... ... . Bei der Begrüssung küsste der Ankommende die Herrin, doch nur, wenn er an Rang gleich oder höher stand. In der Regel ersucht die ... ... , Wangen oder Augen, doch scheint der Kuss an den munt nur Auszeichnung der mâge zu sein ...
Oper [Goetzinger-1885]
... Heinrich IV. mit Maria von Medici aufgeführt. Das erste grosse Talent, das an dieser neuen musikalisch-dramatischen Gattung arbeitete, war Claudio Monteverde , erste Hälfte ... ... biblische, mythologische, allegorische, mit Vorliebe der Schäferwelt entnommene, die hauptsächlichen Veranlassungen Feste an Höfen und andern Orten, die vorzüglichsten Dichter David ...
Feen [Goetzinger-1885]
... dem lateinischen Wort fatum entstanden, welches an die Stelle von parca , Parze getreten war. ital. fata , ... ... vier Steine auf einmal. Sie waren gutmütig und nahmen sich besonders der Kinder an, deren Schicksal sie verkündigten. In die Häuser der Nachbarn stiegen sie durch ...
Fürst [Goetzinger-1885]
... princeps wurde seit der Ausbildung des fränkischen Reiches überhaupt derjenige bezeichnet, der an Rang und Würde zu den Höchsten zählte: der König, der Majordomus, ... ... konnten; sie hatten Einfluss auf die Ernennung der Beamten des Stifts und Anteil an der Wahl des Bischofs oder Abtes. Der deutsche Name ...
Roman [Goetzinger-1885]
... deutschen Adels , er wuchs von 1569 bis 1594 allmählich auf 24 Bände an und erhielt sich lange die Gunst seines Publikums, auch nachdem viel anderes ... ... letzte Erinnerung das Buch vom gehörnten Siegfried auf. Doch fehlt es auch nicht an Romanen, die Deutsche zu Verfassern haben, und zwar ...
Adler [Goetzinger-1885]
... seine Klauen in die Wolken schlägt. Nordische Götter und Riesen legen ein Adlerkleid an. Reiche Verwendung fand der Adler in der christlichen Kunst. Im Alten ... ... Legionen. Den zweiköpfigen Adler nahmen zuerst die orientalisch-römischen Kaiser als Reichsinsignien an, um dadurch ihre Ansprüche auf beide römische Reiche anzudeuten; ...
Uhren [Goetzinger-1885]
Uhren , mhd. ûre, ôre , aus lat. hora , ... ... Altertum bekannten Sonnen-, Sand- und Wasseruhren , von denen die erste Art zuweilen an den Kirchen angebracht war. Wann die durch ein Gewicht in Bewegung gesetzten mechanischen ...
Apsis [Goetzinger-1885]
Apsis , aus griech. apsis oder hapsis = Verbindung, ... ... , daraus mittellat. absîda , ahd. absîda, apsîta , mhd. mit Anlehnung an ab und sîte: die absîte oder apsîte , ursprünglich ...
Ramme [Goetzinger-1885]
Ramme. Die Bockramme oder Hoye diente im Mittelalter – wie heute ... ... Einrammen der Pfähle. Sie bestand in der Regel aus einer schweren Holzart und war an der Stirne mit einem Metallbeschlag versehen. Ihre häufigste Verwendung fand sie im Belagerungsdienst, ...
Zehnte [Goetzinger-1885]
... d. Gr., wobei persönlich freie, jedoch an die Scholle gebundene Bebauer von Landgütern das Eigentum des Grundherrn gegen ... ... Kirche von den auf ihren Gütern lebenden Kolonen den alten, an den Inhaber der Domäne zu entrichtenden, durchaus weltlichen Zehnten als Rente bezog. ... ... den Anfang, dass sie den auf ihren eigenen Krongütern liegenden grundherrlichen Zehnten an manchen Orten der Kirche überwiesen; ...
Fasten [Goetzinger-1885]
... an dem Moses den Sinai bestiegen, und am Montag, an welchem er denselben verlassen haben sollte, fasteten, bestimmte die alte Kirche den Mittwoch (Tag des Verrats) und Freitag (Todestag) als Fasttage, an deren Stelle später als wöchentliche »Wachtage« oder »Stationen«, Freitag und ...
Nimbus [Goetzinger-1885]
Nimbus , Glorie , Heiligenschein, kommt schon bei den alten Hindus, Ägyptern, Griechen und Römern an Götter- und Heldenbildern in Gestalt einer runden Scheibe um das Haupt vor. In der christlichen Kunst findet dieses symbolische Zeichen des sinnlichen Glanzes zuerst im Orient Aufnahme, seit ...
Oblate [Goetzinger-1885]
... erstere Benennung wendet man auf die ungeweihte, die zweite auf die geweihte Waffel an. Sie wird mittels des Hostieneisens geprägt und trägt anfänglich ein Kreuz oder ein Monogramm Christi , vom 13. Jahrhundert an ein Kruzifix mit Kreuzestitel. Gesegnete (nicht geweihte) Oblaten ...
Bîspel [Goetzinger-1885]
Bîspel , zusammengesetzt aus bî bei und mhd. und ahd. ... ... Bezirk, so weit die Verkündigung (Rede) der Kirche reicht, nhd. mit Anlehnung an das Spiel: Beispiel. Bîspel bedeutete im Mittelalter wie das einfache Wort das ...
Renner [Goetzinger-1885]
Renner ist der Name eines ausgedehnten deutschen Lehrgedichtes des Hugo von Trimberg aus dem Würzburgischen, 1260–1309 Schulmeister am Collegiatstift an der Theurstadt vor Bamberg. Das über 24000 Verse starke Gedicht entbehrt eines festen Planes und ist mehr eine allgemeine Strafpredigt, aber lebhaft geschrieben und ...
Ballet [Goetzinger-1885]
Ballet , aus ital. balletto , dem Dim. von der ... ... alten Römer. Künstlerisch ausgebildet wurde das Ballet zuerst in Italien im 16. Jahrh. an den Höfen, wobei Fürsten , Prinzen und Prinzessinnen tanzten, deklamierten und sangen. ...
Buchempfehlung
Strindberg, August Johan
Inferno
Strindbergs autobiografischer Roman beschreibt seine schwersten Jahre von 1894 bis 1896, die »Infernokrise«. Von seiner zweiten Frau, Frida Uhl, getrennt leidet der Autor in Paris unter Angstzuständen, Verfolgungswahn und hegt Selbstmordabsichten. Er unternimmt alchimistische Versuche und verfällt den mystischen Betrachtungen Emanuel Swedenborgs. Visionen und Hysterien wechseln sich ab und verwischen die Grenze zwischen Genie und Wahnsinn.
146 Seiten, 9.80 Euro
Im Buch blättern
Ansehen bei Amazon
Buchempfehlung
Geschichten aus dem Biedermeier II. Sieben Erzählungen
Biedermeier - das klingt in heutigen Ohren nach langweiligem Spießertum, nach geschmacklosen rosa Teetässchen in Wohnzimmern, die aussehen wie Puppenstuben und in denen es irgendwie nach »Omma« riecht. Zu Recht. Aber nicht nur. Biedermeier ist auch die Zeit einer zarten Literatur der Flucht ins Idyll, des Rückzuges ins private Glück und der Tugenden. Die Menschen im Europa nach Napoleon hatten die Nase voll von großen neuen Ideen, das aufstrebende Bürgertum forderte und entwickelte eine eigene Kunst und Kultur für sich, die unabhängig von feudaler Großmannssucht bestehen sollte. Michael Holzinger hat für den zweiten Band sieben weitere Meistererzählungen ausgewählt.
- Annette von Droste-Hülshoff Ledwina
- Franz Grillparzer Das Kloster bei Sendomir
- Friedrich Hebbel Schnock
- Eduard Mörike Der Schatz
- Georg Weerth Leben und Taten des berühmten Ritters Schnapphahnski
- Jeremias Gotthelf Das Erdbeerimareili
- Berthold Auerbach Lucifer
432 Seiten, 19.80 Euro
Ansehen bei Amazon
- ZenoServer 4.030.014
- Nutzungsbedingungen
- Datenschutzerklärung
- Impressum