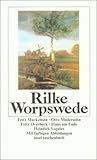|
Heinrich Vogeler
[117] Die Cholera war in Amsterdam. Die jungen Leute, die von der Düsseldorfer Akademie herübergekommen waren, hielten noch eine Weile stand, schließlich aber flüchteten sie in ein kleines holländisches Seebad; sie fanden es leer, die Fassaden vernagelt, das Meer eingeregnet und einen grauen, trägen Nebel über Allem, der sich eintönig von Stunde zu Stunde zog. Da kam es über sie wie eine Angst, wie wenn man nachts aufwacht und es ist so dunkel, daß man glauben kann, plötzlich erblindet zu sein. Mit jenem verzweifelten Entschluß, mit dem man dann nach einem Zündholz sucht, mit einem ganz ebensolchen Entschlusse reisten die jungen Leute ab, mit dem nächsten Zuge ins Licht, nach Italien, in die Sonne womöglich.
Von solchen Reisen und nicht von der traurigen Düsseldorfer Akademie müßte man erzählen, wenn man Heinrich Vogelers Lehrjahre schildern wollte. Sie waren bunt genug. Er gehört zu denjenigen, die alles kennen gelernt haben: das atemlose Treiben wachsender Weltstädte und die spießbürgerliche Einfalt entlegener Inselorte, in denen ein Tag dem anderen, und alle Tage irgendeinem ersten Tage zu gleichen scheinen, dessen sich die ältesten Leute noch entsinnen können. Er hat alle Galerien besucht, und auf vornehmen Landsitzen hat er Sammlungen und Bilder gesehen, die selten gezeigt werden. Er entzog sich den nordischen Nebeltagen, um plötzlich, wie in einem eigenen Traum, an einem sonnigen, romanischen Meer[117] aufzutauchen, und eines Tages war er auch dort verschwunden und fand sich mit alten Freunden, die er lange nicht gesehen hatte, auf der Piazzetta zusammen, um mit Einbruch der Nacht nach dem schimmernden Lido hinüberzufahren. In der Erinnerung solcher Leute entsteht allmählich eine eigene Geographie: Orte, die ihnen verwandt waren, rücken zusammen und hängen sich wie die Glieder einer Kette aneinander an, – andere, die auf der Karte benachbart sind, werden einander fremd, als ob sie verschiedenen Zeiten und Ländern angehörten. Die Welt ordnet sich neu: sie wird kleiner, übersehbarer, persönlicher. Man kommt aus London zurück und erinnert sich eines Paolo Uccello, eines wunderbaren heraldischen Turnierbildes in Silber und Schwarz, und bei Florenz denkt man vor allem an Hugo van der Goes, den geheimnisvollen Niederländer, und das Ospedale von Santa Maria nuova wandelt sich wie auf einen Wink in einen jener weißen Beguinenhöfe, die Brügge so unvergeßlich machen. Brügge steigt auf. Die verlassenen Gassen, die stillen gebogenen Brücken, die über die tiefen Spiegelbilder schlafender Dinge zu anderen verlassenen Gassen führen. Und mit einem Male ist es Venedig, das abendliche Venedig mit seiner goldendunkelnden Luft, Venedig, welches seine »Tizianische Stunde« hat. So bewegt sich die Erinnerung und hat Stunden der Ebbe und Stunden der Flut, aus denen allmählich ein neues Land steigt, ein neues Leben, die eigene Welt eines jungen Menschen, der das alles gesehen hat. Die Welt, von der in diesem Falle zu reden ist, hat sich frühzeitig gerundet und abgeschlossen;[118] denn, wenn Heinrich Vogeler reiste, geschah es weniger, um Fremdes aufzunehmen, als vielmehr, um sich gegen das Andersartige zu halten und die Grenzlinie der eigenen Persönlichkeit zu ziehen, festzustellen, wo das Eigene aufhörte und wo das Fremde begann. Dieses ist der Sinn und die unausgesprochene Absicht seiner Reisen gewesen; unter dem Einfluß fremder Dinge hat er erkannt, was das Seine ist und wenn etwas an dieser Entwickelung überrascht, so ist es der Umstand, daß er so früh schon sich zu verschließen begann, zu einer Zeit, wo andere junge Leute erst recht aufgehen und sich ziemlich wahllos den Zufällen hingeben, welche ihnen begegnen. Es liegt eine gewisse Reife, aber auch eine gewisse Beschränkung in diesem frühzeitigen Torschluß, als hätte dieser Mensch sich nach dem Ebenbilde jenes alten Edelhofes erbaut, der hinter weißen Mauern und dunklen Gräben im Tale lag und zu dem er als Knabe immer sinnend hinübersah. Diese Entwickelung ging darauf aus, sich sobald als möglich mit Mauern und Gräben zu umgeben; was hier beabsichtigt war, war kein Sich-ausbreiten von einem festen Punkte aus, sondern es sollte die Peripherie eines Kreises gefunden werden, den immer dichter auszufüllen die eigentümliche Aufgabe dieses Menschen zu werden schien. Was an dieser Aufgabe zunächst auffällt, ist ihre Absehbarkeit; künstlerische Ziele liegen immer im Unendlichen und es ist nicht möglich, etwas über ihre Erreichbarkeit zu sagen. In diesem Falle aber war das Thema begrenzt, enge begrenzt sogar, und man mußte dabei nicht notwendig an eine Kunst und an[119] einen Künstler denken; es war vor allem ein Leben, was da entstehen wollte und entstand.
Freilich, so lange dieser junge Mensch seine kleine, abgeschlossene, eigene Welt in sich herumtrug, war sie nicht viel mehr als eine kleine Eigenheit, ein persönlicher Widerspruch gegen alles Andere, zu leise und vornehm, als daß er bemerkt worden wäre und von der ganzen großen Wirklichkeit fortwährend widerlegt. Es gehen viele mit solchem Anderssein, mit einem unaufhörlichen inneren Widerspruch in der Welt herum und sie sind deshalb nicht mehr als unzufriedene Sonderlinge, deren Seltsamkeiten kaum ernst genommen werden. Es kommt darauf an, ob so ein Protest die Kraft hat sich durchzusetzen, sich als Wirklichkeit jener anderen, allgemein anerkannten Wirklichkeit gegenüber zu stellen, ihr das Gleichgewicht zu halten, ja womöglich in seinen Höhepunkten überzeugender zu sein als sie. Die Weltgeschichte ist erfüllt von solchen Protesten; an den Auflehnungen Einzelner rankt sie sich empor. Aber auch das mönchische Dasein (wie Franciscus es gemeint hat) ist ein solcher Protest, der, ohne an die Wirklichkeit der Anderen zu rühren, im Begründen einer zweiten Wirklichkeit beruht. Da haben wir ein Leben, welches sich mit Mauern umgeben und darauf verzichtet hat, sich über diese Grenzen hinaus auszudehnen. Ein Leben nach Innen. Und dieses Leben verarmt nicht. Inmitten schiffbrüchiger Zeiten scheint es die Zufluchtstätte aller Reichtümer zu sein und wie in einem kleinen zeitlosen Bilde alles zu vereinen, wonach die Tage draußen ringen und jagen.[120]
Seine Gesetzmäßigkeit wird immer klarer und sichtbarer und wie ein schimmerndes Spinnennetz scheint es sich mit hundert wohlgefügten Fäden an seinen Mauern zu halten. Innige und einfältige Arbeit ist die Wurzel dieses Lebens, und ganz von selbst kommt alles Gute und Große aus ihm heraus: Fleiß und Freude und Frömmigkeit und endlich auch, ohne daß jemand es will, eine Kunst. Eine Kunst, die man von allem anderen nicht trennen kann, weil sie nichts ist, als dieses Leben selbst, wenn es blüht.
Wer sich nun entschließt, an Stelle einer mönchischen Gemeinschaft einen Einzelnen zu setzen, einen Menschen von heute, der nach dem Willen seines Wesens, wie nach einer Ordensregel seine eigene Welt gebaut, begrenzt und verwirklicht hat, der wird am besten imstande sein, die Erscheinung Heinrich Vogelers und den Ursprung seiner Kunst zu verstehen; denn man kann von dieser Kunst nicht reden, ohne des Lebens zu gedenken, aus welchem sie wie eine fortwährende Folge fließt. Gleich der Kunst jener mittelalterlichen Mönche steigt sie aus einer engen und umhegten Welt auf, um an der Weite und Ewigkeit der Himmel leise preisend teilzunehmen.
Heinrich Vogeler fand in Worpswede den Boden für seine Wirklichkeit. Seine Kunst ist zuerst ein seliges und entzücktes Voraussagen derselben, und alle Märchen seines großen alten Skizzenbuches fangen mit den Worten: »Es wird einmal sein..« an. Zeichnungen und Radierungen erzählen, feinstimmig und flüsternd, von dem Künftigen. Und später – in Bildern – feiert er, reif und[121] dankbar, die Erfüllungen seines Lebens. Das ist der eigentliche Inhalt seiner Kunst. Was ihn sonst noch beschäftigt, sind Erinnerungen aus Tagen oder Träumen, die er geheimnisvoll, wie Märchen, erzählt. Ein unermüdliches Erforschen der Formen geht nebenher, das ihn immer fähiger macht, Alles, bis in die Nuancen genau so zu sagen, wie er es erlebt. Und er erlebt es ungewöhnlich und neu, so daß seine Kunstsprache sich viele Ausdrücke schaffen mußte, um seinen Erlebnissen folgen zu können.
Aber auch ganz am Anfang, als sie nur wenig Worte besitzt, gebraucht er keine fremden Ausdrücke neben ihr und bedient sich ihrer, als ob sie unerschöpflich wäre. Und in jenen frühen radierten Blättern trägt gerade das Lückenhafte und stellenweise Ungeschickte der eigenartigen Formensprache dazu bei, den Reiz des Inhaltes zu erhöhen. Es besteht ein gewisser Parallelismus zwischen diesen schütteren Strichen und dem durchscheinenden und dürftigen Wesen der allerersten Frühlingstage, von denen er erzählt. Dünne Birken, Wiesen, in denen schüchtern frühe Blumen stehen, und ein großmaschiges Netz von Ästen, durch welches überall der blasse Himmel sieht. Manchmal sitzt ein schlankes Mädchen, ein stilles, gekröntes Kind, im Gras und schaut mit weiten Augen, fortwährend staunend, den Vögeln zu, die zu Neste tragen; manchmal steht eine Burg in der Ferne und alle Wege im ganzen Land gehen neugierig auf sie zu; manchmal ist es Wald im Hintergrund und vor dem Walde steht ein Ritter aufrecht da und bewacht das nachdenkliche Spiel der Schlangenbraut. Oder es kommt eine schmale[122] Quelle gegangen im hohen Gras, und am Horizont vor den weißen eiförmigen Frühlingswolken taucht ein Knabe auf, ein Hund, Ziegen... Und dann kann man sehen, wie der Frühling wächst: die Bäume scheinen näher zusammenzutreten, die Wege werden heimlicher und bereiten sich vor, zu den ersten Liebestagen hinzuführen. Da entstehen die Blätter: »Liebesfrühling« und »Minnetraum«. Die beiden jungen Menschen, die sich lieb haben, wissen es schon. Sie sitzen nebeneinander, still zusammengefügt wie Hand in Hand. Und hinter ihnen erklingt der Liebe Lied, von einem Engel auf hoher Harfe gespielt: vor ihnen aber liegt der Liebe Land, in welchem Frühling ist, tief und aufgetan. Und wenn sie weitergehen, so treten Engel in langen Kleidern hinter den Bäumen hervor und umgeben sie mit ihrem Gesang, und singen alles, so daß ihnen gar nichts mehr zu sagen übrig bleibt:
»Wir müssen, Geliebteste, leise
hinschreiten, ich und du...«
Es ist mehr als nur ein Frühling in diesen Blättern. Und nicht das Glück der Menschen allein, die sich gefunden haben und nun zusammengehen, erklingt in ihnen, das Glück aller Dinge, die den Frühling fühlen, scheint darin irgendwie ausgesprochen zu sein; Heinrich Vogeler gehört zu denjenigen, von welchen es einmal in einem Briefe Jacobsens heißt, daß ihnen »die Bäume und der Bäume kleine Heimlichkeiten täglich Brot« sind. Er weiß in das Leben der kleinsten Blumen hineinzublicken; er kennt sie nicht von Sehen und vom Hörensagen. Er ist in ihr Vertrauen eingedrungen und wie der Käfer[123] kennt er des Kelches Tiefe und Grund. Man betrachte seine Blumenstudien: sie sind von einer beispiellosen Gewissenhaftigkeit, und es ist doch nichts Pedantisches an ihnen; denn man fühlt die Wichtigkeit und Notwendigkeit eines jeden Striches und wie er unvermeidlich war. Die Kunst, in einer Blume, in einem Baumzweig, einer Birke oder einem Mädchen, das sich sehnt, den ganzen Frühling zu geben, alle Fülle und den Überfluß der Tage und Nächte, – diese Kunst hat keiner so wie Heinrich Vogeler gekonnt. Seine Mappe »An den Frühling« ist viel zu wenig bekannt geworden. Einzelne Blätter derselben gehören zu den schönsten Offenbarungen seines Werkes. Und hier zeigt es sich auch, weshalb seine Frühlingserfahrung so intim und tief, so wenig allgemein ist. Es ist nicht das weite Land, darin er wohnt, bei dem er den Lenz gelernt hat; es ist ein enger Garten, von dem er alles weiß, sein Garten, seine stille, blühende und wachsende Wirklichkeit, in der alles von seiner Hand gesetzt und gelenkt ist und nichts geschieht, was seiner entbehren könnte. Die kleinste Blume, die da entstand, hat er zur Taufe gehalten und jeder Rose hat er die Mauer hinaufgeholfen zu dem Platze, wo sie lächeln und leben wollte. Die Bäume, die draußen in der Heide stehen, sind ihm fremd wie die Menschen, die draußen wohnen; aber seiner Bäume Kindheit hat er Tag für Tag überwacht und hat teilgenommen an ihnen wie an Brüdern. Darum liebt er die großen Winde dieses Landes, weil sie sich wie Hände an seine Bäume legen und das, was er geplant hat, bilden und biegen in den bewegten Nächten des Frühlings,[124] wenn die Stämme, steigender Säfte voll, wie Fontänen stehen im Sturme. Und der weite Himmel ist ihm lieb, weil er seiner kleinen Blumen Licht und Regen ist und der Glanz auf den Blättern seiner Bäume und in den Fenstern des weißen Hauses, das mitten im Garten steht. Er ist der Gärtner dieses Gartens, wie man der Freund einer Frau ist: leise geht er auf seine Wünsche ein, die er selbst erweckt hat, und sie tragen ihn weiter, indem er sie erfüllt. Was er ihm im Herbste vertraut, kommt ihm neu im Frühling entgegen, und was er in den Frühling legt, bleibt nicht so, wächst, wächst in den Sommer hinein, hat ein Leben für sich und seinen eigenen Tod in den tödlichen Tagen des Herbstes. So lebt er sein Leben in den Garten hinein, und dort scheint es sich auf hundert Dinge zu verteilen und auf tausend Arten weiterzuwachsen. In diesen Garten schreibt er seine Gefühle und Stimmungen wie in ein Buch; aber das Buch liegt in den Händen der Natur, die wie ein großer Dichter die flüchtigsten seiner Einfälle gebraucht, um sie auf eine unerwartete Weise auszuführen. So hat er einen Baum gepflanzt oder eine Laube geflochten um des Frühlings willen; und er hat den Baum schlank und zart und die Laube locker gemacht, wie es im Sinne des Frühlings war. Aber die Jahre gehen, der Baum und die Laube verändern sich, sie werden reicher, breiter und schattiger, der ganze Garten wird dichter und rauscht immer mehr, – und so reißen die Dinge, die er aus einem frühlinglichen Empfinden gepflanzt hat, ihn mit, in den Sommer hinein, in den sie sich immer tiefer verlieren.[125] An diesem Garten, an den sich immer steigernden Anforderungen seiner verzweigteren Bäume, ist Heinrich Vogelers Kunst gewachsen; hier waren ihr immer neue, immer schwerere Aufgaben gestellt, Aufgaben, die langsam von Jahr zu Jahr komplizierter wurden und anspruchsvoller. Da waren nichtmehr die kleinen Bäume um ihn, die sich mit wenigen Linien sagen ließen, und was sich rankte ging nicht nur auf den Spuren mehr, auf denen er es geführt hatte, empor. Aus umrandeten Schleiern waren gefüllte Spitzen aus dichtem Grün geworden, und es galt den Gesetzen eines verschlungenen Musters nachzugehen. Die Kronen der Bäume hatten sich dichter vergittert und überall waren unter dem Einfluß des Wachstums und des Windes neue Linien entstanden, Linien und Systeme von Linien, Überschneidungen und Verkürzungen, die auf den ersten Blick etwas Verwirrendes hatten. Aber es war nicht der erste Blick, der auf ihnen ruhte. Es war ein Auge, das nicht allein sah, sondern das auch wußte und gesehen hatte, wie alles geworden war. Dieses Wissen ist es, was die Bäume, die Heinrich Vogeler später gezeichnet hat, so überzeugend, was das Durcheinander von unzählbar vielen Zweigen so klar und organisch macht. Er hat manchmal (auf den neuen Federzeichnungen) Bäume erfunden, deren Astwerk von so fabelhafter Durchbildung und Gesetzmäßigkeit erfüllt ist, daß sie einer komplizierten Wirklichkeit genau nachgebildet scheinen. Seine Liniensprache, welche auf den frühen Radierungen nur wenige Ausdrücke, rhythmisch, (wie im Volkslied) wiederholte,[126] entnahm dem dichteren Garten tausend Bereicherungen. An Stelle des Lockeren und Lichten, das seinen Blättern und Bildern im Anfang eigentümlich schien, tritt immer mehr das Bestreben, einen gegebenen Raum organisch auszufüllen. Auf den Radierungen aus der späteren Zeit beginnt diese neue Absicht deutlich zu werden, aber erst auf den Federzeichnungen erfüllt sie sich ganz. Wie eine Baumflechte mit tausend und abertausend Fäden überzieht die Zeichnung das Blatt, überwuchert es mit ihrem Reichtum, breitet sich darinnen aus wie ein Gewebe unter dem Mikroskop. Mag, was den Inhalt dieser merkwürdigen Blätter betrifft, die dekadente Linienphantastik Aubrey Beardsleys anregend auf Vogeler gewirkt haben, das Wesentliche an ihnen wuchs aus ihm heraus, und der Einfluß seines Gartens ist stärker als jeder andere gewesen.
Wie aus dem intensiven und sachlichen Empfinden des Frühlings die filigranen Figuren jener Prinzen und Edelkinder entsprangen, welche die Märchenradierungen erfüllen, so scheinen die phantastischen Gestalten der Zeichnungen aus Sommer-Märchen zu stammen. Etwas von des Sommers Fülle, Bürde und Überfluß ist in ihnen. Das Schwerwerden der Früchte, aber noch viel mehr das maßlose Aufgehen großer gezüchteter Blumen, die, weil sie für keine Frucht sparen müssen, immer mehr anwachsen, üppiger und schwüler werden. Kelch rollt sich aus Kelch und, wie Fangarme von Polypen, langen die schlangenhaften Staubfäden nach unwahrscheinlichen gekrönten Vögeln hin, die, im Verkehr mit diesen überschwenglichen Blumen, ihnen[127] ähnlich werden. Es ist wie ein Meeresgrund, in den man sieht, und die Last eines schweren Meeres scheint über dieser lautlosen Natur zu liegen. Und so wahr und überzeugend ist das Leben dieser Formen, daß man ihnen die Farbe anfühlt, die giftige, glänzende, übertriebene Farbigkeit, die sie verschweigen. Khnopff hat einmal die Bleistiftzeichnung eines unsagbar sinnlichen Mundes »Rote Lippen« genannt; ähnlich könnten diese Federzeichnungen die Namen unerhörter Farben tragen: man müßte sie ihnen glauben.
Wenn schon die Radierungen »An den Frühling« mit Recht in einer Mappe zusammengefaßt werden konnten, so denken diese Blätter noch viel weniger daran, sich an Wände zu wünschen. Ihrer Intimität entspricht es, als Mappenwerk behandelt zu werden, ja man kann sie sich sogar in einem Buche vorstellen als Gegenstück einer mit feingliedrigen und stillen Typen bedruckten Buchseite. Es ist eine Nebenerscheinung dieser eigentümlichen Entwickelung Heinrich Vogelers, daß sie ihn ganz besonders befähigt hat, Bücher zu schmücken. Seine Absichten gehen schon lange (seitdem er sich mit einigen guten Exlibris dem Wesen des Buches genähert hat) nach dieser Seite hin, aber erst jetzt, da sein Linienstil diese Durchbildung erreicht hat, wird er imstande sein, ganz Glückliches in dieser Richtung zu leisten. Einige Titelblätter in der »Insel«, die Ausstattung eines kleinen Bandes Bierbaum'scher Gedichte und der wundervolle Schmuck, mit dem er das Drama »Der Kaiser und die Hexe« von Hugo von Hofmannsthal umgeben hat, bestätigen, daß seine ruhig und geschlossen wirkende[128] und doch innerlich so reiche Linienkunst wie keine geeignet ist, neben dem Gange edler Lettern wie ein Gesang herzugehen. Aber nicht dem Buchgewerbe allein, allem was Kunstgewerbe heißt, ist dieser Künstler eine große Hoffnung. In seiner auf Verwirklichungen gestellten Eigenart mußte sich bald der Wunsch entwickeln, Dinge zu machen. Aus ganz früher Zeit stammen gestickte Bucheinbände, Wandbekleidungen und Gläser, aber auch anderer Gegenstände sucht seine Empfindung, die sich immer mehr in Wirklichkeiten umsetzt, mächtig zu werden. Es ist versucht worden, diesen »Stil« als eine Nachempfindung des späteren Empire zu deuten, aber es liegt näher, seine Dürftigkeit und Naivität auf das Wesen junger Gärten zurückzuführen und ihn als eine Frucht jener Frühlingskunst zu betrachten, die einen großen Raum in Heinrich Vogelers Schaffen einnimmt. Inzwischen hat auch dieses Stilgefühl sich erweitert und ausgebildet, und es kann sich besser durchsetzen, seit der Künstler sich die Kenntnis einzelner Stoffe erworben hat, seit er weiß, wie Seide und Silber, Holz und Glas behandelt werden müssen, wenn alle Besonderheiten und Tugenden des Materials sich entfalten sollen. Vielleicht war es der Mondschein über seinem Garten, der ihn zuerst auf das Silber hingewiesen hat, das er jetzt, wie ein Dichter seine Sprache, beherrscht. Er versteht dieses sanfte, wahlverwandte Metall und seine mädchenhafte Art wie kein zweiter. Der schöne Spiegel und die Leuchter, die nach seinem Entwurfe hergestellt worden sind, können nur Silber sein; man denkt sie in Silber, wenn man sie[129] abgebildet sieht. Wie er Metall überhaupt zu brauchen weiß, davon zeugt auch das prachtvolle Messing-Rosengitter des Kamins, das, indem es organisch aufwächst, zugleich, wie ein Visier, das Feuer durchschauen läßt, das sich dahinter erheben soll.
Die Ausführung von Spitzen war nur ein Schritt in gerader Linie über die Federzeichnungen hinaus: die Verwirklichung, welche ihnen am nächsten lag. Aber die Beschäftigung mit anderen Stoffen wies neben der Form immer wieder auf die Farbe hin. Und auch für die Farbe und die Farbendichtung: das Bild – wußte der wachsende Garten vieles zu lehren.
Die Farbe auf den frühen Bildern Heinrich Vogelers entspricht in gewissem Sinne dem Kontur der ersten Radierungen; sie ist dünn und fließt hell in den Ufern der Umrisse hin. Wie er sich bei dem ersten Wandteppich mit Applikation größerer Seidenstücke bedient, so finden sich auch auf jenen Bildern gleichmäßige, breite Farbenflächen, welche summarisch und gleichsam im Sinne des einfachen Kolorierens gesehen sind. Damals entstand der Profilkopf eines jungen Mädchens mit rötlich blondem Haar, ein Bild, welches sehr fein und ausgeglichen in den Farbenwerten ist und fast schon auf derselben Höhe steht wie die »Heimkehr«. Man kann von diesem Bilde nichts Rühmenderes sagen, als daß in ihm alles Liebliche und Stille aus Vogelers erster Schaffenszeit noch einmal anklingt; es wirkt wie ein letzter Frühlingstag. Die Rosen wurden groß, und morgen wird Sommer sein. Eine wunderbar sanfte Dämmerung ist in dieses Bild mit hineingemalt; alle[130] Farben sind erfüllt von ihr und tragen sie wie ein Licht, welches noch nicht reif geworden ist.
Die Bilder, die nun folgen, sind Versuche, bewegte und lebendige Farben zu malen, Farben, die nichtmehr wie ein Überzug über den Dingen liegen, sondern sich wie fortwährende Ereignisse auf ihrer Oberfläche abspielen. Da entstand jener Ritter auf der Heide, der vor dem hohen Wolkenhimmel hält, und es war etwas Neues in der Art, wie die Luft und die Heide gegeben war. Das grüne Kleid der Dame auf dem »Frühlingsabend« und die schimmernden Birken hinter ihr zeigten eine intimere Malweise. Aber alles das bereitet nur auf das Bild »Maimorgen« vor, welches das erste vollständige Gelingen auf diesem Wege bedeutet.
Hinter dem weißen Haus und seinen hohen Bäumen geht die Nacht zu Ende, und man sieht seiner Front und den aufflammenden Fenstern den Sonnen-Aufgang an. Schon steigt flutende Röte die Freitreppe hinan und die Luft zittert vor Kälte und Erwartung. Selten ist die Unruhe und das frohe und fröstelnde Gefühl dieser Stunde so gemalt worden. Es ist nicht ein Stück in dem ganzen Bilde, das nicht teilnimmt am Tagwerden, die Konturen schwingen wie Nerven und sind erregt. Hier ist, was die Farbe betrifft, eine ähnliche Steigerung erreicht wie in den Federzeichnungen in Bezug auf die Linie und ihre Lebendigkeit. Beide Entwickelungen sind nebeneinander hergegangen, zu beiden hat der wachsende Garten den Anstoß gegeben. Indem er dichter wurde und sich immer mehr anfüllte mit Formen und Farben, veränderte sich auch das Licht, das ihn umgab.[131]
Es fiel nichtmehr breit durch das großmaschige Netz zählbarer Äste auf die Wiesen; die Blätter, die Blüten, die Früchte, die Flächen von tausend aneinandergedrängten Dingen fingen es wie kleine Hände auf und spielten damit, glänzten, dunkelten und glühten.
Mit diesem neuen Wissen und Schauen Bilder zu malen war eine freudige Ungeduld. Rasch nacheinander entstanden das »Melusinen-Märchen« und die »Verkündigung«. Bei dem ersteren ist der Zusammenhang mit den Federzeichnungen deutlich erkennbar; auch hier ist die Aufgabe, einen Raum organisch auszufüllen, gelöst, diesmal freilich im farbigen Sinne. Wie ein Mosaik in Grün und Gold ist dieser wildernde Wald gesehen, aus dessen flimmernder Tiefe das staunende Mädchengesicht dem tumben Eisenmann entgegensieht, der heiß und hilflos in der Rüstung steht. Man muß auch bei diesem eigentümlichen Bilde nicht an das Märchen denken, nach dem es benannt ist, aber man könnte eine Geschichte dazu schreiben, die wie ein Märchen klingt. Ist nicht jedes Mädchens Einsamkeit ein solcher verworrener Wald, ein Wald aus tausend Dingen, Träumen und Heimlichkeiten, in den der Mann als der Fremde kommt, schwerfällig, übergroß und mit einer Rüstung angetan, die er nicht brauchen kann? Es ist vielleicht das Unvergeßlichste in dem Bilde, wie das Melusinenmädchen mit dieser Wirrnis übervielen Dingen verflochten ist, so daß man nicht sagen kann, wo es beginnt, und ob es nicht die bangen Augen des Waldes selber sind, die sich, neugierig und beunruhigt zugleich, auftun vor dem Unbekannten.[132]
Und dieses Mädchen, das Melusine ist, wenn ein Mann in Waffen ihre Einsamkeit stört, ist Madonna, wenn der Engel kommt mit der Verkündigung. Der Engel, der die Botschaft bringt, erschreckt sie nicht. Er ist der Gast, den sie erwartet hat, und sie ist seinen Worten eine weitoffene Flügeltür und ein schöner Empfang. Und der große Engel steht über sie geneigt und singt so nah, daß sie keines seiner Worte verlieren kann, und in den Falten seines reichen Kleides steht die Bewegung noch, mit der er sich zu ihr niederließ. Jetzt ist sein Himmel fern und nur die Erde ist da, und man sieht weit hinein in ihre stille Wirklichkeit. Dieses Bild ist von einer gleichmäßigen, ruhigen Schönheit erfüllt, Glanz und Güte bis in seine fernsten Fernen. Man fühlt, daß dieser Künstler auf einem eigenen Weg zu den Stoffen der Bibel kam; er spricht ihre Worte, wenn er sie malt, nicht wie Wunder aus, vielmehr wie gute, glückliche Begebenheiten, die das Leben reich und wichtig machen. Sein Verkündigungsbild steht den Verkündigungen der alten Meister näher als etwa den Marienbildern Rossettis oder Uhdes. Es ist voll Einfalt, Liebe und Innigkeit. Er hat es nicht auf den Knieen gemalt; denn er hat dabei nicht an den Himmel gedacht, sondern an seinen Garten, der Himmel und Erde ist und Erde und Himmel. Und man denkt auch deshalb an die alten Meister bei Heinrich Vogeler, weil sein Leben so anders ist, so schlicht und so feierlich, so klein und so groß. Man weiß nicht, wie man ihn nennen soll. Er ist der Meister eines stillen, deutschen Marienlebens, das in einem kleinen Garten vergeht.[133]
Die Stürme des Frühlings gehen über das Land. Aber manchmal halten sie ein und es entsteht eine Stille. Es kommen Tage, da der ganze Himmel Regen ist, lauer hellgrauer Regen, – und die ganze Erde ein Empfangen und Halten dieses Regens, der sanft fällt, ohne sich wehe zu tun.
Und die Stunden gehen, und es gleicht keine der anderen. Und viele nahen, entfalten sich und schließen sich wieder, ohne daß jemand es sieht. Und man denkt manchmal, daß das die besten und seltsamsten sind, die am meisten Größe haben.
Es ist so vieles nicht gemalt worden, vielleicht Alles. Und die Landschaft liegt unverbraucht da wie am ersten Tag. Liegt da, als wartete sie auf einen, der größer ist, mächtiger, einsamer. Auf einen, dessen Zeit noch nicht gekommen ist.
Westerwede, im Frühling 1902.
|
Ausgewählte Ausgaben von
Worpswede
|
Buchempfehlung
Hoffmannswaldau, Christian Hoffmann von
Gedichte
»Was soll ich von deinen augen/ und den weissen brüsten sagen?/ Jene sind der Venus führer/ diese sind ihr sieges-wagen.«
224 Seiten, 11.80 Euro
Im Buch blättern
Ansehen bei Amazon
Buchempfehlung
Geschichten aus dem Biedermeier II. Sieben Erzählungen
Biedermeier - das klingt in heutigen Ohren nach langweiligem Spießertum, nach geschmacklosen rosa Teetässchen in Wohnzimmern, die aussehen wie Puppenstuben und in denen es irgendwie nach »Omma« riecht. Zu Recht. Aber nicht nur. Biedermeier ist auch die Zeit einer zarten Literatur der Flucht ins Idyll, des Rückzuges ins private Glück und der Tugenden. Die Menschen im Europa nach Napoleon hatten die Nase voll von großen neuen Ideen, das aufstrebende Bürgertum forderte und entwickelte eine eigene Kunst und Kultur für sich, die unabhängig von feudaler Großmannssucht bestehen sollte. Michael Holzinger hat für den zweiten Band sieben weitere Meistererzählungen ausgewählt.
- Annette von Droste-Hülshoff Ledwina
- Franz Grillparzer Das Kloster bei Sendomir
- Friedrich Hebbel Schnock
- Eduard Mörike Der Schatz
- Georg Weerth Leben und Taten des berühmten Ritters Schnapphahnski
- Jeremias Gotthelf Das Erdbeerimareili
- Berthold Auerbach Lucifer
432 Seiten, 19.80 Euro
Ansehen bei Amazon
- ZenoServer 4.030.014
- Nutzungsbedingungen
- Datenschutzerklärung
- Impressum

![Worpswede: Fritz Mackensen, Otto Modersohn, Fritz Overbeck,Hans am Ende, Heinreich Vogeler [Reprint der Originalausgabe von 1905]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/31vGpoJs1kL._SL160_.jpg)