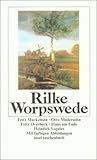Otto Modersohn
[63] Im Sommer 1890 stellten die Schotten, die sich in dem Dorfe Cockburnspath bei Glasgow niedergelassen hatten, zum ersten Male in München aus. Man erinnerte sich ihrer noch, als 1895 die Bilder aus Worpswede kamen. Aber diese Erinnerung verminderte nicht die Überraschung, welche die Werke dieser deutschen Maler bereiten mußten. Ein bekannter Kritiker schrieb damals, am 15. Oktober 1895: »Der Erfolg, den die Maler von Worpswede auf der heurigen Jahresausstellung im Münchener Glaspalast errangen, hat in der Geschichte der neueren Kunst nicht seinesgleichen. Kommen da ein paar junge Leute daher, deren Namen niemand kennt, aus einem Ort, dessen Namen niemand kennt, und man giebt ihnen nicht nur einen der besten Säle, sondern der eine erhält die große goldene Medaille und dem anderen kauft die Neue Pinakothek ein Bild ab. Für den, der irgend weiß, wie ein Künstler zu solchen Ehren sonst nur durch langjähriges Streben und gute Verbindungen kommen kann, ist das eine so fabelhafte Sache, daß er sie nicht glauben würde, hätte er sie nicht selbst erlebt. Niemals ist eine Wahrheit so unwahrscheinlich gewesen.«
Diese unwahrscheinliche Wahrheit war vor allem Otto Modersohn. Er war mit nicht weniger als acht Bildern vertreten, acht rasch hintereinander gemalten Bildern, in denen alles Glanz, Klang und atemraubende Bewegung war. Sein »Sturm im Teufelsmoor« wirkte wie eine Ballade, gesprochen von einem greisen Rhapsoden[63] mit weißem, wehendem Barte. Und derselbe, der einen Sturm so erleben konnte wie man ein Drama erlebt, derselbe hatte auch dieses helle, stille, gleichsam erwachende Bild gemalt, diesen »Herbstmorgen am Moorkanal«, mit seiner friedlichen Tiefe und dem einsamen Haus, das, von durchscheinenden schütteren Schatten verdunkelt, hinter den hell glänzenden, goldtragenden Birken steht. Das waren Kontraste. Krieg und Frieden, Hymne und Hirtenlied. Aber man sah auf den ersten Blick, daß sie ein Mensch in sich trug, ein schauender Mensch mit einer weiten Seele, in der alles Farbe und Landschaft wurde. Man stand vor Erlebnissen. Es waren confessions, was da gegeben war. Bekenntnisse in Versen, in breiten, langzeiligen, rauschenden Versen. Die Sprache war neu, die Wendungen ungewöhnlich, die Kontraste klangen aneinander wie Gold und Glas. Man hatte ähnliches nie gesehen, man war beunruhigt, betroffen, ungläubig. Bis jemand den Namen Böcklin aussprach. Freilich, jeder behauptete diesen Namen auf der Zunge gehabt zu haben; Böcklin: damit war alles gesagt. Einige Vorsichtige aber meinten: Nein, nicht Alles. Und heute fühlt man sogar: Nichts.
Nein, es war wirklich nichts damit gesagt. Ein bekannter Name war neben einen unbekannten gestellt worden. Nun standen sie zum ersten Male nebeneinander. Und? Und die Bilder des Unbekannten waren erklärt, mit Etikette versehen, chronologisch eingeordnet. Und? Und man konnte das Weitere ruhig abwarten. – Von diesem Weiteren wird hier die Rede sein.[64]
Um aber zunächst die beiden Namen, die man zusammengebracht hat, voneinander zu trennen, ist es gut, gleich zu sagen, wasfür Beziehungen zwischen diesem und jenem sich nachweisen lassen. Böcklin kam 1846 zu Schirmer nach Düsseldorf, Modersohn, als er achtunddreißig Jahre später an die Düsseldorfer Akademie kam, empfing seine ersten malerischen Anregungen aus den Landschaften Schirmers und Lessings. Das ist das Eine. Und das Andere: im Jahre 1888 besuchte Otto Modersohn zum ersten Male München und die Schackgalerie. Böcklin, der ihm dort zuerst entgegentrat, war ein großer unvergeßlicher Eindruck für ihn, man kann ruhig sagen: der größte. Corot, Millet und Dupré, die er gleichzeitig auf der Ausstellung in München kennen lernte, verblaßten daneben. Aber welchem jungen Maler mochte das damals nicht so gehen? Und geht es heute nicht allen ebenso? Böcklin ist ein Abschnitt, eine Wasserscheide, das Neue Testament der Malerei. Und vor allem der Landschaftsmalerei. Sich zu ihm zu bekehren ist selbstverständlich, an seine Lehre zu glauben nicht gefährlich, da sie längst aufgehört hat als Ketzerei zu gelten. Sie ist Staatsreligion. Und überdies vergißt man, daß gerade die Ganzgroßen jungen Leuten nichts zu sagen wissen als: »Sei du. Man weiß ja nicht ob es möglich ist, aber wenn du irgend kannst, – sei du.« Das hat Böcklin damals zu dem jungen Modersohn aus seinen Bildern heraus gesagt. Und Modersohn ging hin und versuchte es und wurde es und war es. Das ist seine Beziehung zu dem Meister von Fiesole.[65]
Sei du! Einer sein, als Künstler, heißt: sich sagen können. Das wäre nicht so schwer, wenn die Sprache von dem Einzelnen ausginge, in ihm entstünde und sich, von da aus, allmählich Ohr und Verständnis der anderen erzwänge. Das ist aber nicht der Fall, im Gegenteil, sie ist das Gemeinsame, das keiner gemacht hat, weil alle es fortwährend machen, die große, summende und schwingende Konvention, in die jeder hineinspricht was er auf dem Herzen hat. Und da kommt es vor, daß Einer, der innerlich anders ist, als seine Nachbaren, sich verliert indem er sich ausspricht, wie der Regen im Meer verloren geht. Alles Eigene erfordert also, wenn es nicht schweigen will, eine eigene Sprache. Es ist nicht ohne sie. Das haben alle gewußt, die große Verschiedenheiten in sich fühlten. Dante und Shakespeare haben sich ihre Sprache gebaut, ehe sie redeten, Jacobsen schuf sich die seine, Wort für Wort. Woher sie zu holen ist, hat er besonders deutlich durch die Tat gezeigt, und Delacroix hat das Rezept gegeben in den Worten: »La nature est pour nous un dictionnaire, nous y cherchons des mots.«
Das scheint in Widerspruch zu stehen mit einer Behauptung, welche sich am Eingange dieses Buches findet, damit, daß gesagt wurde, die Natur sei, dem Menschen gegenüber, das Andere, das Fremde, das nichteinmal Feindliche, das Teilnahmslose. Und das wird nun an dieser Stelle nicht aufgehoben, sondern wiederholt. Gerade dieser Umstand macht es möglich, sich der Natur als eines Wörterbuches zu bedienen. Nur weil sie uns so sehr verschieden, so ganz entgegengesetzt[66] ist, sind wir imstande, uns durch sie auszudrücken. Gleiches mit Gleichem zu sagen ist kein Fortschritt. Eisen an Eisen geschlagen giebt nur ein Geräusch, keinen Funken. Freilich diese eigentümliche Möglichkeit ist nicht von Anfang an dagewesen, sie hat sich entwickelt, sie ist gewachsen. Sie ist eine von den hundert Beziehungen, mit welchen der Mensch sich im Laufe der Jahrhunderte an die Natur gehängt hat. In den fernsten Zeiten nahm er ihre taube Gleichgültigkeit für Strenge und, weil er ihre Kälte nicht ertrug, bevölkerte er sie mit großen, grausamen Mächten und unterwarf sich ihnen. Und doch war diese Demut nichts anderes als eine maßlose Überhebung. Die ganze Natur schien damit gezwungen, sich auf den Menschen zu beziehen; es war, als könnte sie sich nur durch ihn, durch sein vergrößertes und verzerrtes, götzenhaft vergröbertes Ebenbild ausdrücken. Damals gab es keine Kunst. Man sah die Natur nicht, man fürchtete sie. Und auch als man zu sehen begann, sah man nicht sie; man sah das Nächste: den Nächsten. Er war das erste Stück Natur, von dem man Ausdrücke verlangte; zunächst, weil man Hülfe brauchte und wehrlos war, nur Ausdrücke für das Dringendste, Nötigste, Gemeinsamste. Auch damals gab es noch keine Kunst. Sie beginnt in dem Augenblick, da ein Mensch an ein Stück Welt herantrat, um aus ihm Worte für etwas Ungemeinsames, Ungemeines, Persönliches zu holen. Da, kaum daß das Gemeinwesen gesichert und der Einzelne geschützt ist, in der ersten freien Minute gleichsam, fragt er nach sich. Und schon ist ihm der[67] Nächste zu nah, um aus ihm das Bild für sich, für sein erstes einsames Erlebnis zu nehmen. Im Fernsten, das er noch überschauen kann, sucht er es auszusprechen. Und so ist diese erste Periode der Kunst, von der wir wissen, bezeichnet durch zwei Darstellungen, die immer wiederkehren: der König und das Tier. Und nun bleibt das Gesetz das gleiche durch alle Entwickelungen hindurch. Immer ist der Künstler derjenige, der etwas Tiefeigenes, Einsames, etwas, was er mit niemandem teilt, sagen will, sagen muß und immer versucht er das mit dem Fremdesten, Fernsten, das er noch überschauen kann, auszusprechen. Daß dieses Fernste immer auch dasjenige ist, was er am meisten liebt, folgt vielleicht erst daraus. Diese Liebe ist vielleicht nichts als seine rührende Dankbarkeit gegen den Gegenstand, von dem er sichtbare Zeichen für sein innerstes Erleben verlangen darf. Dieser Gegenstand verändert sich von Zeiten zu Zeiten, er nähert sich immer mehr der wirklichen Natur, bis er, in unseren Tagen, mit ihr zusammenfällt. Für den griechischen Künstler war es der nackte Mensch, zur Zeit der Wiedergeburt war es das Angesicht und das Weib und jetzt ist es die Landschaft, die wirkliche Natur, zu der die Dinge, seit man sie aufmerksamer zu malen begann, langsam hingeführt haben. Der Künstler von heute empfängt von der Landschaft die Sprache für seine Geständnisse und nicht der Maler allein. Es ließe sich genau nachweisen, daß alle Künste jetzt aus dem Landschaftlichen leben. Sehr leicht ist zum Beispiel an altmodischen Gedichten zu sehen, wie man zaghaft[68] glaubte, mit den Mitteln der Landschaft nur das Allgemeine sagen zu können; man meinte das Höchste erreicht zu haben, wenn man die Jugend dem Frühling, den Zorn dem Gewitter und die Geliebte der Rose verglich; man wagte gar nicht persönlicher zu sein, aus Furcht, von der Natur im Stiche gelassen zu werden. Bis man fand, daß sie nicht nur für die Oberfläche der Erlebnisse einige Vokabeln enthielt, sondern vielmehr Gelegenheit bot, gerade das Innerste und Eigenste, das Allerindividuellste, bis in seine feinsten Nüancen hinein, sinnlich und sichtbar zu sagen. Mit dieser Entdeckung beginnt die moderne Kunst.
Wenn es scheint, daß hier Überflüssiges, nicht in diesem Moment Fälliges zur Sprache kam, so wäre zur Entschuldigung zu sagen, daß es bei der Menge und Verwirrung der Meinungen nicht gut angeht, von einer bestimmten Kunst zu reden, ohne gewisse allgemeine Punkte festgelegt zu haben, auf welchen alle vorangehenden und alle folgenden Betrachtungen ruhen. Diese Voraussetzungen wollen sich nicht aufdrängen und sind nur da, um von dem Leser für die Dauer dieses Buches als Schlüssel gebraucht zu werden.
Leider giebt es ja in den wesentlichen Fragen der Kunst und des künstlerischen Schaffens noch keine breitere Übereinstimmung, mit der man stillschweigend rechnen kann; so ist jeder gezwungen, seinen Standpunkt anzugeben. Er läuft sonst Gefahr, mißverstanden zu werden, oder überhaupt unverständlich zu bleiben.
Auch die Stelle, an welcher diese Bemerkungen eingefügt[69] wurden, war nicht willkürlich gewählt. Sie waren für alle Künstler, von denen hier zu reden ist, wichtig. Vor allem aber: wie wäre es ohne diesen Fernblick möglich gewesen, die Bedeutung Otto Modersohns zu fassen, da man die Elemente seiner Kunst nicht anders als Persönlichkeit und Landschaft nennen kann? Um diesem Künstler gerecht zu werden, war es notwendig, statt der nächstliegenden Entwickelungen entferntere zu betrachten und einen Augenblick abzuwarten, wo in weite und geheimnisvolle Zusammenhänge ein Leuchten fiel. Und nun, da der Blitz, der sie aufdeckte, erloschen ist, kann man vorsichtig mit der bescheidenen Lampe weitergehen.
Der Schein dieser Lampe fällt in eine kleine Welt. Er beleuchtet ein Stück Mauer, das zu einem alten, kleinen Hause gehört, und einen Baum, von dem es sich zeigt, daß er in einem Garten steht, der, ähnlich wie ein Klostergarten, ganz von großen, alten Mauern umgeben, in die Höhe gewachsen ist, weil es ihm an Raum gefehlt hat, sich auszubreiten. Und dabei ist es kein ganz kleiner Garten: wenn man die Mauern aus verwittertem grünem Stein, von denen schwer der schwarze Efeu niederhängt, fortnehmen könnte, würde er ordentlich groß werden, aufatmen. Aber so sind die Gärten von Soest. So liegen sie, einer neben dem anderen, Straßen entlang, jeder in seinen vier Mauern, über welche nur die Wipfel rauschend herüberragen. Und dann ist es einmal Sonntagnachmittag, und man geht so eine leere Gartengasse entlang, umgeben vom Geräusch der eigenen Schritte, so geht man und schaut[70] die Baumkronen an und denkt sich die Gärten dazu, aus denen sie hinaufgewachsen sind. In den meisten Gärten stehen keine Häuser mehr; sie blühen und welken so vor sich hin, und es scheint kein Mensch von ihnen zu wissen. Aber selbst, wo noch Häuser sind, ist es schwer zu sagen, wer sie bewohnt. Man hört nur die Stimmen manchmal, wenn man an den Mauern vorübergeht, doch sie scheinen weither zu kommen von einem fernen Orte oder aus einer fernen Zeit. Aus der Zeit, da es hier viele Stimmen gab. Gewichtige Stimmen von Ratsherren, sanfte, gleichsam beschattete Frauenstimmen und Stimmen von jungen Mädchen und Kindern, die hell und herzlich zusammenklangen. Denn Soest war einmal eine große Stadt. Und wenn man da aufwächst, so denkt man immerfort an die Vergangenheit. Wie alles wohl war, denkt man und man wird nicht müde zu suchen, was etwa aus diesen Tagen des Glanzes und der Größe noch könnte geblieben sein. Und da finden sich vor allem zwei Dinge: die Kirchen und die Gärten.
Zu sagen, daß sie die Kindheit Otto Modersohns beeinflußten, ist zu wenig: sie waren sie. In den Kirchen sah er die Vergangenheit aufbewahrt, festgehalten, dort konnte sie nicht vergehen. Man mußte nur in Sankt Petri eintreten, um in einer anderen Welt zu sein; da war noch Mittelalter. Anders in den Gärten. Auch sie redeten von der Vergangenheit, aber sie hatten verstanden, sie irgendwie zu verbrauchen, umzusetzen, – sie lebten, sie veränderten sich, sie gehörten jeder Stunde die kam, dem Regen, dem Wind,[71] dem Abend und der Stille, und im März jedesmal, wenn der Schnee verging, konnte man sehen, daß sie voll Zukunft waren. Das Gefühl für Sage und Märchen, das sich in Otto Modersohn und in seiner Kunst später so wundervoll entwickelt hat, ist aus diesen Eindrücken geboren worden; denn was sind Sagen anderes, als Vergangenheiten, die sich in der Natur aufgelöst haben, Gestalten, die sich verschenkt haben an sie; ihre Zeit ist vorübergewesen, aber die Natur ist wie eine bleibende Zeit und hat Leben genug, um ihnen davon abzugeben und sie zu erhalten. Sie haben sich ihr angepaßt; die Männer haben die Gebärden der Bäume angenommen und die Mädchen haben von den Bächen singen und von den Winden tanzen gelernt. Und nun leben sie in der Natur, wie in einem See, aus dem sie manchmal auftauchen um Atem zu holen und um zu schauen, ob nicht am Ende der Gartenwege ein Mensch erscheint, den sie betrachten können. Denn sie sind noch nicht ganz so gleichgültig gegen den Menschen wie die Natur, in der sie leben; der Wald schaut immer in sich hinein und das Dunkel seiner hundert Augen ist in ihm. Sie aber horchen aus dem Wald heraus auf das Knirschen der Wege, und auf die Stimmen, welche näher kommen.
Das sind die Märchengestalten Otto Modersohns, und er mochte sie damals schon geahnt haben. Aber es war ein weiter Weg bis zu ihnen und er fing gleich an, ihn zu gehen. Da handelte es sich vor allem darum, der Natur so nahe als möglich zu kommen. Zu tun als lebte man in ihr, ganz so wie jene Wesen, eingeweiht in alle[72] Geheimnisse und vertraut mit der Tagesparole, die ausgegeben war. Da war keine Blume zu klein, sie wurde befragt und mußte sagen was sie wußte. Kein Käfer war zu gering; er lebte doch immerhin mitten drin, und man konnte eine Menge von ihm lernen. Nicht nur die Bäume, Büsche und Blumen kannte man; es war eine fortwährende Volkszählung der gesamten Einwohnerschaft des Gartens im Gange, und ein jeder Vogel, der sich vorübergehend innerhalb der Efeumauern aufhielt, mußte angemeldet sein. Man hielt offenes Haus und machte, was die Gäste anbetrifft, keine Ausnahme. Spinnen, mit ihren Eiersäcken beladen, gingen aus und ein, Fliegen und Falter, Ameisen im Arbeitsrock und vornehme Käfer im grünen, goldenschimmernden Staatsfrack. Und schließlich verkehrte man, in aufgeklärter Weise, auch mit den Gespenstern dieser kleinen Welt, den Larven. Man zitierte sie aus ihrem Grabe und sie kamen mumienhaft, wie in unzählige Bänder eingebunden, lang, schmal und mit verschleiertem Gesicht; man durfte sie nicht übergehen, denn sie wußten vielleicht am meisten von der Zukunft. Und so vergingen jene Jahre, welche vergehen wie ein Tag, so verging die Kindheit. Und eines Morgens erwachte der Held dieser Geschichte in einem fremden Bette, und vor den Fenstern seiner Stube lag, statt des Gartens, eine Gasse, die Gasse einer alten Stadt, die an Soest erinnerte, nur daß ihr die Gärten fehlten. Kirchen waren da, ja es gab sogar eine große Menge davon und sie waren alle voll Gesang, Klang und Pracht; denn sie waren katholisch. In Münster[73] war das. Oft erschien da ein junger, hagerer Gymnasiast bei den Franziskanern wenn die langen Maiandachten abgehalten wurden und sah, von einer dunklen Ecke aus, den braunen Mönchen zu, die da in der Dämmerung des Chores nach unbekannten Gesetzen sich bewegten. Dieser junge Mensch, der sonst leicht verlegen wurde, konnte stundenlang stehen und irgendwelche Leute beobachten ohne alle Befangenheit. Er sah sie, wie er die kleinen Tiere sah, und lernte dabei, ähnlich wie er von ihnen gelernt hatte: lernte Bewegungen, die in seltsamer Übereinstimmung standen mit dem Kleide, das einer trug, lernte in das geheimnisvolle Durcheinander einer Menge Rhythmus legen, lernte, daß die Umgebung auf merkwürdige Art an den Gestalten teilnimmt, und daß diese wieder in sie hineingehen, sich verlieren in ihr, verkleidet, mit einem lautlosen Mimikry angetan, das sich abstuft, einstimmt, unterordnet; lernte mit einem Wort, daß auf diese Weise überall ein Stück Natur entsteht, daß Wesen und Welt seltsam verwoben erscheint für das Auge dessen, der, nachdem er nahe war, zurücktritt und in ruhigem Schauen ein Ganzes zu fassen sucht. Und wenn das das Leben der Dämmerung war, so waren die großen Kirchenprozessionen das Leben des Lichts. Wie da alles durcheinanderwogte, Gesichter und Blumen, die hellen Kleider der Kinder und die bunten Brokate der Geistlichkeit. Die Monstranzen fingen das Sonnenlicht und warfen es haufenweise unter die Menge, und über allem schaukelten die schweren, farbigen Fahnen, mit jenem besonderen[74] Schwanken, in dem man die Schritte der Träger und die Anstrengung ihrer Arme wiedererkannte. Alles war Unordnung, Durcheinander, Verwirrung. Aber das Licht kam, umgab die Dinge und die Menschen, und schien alles mit Gesetzen zu erfüllen und in fabelhafter Geschwindigkeit eines auf das andere einzustimmen. Mit Wiesenblumen ist es manchmal so: man hat sie eilig gepflückt, ohne hinzusehen eine zur andern getan und es konnte, wenn man es genau nimmt, nichts dabei entstehen als ein Tumult. Aber auf einmal zögert man, hält den Strauß in die Luft und staunt, was das für ein Einklang ist: die Übergänge sind sanft abgestimmt und die Kontraste klingen rein aneinander.
Aber es war noch viel mehr in der Stadt zu sehen. Am Lambertusturm hingen die Käfige der Wiedertäufer und manchmal, wenn eine Prozession sich näherte, konnte man glauben, Johann von Leyden zu sehen, wie er, beladen mit allen Schätzen seines Königtums, hinter dem ungeheuren Richtschwert herging, in dem seine Macht, wie in einem einzigen Worte, zusammengefaßt war. Und drüben im großen Rathaussaal waren noch die Bilder der Herren, die 1648 den großen Frieden gemacht hatten zu dem großen Krieg. Ihre Stühle standen noch da und man konnte sich einbilden, in den Kissen noch die Abdrücke zu sehen, die eine andere Folge jener langen und wichtigen Sitzung der Gesandten waren.
Im Sommer vergaß man das alles. Da war die Natur die Hauptsache, die, wenn auch vor die Tore der[75] Stadt verlegt, doch immer noch einem so innigen Wunsche zehnmal im Tag erreichbar war. Aber im Winter, wenn draußen nichts war, da begann die ganze Vergangenheit wie eine zweite Natur, wie ein Wintergarten, zu wachsen und zu blühen. Eine große Tabelle wurde angelegt, die alle Könige und Kaiser umfaßte und die, als man mit den regierenden Dynastieen der ganzen Welt fertig war, sich auch noch den Päpsten, den Bischöfen, den Herzogen und einigen bevorzugten Fürsten- und Grafenhäusern öffnete, soweit man ihrer Namen und womöglich ihrer Bilder habhaft werden konnte. Natürlich wurden die Bilder genau abgezeichnet und bemalt. Und nicht diese Bilder allein, alles Bildmäßige, was irgend erreichbar war, verfiel einer mehr oder weniger heimlichen Reproduktion, die aber immer farbig gedacht war. Auf diese Weise gab es viel zu tun. – Scheint es übertrieben, diesen Beschäftigungen eines Jünglings so viele Zeilen zu widmen? Man unterschätze nicht die Bedeutung dieser Jahre für den Künstler. Sie sind ganz erfüllt von einer frohen und naiven Vorbereitung und man kann behaupten, daß in ihnen nichts geschieht, was mit dem noch unformulierten Lebenswunsch und Lebensdrang des Menschen, der dabei reift, nicht im innigsten Einklang stünde. Ganz mit sich allein gelassen, arbeitet die Natur rastlos an der Erfüllung des noch unverratenen Planes. Ein fortwährendes Herbeitragen, Sammeln, Aufspeichern ist das Charakteristische dieser Jahre. Und die Auswahl geschieht noch ganz von selbst. Mit einer fast somnambulen Sicherheit greift[76] die Natur nach dem, was sie braucht und sie findet es immer unter hundert Dingen heraus.
Das verändert sich im Augenblick, da das Ziel ausgesprochen ist. Die tägliche, auf das Persönlichste zugeschnittene Selbsterziehung wird durch äußere Einflüsse ersetzt, die daneben fast zufällig scheinen. Die Natur wird gestört, ihre Sicherheit verschwindet und die Wege, die so breit und still vor einem lagen, füllen sich mit Menschen und Meinungen an, durch die man sich nicht durchzudrängen vermag.
Später, wenn man diese gefahrvolle Zeit überstanden hat, erkennt man deutlich, wie man mit Allem Eigenen wieder dort anknüpft, wo man einst unterbrochen worden ist. Man sieht zurück und bewundert die überlegene Weisheit jener dunklen Zeit, in der nichts umsonst geschah und alles für die Zukunft. Kleine Liebhabereien waren die Wurzeln einer großen Liebe. Es ist nichts verloren gegangen; und später erkennt man in jeder guten Frucht, die man bringt, eine Blüte wieder, die man damals trug.
Es genügt, kurz zu notieren, daß Otto Modersohn, neunzehn Jahr alt, Münster verließ und die Akademie in Düsseldorf bezog, wo er vier Jahre arbeitete. Daß er dort eine liebevolle Teilnahme bei Professor Dücker und Fritz Mackensens Freundschaft gewann und mit ihm und Alexander Hecking im Jahre 1888 nach München kam. In München sah er Böcklins »Meeresstille« und das kleine, schmeichelnd weiche Bild in der Schackgalerie lange an, ging aber dann für ein Jahr zu Professor Baisch nach Karlsruhe, wo er ebenso unbefriedigt[77] blieb wie früher in Düsseldorf. Das Resultat dieser letzten Jahre lautet, kurz zusammengefaßt: es muß anders werden. Und nun ist zu erzählen, wie es anders wurde, ganz anders.
Worpswede begann; es ist schon gesagt worden wie. Es war von jenem Herbst die Rede, da drei junge Maler auf einer Brücke standen und nicht Abschied nehmen konnten; von dem Winter, der da kam mit langen Abenden und Gesprächen und mit Büchern, die man fürs Leben lieb gewann; von dem anderen Winter in Hamburg und davon, daß keiner recht beginnen konnte. Auch für Otto Modersohn war es nicht leicht anzufangen. Wohl war ein Wunder geschehen. Eines von jenen Wundern, die geschehen müssen in jedem Künstlerleben, damit es sich ganz entfalten könne. Eine Sprache war ihm gegeben worden, eine eigene Sprache, wie Rossetti sie mit Elisabeth Ellinor Siddal empfing. Aber nun lag die eigentliche Arbeit erst vor ihm. Er fühlte es vielleicht in den ersten Wochen schon, daß hier in der seltsamen, geheimnisvoll reichen Natur Worpswedes seine Sprache auf ihn wartete, er begegnete auf seinen Wegen tausend Ausdrücken für tausend Erlebnisse seiner Seele und er erkannte sie auf den ersten Blick. Hier war ein Land, mit dessen Dingen er sich sagen konnte. Hier waren Morgen voll Hoffnung und Heiterkeit und Nächte voll Sterne und Stille. Tage brachen an, in denen Unruhe war, Wucht und Sturm und die Ungeduld junger Pferde vor dem Gewitter. Und wenn es Abend wurde, so war eine Herrlichkeit in allen Dingen, gleichsam ein flutendes[78] Überfließen, wie bei jenen Fontänen, bei denen eine jede Schale sich füllt, um sich rauschend in eine tiefere zu ergießen. Und immer wenn dieser Überschwang verklungen war, kam eine Stunde, die noch nicht Nacht war und nichtmehr Tag. Der Glanz war noch da, aber er blendete nicht mehr. Er lag still an die Dinge geschmiegt und schien aus ihren Poren auszuströmen in die lautlos dunkelnde Luft. Eigentümlich vereinfacht waren die Konturen der Bäume; alles Kleinliche war von ihnen genommen. Und die Nachtigall, die in ihnen zu schlagen begann, erhob ihre Stimme; und ihre Stimme ging über die Ebene hin, als ob es die Stimme eines großen Vogels wäre.
Erinnerungen stiegen auf. Erinnerungen an Kirchen und Gärten, Könige und Kinder von Königen. Hier war alles wiedergefunden, was einmal so lieb und nahe und wichtig war; und alles war hier an jeder Stelle. Man mußte nicht mehr von einem zum anderen gehen, von der Kirche in den Garten und vor die Stadt und in den Rathaussaal. Dieses Land hatte keine Historie gehabt. Aus langsam sich schließenden Sümpfen war es aufgewachsen, und die Leute, die sich, arm und elend, darin niederließen, hatten keine Geschichte. Und doch schien alle Vergangenheit und die Pracht aller Vergangenheit irgendwie darin enthalten zu sein. Als hätte man ein farbiges Zeitalter zerstampft und dann in die Sümpfe verrührt, aus denen diese Welt entstanden war. Der Boden war schwarzbraun, fast schwarz, aber er konnte sich dem Rot zuneigen oder dem Violett, einem Rot und einem Violett, wie es nur in alten[79] Brokaten gleich schwer und leuchtend zu finden war. Oft war er weithin mit Heide überzogen und das gab ihm eine rauhe Oberfläche, die bald stark farbig, bald verblichen schien und fleckig, hell und dunkel, wie ungleichmäßig aufgekämmter Sammet. Und neben der Heide stand in weiten Streifen ein weiches, wehendes Gras, blaß, blond, immer bewegt, und ohne Glanz. Im Herbst vor allem war es so. Die Birken standen da und konnten, gleich weiß verkleideten Heiligen, das Licht kaum unterdrücken, das in ihnen war. Ihre Stämme enthielten alles Weiß der Welt, nach geheimnisvollen Gesetzen geordnet. Da war das Weiß der Lilien, in dem immer etwas vom Mondschein schimmert, da war das schattige Weiß, wie es im menschlichen Auge ist, und das rötliche, gleichsam erregte Weiß mancher Rosenblätter. Da waren Weiße, die nie jemand gesehen hatte, und die man nicht nennen konnte; so besonders waren sie. Und wenn man zu Füßen der Birke nur ein wenig die Erde hob, so sah man Wurzeln, gekleidet in ein großes, rauschendes Rot, das Rot mächtiger Könige, das Rot Tizians und Veroneses. Und man hatte das Gefühl, als müßte man nur irgendwo die schwankende Kruste dieses Landes aufreißen, um die Farben aller Feste und den Glanz urweltlicher Sommertage an die hundert Wurzeln gebunden zu finden. Aber wenn man ein Stück weiter ging und an den Schiffgraben trat, in welchem regloses Wasser lag wie ein Spiegel aus dunkelblauem Stahl, da konnte man auch denken, daß unter Allem, unter Wiesen und Wegen und Hainen, derselbe gläserne[80] Abgrund stand, in den eine buntdunkle Welt schwer und hülflos hinunterhing.
Dieses Wunder war geschehen. Der Seele eines jungen Malers war dieser Wortschatz gegeben worden, damit sie sich sage. Aber bei den ersten Versuchen erwies es sich schon, daß es vor allem nötig war, diese Sprache zu erlernen, still und nüchtern zu erlernen mit dem Buche in der Hand, Gesetz für Gesetz. Wohl war die Sprache da, aber er beherrschte sie nicht. Wie eine Kette mit edlen Steinen lag sie vor ihm, aber er vermochte nicht, sie zu tragen. Und so ging er denn hinaus Tag für Tag in die Natur, schrieb ihre großen Worte nach und ihre kleinen, und ihre ganz kleinen Worte, streng, gewissenhaft, ohne auch nur an einer Silbe zu rühren. Das war Grammatik. Und langsam konnte man zur Syntax übergehen, im Winter. Da lagen in der niederen Stube Otto Modersohns Schmetterlinge, aufgeschlagen wie Bücher. Er las auf ihren Flügeln und in den Federn von Vögeln wie in einem Kompendium der Farbenlehre. Das waren keine trockenen Lehrbücher. Einfach und reich zugleich war ihr Stil, voll von Beispielen und Gleichnissen. Und dann sah er gepreßten Pflanzen zu, wenn sie vertrockneten. An Stelle der frischen Farben traten welke, stumpfe, Farben der Erinnerung statt der Farben des Lebens. Rot dunkelte fast zu Schwarz, Blau verblich wie an der Sonne und alle Grüns nahmen eine bräunliche, dauerhafte Färbung an, die sich nicht mehr veränderte. Aber trotz dieses Wechsels ging die Harmonie nicht verloren. Jeder Ton schien vom anderen zu wissen, und nach[81] dem Schwanken einiger Verwandlungen trat ein neues Gleichgewicht ein, ebenso eigentümlich, geheimnisvoll und reich wie die Melodie des Lebens war. Jahre vergingen so, ganz mit Lernstunden angefüllt, und wenn etwas diese Jahre verdüsterte, so war es die Ungeduld dessen, der sich danach sehnte, in der Sprache zu dichten, die er eben richtig zu schreiben begann. An manchen Stellen prägte sich auch, durch den herben Ernst des Lernenden hindurch, das linde Lächeln des Dichters ahnend aus. Es giebt eine Studie aus dem Jahre 1893, ein gewissenhaftes Diktat nach der Natur, das doch (man kann nicht sagen weshalb) wie ein Gedicht anmutet. Da sieht man eine kleine Wiesenschlucht, in der ein Rest Wasser steht, glanzlos hell. Weiden rings herum. Von der Höhe des Hanges, aus dem grauen, zerstreuten Licht, ist ein Mädchen heruntergekommen und steht nun vorgebeugt, nahe am Wasser. Ihre rote Jacke leuchtet, von der Dämmerung vertieft, aus dem gedämpften Silbergrün dieses stillen Bildes.
Aber es kommen auch wieder Zeiten der Zagheit und des Zweifels, Zeiten, wie sie jeder Lernende durchmacht, wo die Aufgabe unermeßlich scheint und kaum noch begonnen. Als Reaktion einer solchen Zeit sind jene acht Bilder zu betrachten, welche in München, im Glaspalast von 1895, so großes Aufsehen erregten. Sie zeigen nicht nur eine gewisse sichere Beherrschung der Sprache, es hat auch schon der Prozeß einer bestimmten Stilbildung seinen Anfang genommen, die nun von Bild zu Bild fortschreitet, zugleich mit einer[82] fast täglichen Erweiterung des Wortschatzes und der Fähigkeit, ihn immer unbewußter zu gebrauchen. Denn dieser weite, weite Weg mußte gegangen werden: durch das klare und starke Bewußtwerden jeder Silbe hindurch zum Wiedervergessen, das heißt zum unbewußten, naiven Gebrauchen der erworbenen Werte. Es wäre gewiß schwer für Modersohn nach Jahren so absichtsvoller Arbeit, jene unbewußten Wege wiederzufinden, auf denen seiner Kunst (wie jeder Dichterkunst) das Tiefste kommen muß. Vielen sind sie zugewachsen, während sie an der Natur hingen. Bei ihm aber kam von da, an jedem Abend fast, die Lust zu kleinen Blättern, zu Blättern, handgroß, die er, hingegeben an den Willen seines Stiftes, zeichnete, ohne daran zu denken, daß er es tat. In diese Zeichnungen strömte immerfort das Innerste, Intimste, das, was er in den Bildern noch nicht zu sagen wagte; in einer aus schwarz und rot geflochtenen Dämmerung lebt hier seine Welt, wie die Rose in der Knospe lebt, mit angehaltenem Atem, dunkel und gedrängt. Diese Blätter sind, gleichsam über alle Worte weg, aus dem Geiste jener Sprache gemacht, nach deren Besitz er rang und ringt. Wenn das andere ein redliches Gehen war, sind sie ein Flug und Schuß nach demselben Ziel. Je vollkommener und naiver aber der Ausdruck in seinen Bildern wird, desto mehr empfangen auch sie vom Geiste der Sprache, in der sie geschrieben sind, desto mehr nähern sie sich dem Wesen jener Blätter, wie sich die Menschen vielleicht, je reifer sie werden, immer mehr ihren Seelen nähern, bis sie endlich, an[83] einem Höhepunkte des Lebens, mit ihnen eines werden. So gehen auch hier zwei Wege einer seltsamen und, man kann sagen, selten schönen künstlerischen Entwickelung aufeinander zu, um, vielleicht sehr bald, ineinander zu fließen. Erst wenn eine solche Vereinigung erfolgt sein wird, wird man diesen Dichtermaler kennen, wie er jetzt schon im Dunkel jener kleinen Blätter, die sich nicht vervielfältigen lassen, lebt und wie seine besten Bilder ihn versprechen. Die Zahl dieser Bilder ist sehr groß. Aber man tut ihnen ein Leides, wenn man sie beschreiben will. Dieser Adept des Abends hat wundervolle Dämmerungen gemalt, Dämmerungen, die auf den Vließen der Schafe zittern, Dämmerungen, die sich im Wasser spiegeln, tiefe, stille Dämmerungen um irgend eine einsame Gestalt. Mit ein wenig Weiß stellt er manchmal ein Mädchen in seine Mondaufgänge, und man sieht sie stehen und schimmern, wie man Regine sieht in der kleinen verwandten Landschaft von Theodor Storm:
Und webte auch auf jenen Matten
Noch jene Mondesmärchenpracht,
Und stünd' sie noch in Waldesschatten
Inmitten jener Sommernacht;
Und fänd' ich selber wie im Traume
Den Weg zurück durch Moor und Feld,
Sie schritte doch vom Waldessaume
Niemals hinunter in die Welt.
Und doch genügte es nicht, ihn den Maler der Dämmerung zu nennen. Es giebt Abende von ihm, die wie auf Mahagoni gemalt sind, und Morgen, voll Frühling[84] und Frische, und schattige Tage mit weiten, sonnigen Fernen.
Er hat es auch selbst einmal gesagt: »Das Kräftigste, Leuchtendste, Üppigste, wie das Zarteste, Lindeste, Feinste, – das Düstere, Tiefe, Satte, wie das Lichte, Heitere: Rauschen und Säuseln, Gold und Silber, Sammet und Seide, alles, alles liegt mir am Herzen.«
Und alles das, was ihm am Herzen liegt, enthält die rätselhafte Natur dieses Landes. Das Starke und das Stille hat Ausdrücke in ihr, für »Rauschen und Säuseln, Gold und Silber, Sammet und Seide« giebt es viele, unvergleichlich klingende Namen. Und die Worte, die für das Starke sind, lassen sich immer noch steigern und steigern, bis sie das Stärkste bedeuten, das man ertragen kann, und das, was Stilles besagt, klingt, mit der Sordine genommen, stiller denn Stille. Kontraste sind da. Es kommen Zeiten in diesem Lande, wo die Winde nicht aufhören und so gewaltig sind, daß die Tage kaum Zeit haben zu sein; denn die Winde, die aus dem Westen gehen, reißen den Abend herbei, der unerwartet früh, wie ein Gewitter, über die Weiten stürzt. Und in der Nacht, wenn der Sturm zu Stürmen wird, die, so breit wie die Welt, über die Moore kommen, rollen, jagen und sich überschlagen, da können die in den Häusern meinen, das Meer sei wieder da und nehme sein altes Bereich brausend in Besitz. Und daneben giebt es Tage und Nächte, wie sie manchmal zwischen Bergen sind, beinahe starr vor Reglosigkeit, mit aufrecht stehender Luft und Wassern, ruhiger als Spiegel. Oder man geht über die Heide hin, die sich bunt und brach[85] stunden weit auszudehnen scheint, von gebückten Bäumen unterbrochen, deren Dasein in einsamer Vergessenheit vergeht. Und plötzlich heben, wie die Strophen eines Gedichts, Parkwege an, rhythmisch angelegt und mit einer gewissen graziösen Müßigkeit Halbkreise beschreibend zu dem nächsten Platze hin, statt gerade auf ihn zuzugehen. Man entdeckt Spuren einer vergangenen Gartenkunst an den Hecken, die wie Leute, welche in ihrer Jugend bei Hofe verkehrten, einen halbvergessenen Anstand zur Schau tragen, dessen sie sich gerne erinnern, man findet Stellen, wo einmal zierliche Brücken ihren Sprung über ungefährliche Bäche ausführten, und entlegene Orte, an welchen Altane gestanden haben mögen, verschwiegen, und von scheinbar absichtslosen Pfaden leise aufgespürt.
Oder es tut sich hinter einem Haus mit einem Mal unvermutet eine Weite auf, in der, groß und geräumig wie sie ist, Häuser und Bäume und Baumgruppen mit Verschwendung verteilt sind, so daß man dieser Ebene, deren Wege so endlos sind, keinen Namen zu geben wagt. Zeit und Zufall scheint von ihr abgetan und man glaubt die Länder der Erde zu sehen und den Schatten Gottvaters über stillen, weithin weidenden Herden.
Es ist nichts unmöglich in diesem Land. Und auch das Unwahrscheinliche empfängt von der Fülle der Himmel die Gegenständlichkeit und Wahrhaftigkeit wirklicher Dinge. Diese Himmel enden mit jenem Kreis, an dem die Gestirne sich halten und die Regen, ehe sie niederfallen; aber sie beginnen hier, unter uns. Sie[86] ruhen auf jedem Blatt, sie liegen auf den Haaren und in den Händen der Kinder, sie stützen sich nachdenklich auf alle Dinge.
So Mächtiges – Worte für fast Unsagbares – enthält dieses Land, die Sprache Otto Modersohns. Und es ist zu sehen, daß er sie immer mehr als Dichter gebraucht. Schon kennt er sie so genau, daß er zu wählen weiß unter ihren Werten; immer mehr strebt er danach, nur das Wichtige zu geben, das Große, das Tiefnotwendige. Dichtung ist Auswahl. Und wenn alles Wichtige da ist, dann bindet eines das andere mit der magnetischen Kraft der Massen und es fügt sich von selbst, das heißt nach seinen eigenen Gesetzen zu einer einheitlichen, nirgends offenen Form. Diese organisch erwachsene Form bringt zwei Wirkungen mit sich: Stille und Intimität nach innen, und nach außen hin jene volle dekorative Deutlichkeit, die das Bild erst zum Bilde macht. Das dekorative Element rechnet aber nicht nur mit der Form, es bedarf vor allem der Farbe. Wie breit dieser Maler das Wesen der Farbe faßt, ist schon geschildert worden. Was der Rembrandt-Deutsche gesagt hat, erkennt er an. Auch ihm gilt Huhn, Hering und Apfel für koloristischer als Papagei, Goldfisch und Orange. Aber es liegt für ihn keine Beschränkung darin, nur ein Unterschied. Nicht das Südliche will er malen, das seine Farbigkeit immer im Munde fuhrt und mit ihr prahlt. Dinge, die innerlich voller Farbe sind, das was er mit einem unübertrefflichen Worte »die geheimnisvolle Farbenandacht des Nordens« nennt, halt er für seine Aufgabe. Man wird[87] diese Aufgabe noch schätzen lernen und den nicht übersehen können, der sein Leben daran gesetzt hat, sie zu lösen. Es ist ein stiller, tiefer Mensch, der seine eigenen Märchen hat, seine eigene, deutsche, nordische Welt.[88]
|
Ausgewählte Ausgaben von
Worpswede
|
Buchempfehlung
Hoffmann, E. T. A.
Meister Floh. Ein Märchen in sieben Abenteuern zweier Freunde
Als einen humoristischen Autoren beschreibt sich E.T.A. Hoffmann in Verteidigung seines von den Zensurbehörden beschlagnahmten Manuskriptes, der »die Gebilde des wirklichen Lebens nur in der Abstraction des Humors wie in einem Spiegel auffassend reflectirt«. Es nützt nichts, die Episode um den Geheimen Hofrat Knarrpanti, in dem sich der preußische Polizeidirektor von Kamptz erkannt haben will, fällt der Zensur zum Opfer und erscheint erst 90 Jahre später. Das gegen ihn eingeleitete Disziplinarverfahren, der Jurist Hoffmann ist zu dieser Zeit Mitglied des Oberappellationssenates am Berliner Kammergericht, erlebt er nicht mehr. Er stirbt kurz nach Erscheinen der zensierten Fassung seines »Märchens in sieben Abenteuern«.
128 Seiten, 5.80 Euro
Im Buch blättern
Ansehen bei Amazon
Buchempfehlung
Geschichten aus dem Biedermeier III. Neun weitere Erzählungen
Biedermeier - das klingt in heutigen Ohren nach langweiligem Spießertum, nach geschmacklosen rosa Teetässchen in Wohnzimmern, die aussehen wie Puppenstuben und in denen es irgendwie nach »Omma« riecht. Zu Recht. Aber nicht nur. Biedermeier ist auch die Zeit einer zarten Literatur der Flucht ins Idyll, des Rückzuges ins private Glück und der Tugenden. Die Menschen im Europa nach Napoleon hatten die Nase voll von großen neuen Ideen, das aufstrebende Bürgertum forderte und entwickelte eine eigene Kunst und Kultur für sich, die unabhängig von feudaler Großmannssucht bestehen sollte. Für den dritten Band hat Michael Holzinger neun weitere Meistererzählungen aus dem Biedermeier zusammengefasst.
- Eduard Mörike Lucie Gelmeroth
- Annette von Droste-Hülshoff Westfälische Schilderungen
- Annette von Droste-Hülshoff Bei uns zulande auf dem Lande
- Berthold Auerbach Brosi und Moni
- Jeremias Gotthelf Die schwarze Spinne
- Friedrich Hebbel Anna
- Friedrich Hebbel Die Kuh
- Jeremias Gotthelf Barthli der Korber
- Berthold Auerbach Barfüßele
444 Seiten, 19.80 Euro
Ansehen bei Amazon
- ZenoServer 4.030.014
- Nutzungsbedingungen
- Datenschutzerklärung
- Impressum

![Worpswede: Fritz Mackensen, Otto Modersohn, Fritz Overbeck,Hans am Ende, Heinreich Vogeler [Reprint der Originalausgabe von 1905]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/31vGpoJs1kL._SL160_.jpg)