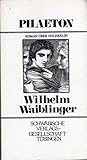|
Phaethon an Theodor
[226] Maß zu halten bei solcher Fülle, das war sonst mein Höchstes. Ich kann's nicht mehr!
Auch jene süße Bewegung des Herzens kenn' ich nicht mehr, wo es, so einig mit sich selbst, sich regt und wallt, wie die glühenden Feuerwellen des Meeres am Abend, so zart, so verschmolzen und doch so liebendeinig!
Ein kalter schauriger Frost durchwirbelt meine Seele, und wenn er einmal weicht, so ist's keine freundliche begeisternde Freude, die an seine Stelle tritt; es ist eine zuckende Wonne, ein verzehrendes Sehnen, das durch mein Inneres fährt und schnell verrauscht und der alten Nacht die Stelle wieder räumt.
Und beten? Warum kann ich nicht mehr beten? Sieh, da hatt' ich gestern meinen Knaben vor mir stehen, faßt ihn, hob ihn auf, drückt' ihn weinend an meinen Busen, küßte seine vollen unschuldigen Wangen und stammelte: Bete! Ach, und er betete, so klar, so innig, so harmlos, als kennt' er zu dem ihn, er[227] betete; als fühlt' er seine Nähe! Und mich! Wie er mich ansah! Ich ließ ihn sinken, als dürft' ich ihn nicht anhauchen, das reine gottbefreundete Wesen.
Theodor, wär' ich einmal frei, und hielte mich die Erde nicht an sich, die Erde, die ich nicht lieben kann, dann stürzt' ich in den leeren Raum, der sich ausdehnt zwischen den wandelnden Welten des Schöpfers; dann stürzt' ich ewig von einem Weltsystem ins andre, vorüber an allen Millionen Sonnen und Monden; begegnete den Kometen, die sich vor Jahrtausenden unsrer Erde näherten, die in Jahrtausenden noch kommen werden! Brüder, ewig, ewig würd' ich taumeln und fallen und kein Ufer, keinen Grund, keine Grenze finden. Immer tiefer und immer weiter und doch kein Ende! Jahrtausende stürzen durch das All, und doch kein Ende!
|
Ausgewählte Ausgaben von
Phaeton
|
- ZenoServer 4.030.014
- Nutzungsbedingungen
- Datenschutzerklärung
- Impressum