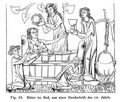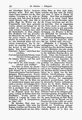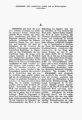Ortsnamen [Goetzinger-1885]
Ortsnamen. Unzweifelhaft gehören die Orts- wie die Personennamen unter die Altertümer; sie jedoch in ihrer geschichtlichen Entwicklung darzustellen, ist bis jetzt kaum möglich; für einzelne Gegenden ist es geschehen, namentlich für Hessen in dem Werke von W. Arnold , Ansiedelungen ...
Heerwesen [Goetzinger-1885]
Heerwesen. In ältester Zeit ist das Heer der Germanen nichts anderes als das Volk in Waffen. Glied des Staates war nach Tacitus, 13, wer die Waffen kannte. Zu kriegerischen Unternehmungen vereinigte sich entweder ein ganzes Volk oder ein Stamm, mit ...
Gaunertum [Goetzinger-1885]
Gaunertum. Das Wort Gauner taucht erst im 18. Jahrh. in der Form Jauner in Oberschwaben auf und wird bei norddeutschen Schriftstellern zu Gauner. Es stammt vom rotwelschen; im 15. und 16. Jahrhundert bedeutet der joner den Spieler, aus hebräisch jânâ ...
Erziehung [Goetzinger-1885]
Erziehung. Nach altgerm. Rechtsanschauung stand es in der Willkür des Vaters, ob er das neugeborene Kind überhaupt aufziehen lassen wollte; es stand ihm frei, es zu töten, auszusetzen oder zu verkaufen. Doch kam dies im westlichen Deutschland seltener vor als ...
Reliquien [Goetzinger-1885]
Reliquien der Heiligen als Gegenstände gläubiger Verehrung sind zur Zeit der Christenverfolgungen der ersten Jahrhunderte aufgekommen, anfangs unter teilweisem Widerspruch einzelner Kirchenlehrer; doch sprachen sich gerade die angesehensten Väter der Kirche, wie Chrysostomus, Hieronymus, Ambrosius und Augustinus, zu gunsten der ...
Du, Duzen [Goetzinger-1885]
Du, Duzen. Unter diesem Wort mögen einige Andeutungen über die Art der persönlichen Anrede in älterer Zeit Platz finden. Die gotische Sprache kennt wie die griechische und lateinische bloss die naturgemässe Anrede der Einzelperson in der Einzahl: hails thiudans! später ...
Postwesen [Goetzinger-1885]
Postwesen. Zwar war die öffentliche Staatspost des römischen Kaiserreiches, der cursus publicus , mit dem Reiche selber zu Grunde gegangen; doch hatten sich einzelne Spuren davon bis in die Karolingische Zeit erhalten; sogar einige alte technische Ausdrücke sind stehen geblieben: mansio ...
Artussage [Goetzinger-1885]
Artussage , der beliebteste und ausgebildetste Sagenkreis der höfischen Weltliteratur. Französisch sprechende anglo-normannische Dichter brachten den Stoff in England auf, wo sie ihn, von Quellen zweiten Ranges abgesehen, in einer lateinisch geschriebenen Chronik fanden, die Gottfried , Erzdiakon von Monmouth , um ...
Kanoniker [Goetzinger-1885]
Kanoniker hiess ursprünglich jeder Geistliche, der in den Kanon oder die Matrikel einer Kirche eingetragen und zu Einkünften daraus berechtigt war, zum Unterschiede von solchen Geistlichen, die nur an Kapellen fungierten. Schon zu Augustins Zeiten lebten viele Geistliche, ohne gerade ...
Friedhöfe [Goetzinger-1885]
Friedhöfe. ahd. frîthof , mhd. vrîthof = der zur Schonung und Sicherheit vor einem und um ein Gebäude eingefangene Raum, der Vorhof; dann erst Vorhof der Kirche als öffentlicher Schutzort geflüchteter Verbrecher, endlich schon im Althochdeutschen Kirchhof, Gottesacker. Das Wort frî t ...
Perrücken [Goetzinger-1885]
Perrücken waren schon in Rom in der späteren Kaiserzeit gebräuchlich; sie verschwinden jedoch – wenigstens im Abendlande – vom Schauplatze, bis sie im 15. Jahrhundert am burgundischen Hofe auftauchen. Das Bestreben, lange Haare zu tragen und diese durch Wickel, Brennen und Einölen ...
Badewesen [Goetzinger-1885]
Fig. 23. Ritter im Bad, aus einer Handschrift des 14. Jahrh. Badewesen. Schon die alten Germanen liebten das freie offene Bad in Flüssen und Seen, Tacit. Germ. 22, und es blieb durch das ganze Mittelalter bis gegen das 18. Jahrh ...
Kapuziner [Goetzinger-1885]
Kapuziner sind aus einer Verzweigung des Franziskanerordens hervorgegangen. Ihr Urheber ist Matthäus von Bassi im Herzogtum Urbino, der sich von einem Klosterbruder sagen liess, der heil. Franziskus habe eine andere Kapuze getragen, als bis dahin geglaubt und von den Franziskanern ...
Allegorie [Goetzinger-1885]
Allegorie , d.i. diejenige Darstellungsweise, die ein Objekt vermittelst eines ihm ähnlichen darstellt, hatte im Mittelalter eine sehr grosse Ausdehnung und Anwendung, sowohl in den bildenden Künsten als in der Poesie. Schon das Ceremoniell des christlichen Gottesdienstes, verschiedene Dogmen und ...
Bauhütten [Goetzinger-1885]
Bauhütten. Die frühern mittelalterlichen Bauten auf kirchlichem Gebiete gehen von Geistlichen aus, die erst mit der Zeit Laienhilfe, anfangs zu niedrigen Diensten, beizogen. Im 13. Jahrh., frühestens im 12., vereinigten sich, wie die andern Berufsleute, so auch die Maurer und ...
Karlssage [Goetzinger-1885]
Karlssage. Schon sehr früh bemächtigte sich die Sage der Gestalt Karls des Grossen, dessen ausserordentliche Kraft, Macht und Thätigkeit schon den Zeitgenossen als von übermenschlichem Ursprung erschienen. Man erkennt das unter andern aus den Aufzeichnungen, die der namenlose Mönch von ...
Grabmäler [Goetzinger-1885]
Grabmäler. Da es die ursprüngliche Bestimmung der Kirchen war, Grabstätten der Heiligen zu sein, konnte die Beerdigung anderer Personen im geweihten Raume folgerichtig nicht zugelassen werden. Dieser Grundsatz wurde aber früh durchbrochen, so dass schon im Anfang der romanischen Periode ...
Propheten [Goetzinger-1885]
Propheten kommen in der mittelalterlichen Kunst entweder, wo es sich um messianische Weissagungen handelt, vereinzelt mit anderen Personen des alten Testaments vor, z.B. mit Jakob, Moses, David, oder zusammen, namentlich die vier grossen Propheten mit Aposteln , Evangelisten , Engeln ...
Pfalzgraf [Goetzinger-1885]
Pfalzgraf , comes palatii , Graf des königlichen Palastes oder der königlichen Pfalz, ist schon unter den Merovingern dem Könige bei der Ausübung seiner höheren Gerichtsbarkeit zugeordnet. Unter Karl und seinen Nachfolgern hatte er die obere Leitung alles dessen, was mit der ...
Abenteuer [Goetzinger-1885]
Abenteuer , aus franz. die aventure , welches seinerseits von mittellat. adventura kommt. Dieses französische Wort, welches eine erfundene, wunderbare, den Geist der Romantik atmende Geschichte bezeichnete, verdrängte die früheren deutschen Namen sage, spel, maere, liet , und bedeutete nun auch im Deutschen ...
Buchempfehlung
Pascal, Blaise
Gedanken über die Religion
Als Blaise Pascal stirbt hinterlässt er rund 1000 ungeordnete Zettel, die er in den letzten Jahren vor seinem frühen Tode als Skizze für ein großes Werk zur Verteidigung des christlichen Glaubens angelegt hatte. In akribischer Feinarbeit wurde aus den nachgelassenen Fragmenten 1670 die sogenannte Port-Royal-Ausgabe, die 1710 erstmalig ins Deutsche übersetzt wurde. Diese Ausgabe folgt der Übersetzung von Karl Adolf Blech von 1840.
246 Seiten, 9.80 Euro
Im Buch blättern
Ansehen bei Amazon
Buchempfehlung
Geschichten aus dem Biedermeier III. Neun weitere Erzählungen
Biedermeier - das klingt in heutigen Ohren nach langweiligem Spießertum, nach geschmacklosen rosa Teetässchen in Wohnzimmern, die aussehen wie Puppenstuben und in denen es irgendwie nach »Omma« riecht. Zu Recht. Aber nicht nur. Biedermeier ist auch die Zeit einer zarten Literatur der Flucht ins Idyll, des Rückzuges ins private Glück und der Tugenden. Die Menschen im Europa nach Napoleon hatten die Nase voll von großen neuen Ideen, das aufstrebende Bürgertum forderte und entwickelte eine eigene Kunst und Kultur für sich, die unabhängig von feudaler Großmannssucht bestehen sollte. Für den dritten Band hat Michael Holzinger neun weitere Meistererzählungen aus dem Biedermeier zusammengefasst.
- Eduard Mörike Lucie Gelmeroth
- Annette von Droste-Hülshoff Westfälische Schilderungen
- Annette von Droste-Hülshoff Bei uns zulande auf dem Lande
- Berthold Auerbach Brosi und Moni
- Jeremias Gotthelf Die schwarze Spinne
- Friedrich Hebbel Anna
- Friedrich Hebbel Die Kuh
- Jeremias Gotthelf Barthli der Korber
- Berthold Auerbach Barfüßele
444 Seiten, 19.80 Euro
Ansehen bei Amazon
- ZenoServer 4.030.014
- Nutzungsbedingungen
- Datenschutzerklärung
- Impressum