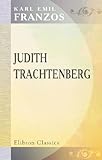|
Siebentes Kapitel
[266] Rafael war von dem traurigen Gange heimgekehrt, wie er ihn angetreten: bleich, starr und aufrecht. Es war unter allen Bewohnern des Städtchens nur eine Stimme des Mitleids für ihn, nun trat die Bewunderung hinzu: auch jetzt noch achtete er nicht seines Schmerzes, nicht seiner Erschöpfung, sondern der Not anderer. Er ließ all die Armen, denen sein Vater ein Helfer gewesen, zu sich entbieten und sagte ihnen, daß sich nur der Geber gewandelt, nicht die Gabe. Und gegen niemand unter diesen Demütigen und Beladenen war er dabei freundlicher und barmherziger als gegen jene Greisin, welche mit bangerem Herzen vor ihn hingetreten als die anderen, die Miriam Gold, deren Tochter Christin geworden. »Zittert nicht, Miriam«, sagte er ihr, »solcher Schimpf kann auch unschuldig treffen!«
Es war auch sein eigener Trost in den ersten Stunden rasenden Schmerzes, dem er sich nun, nachdem er die frommen Pflichten erfüllt, hingeben durfte. Dann freilich, in der Nacht, während er einsam, in einen Winkel des Sterbezimmers hingekauert, die Totenwacht hielt und in den blassen Schein des Seelenlichts starrte, mußte er daran denken, wie sich alles gefügt, und jener Mahnungen, die er selbst vergeblich an den Vater gerichtet. Waren auch wir nicht ganz ohne Schuld? – nichts tat ihm weher als dieser Zweifel. Aber er vermochte ihn wieder zu besiegen, wenn er sich das Unerhörte der Schmach zurückrief, mit welcher sich die Schwester befleckt; die niedrigste Magd des Ghetto, dachte er knirschend, wahrt ihre Ehre und würde lieber sterben als sie preisgeben – und sie, des besten Mannes Tochter, hat dies vermocht! – Nein, sie verdiente seine Verachtung, und wenn er bangen Herzens dem Morgen entgegenharrte, wo der Notar das Testament eröffnen sollte, so geschah es nur deshalb, weil er befürchtete, der Sterbende könne ihn darin vielleicht zur Milde gegen die Entartete gemahnt haben.
Die Besorgnis war grundlos. Das Dokument, nach den Wünschen, welche Nathaniel mit erlahmender Hand aufgezeichnet, vom Notar verfaßt, erwähnte Judiths nur, soweit es das Gesetz gebot: es war ihr das Pflichtteil am Erbe zugewiesen.[266] Für Rafael enthielt es Worte des Segens; seiner eigenen Entscheidung war überlassen, ob er die Fabrik übernehmen oder seine Studien fortsetzen wollte; nur um eines bat der Vater: jene Aufgabe zu fördern, die er dem Anwalt Rosenberg anvertraut. Aber auch dabei handelte es sich nur um den Kommissär, nicht um Judith oder den Grafen. »Ein solcher Mensch darf nicht länger Richter sein«, das war alles.
Rafaels Entschluß war rasch gefaßt. Er wolle im Lande bleiben, erklärte er seinen Vormündern, seines Vaters Arbeit fortsetzen und nach seinem Vorbild leben. Nachdem die erste Trauerwoche vorüber war, übernahm er die Leitung der Fabrik; was ihm an Jahren abging, schien er durch Ernst und Eifer ersetzen zu wollen. Auch für Judith hatte das Kreisamt einen Vormund bestellt, den Bürgermeister; allzuviel Mühe machte dies Amt dem Wackeren nicht; nachdem er ihr unter Adresse des Grafen eine Abschrift gesendet, legte er das Geld fruchtbringend an. Die nächste Zeit verging, ohne auch nur eine Antwort von ihr zu bringen. Das wunderte niemand; man wußte, daß sie mit dem Grafen irgendwo im Ausland verweile. Wo, wußte keiner, auch Rafael nicht. Er aber war auch der einzige Mensch im Städtchen, der niemals ihren Namen nannte.
Woche um Woche verstrich; der Winter brach ein und begrub Heide und Städtchen unter der Schneelast; bald sprachen auch die anderen seltener von der schönen Sünderin, die ihrem Vater das Herz gebrochen und nun mit dem Galan unter südlichem Himmel in tausend Freuden lebte. Ein anderer Gesprächsstoff tauchte auf: der Sturz des Kommissärs. Zuerst flüsterte man sich's leise ins Ohr, daß er nicht mehr so fest stehe wie früher, dann sprach man lauter davon, daß Rosenberg eine Untersuchung gegen ihn durchgesetzt, und endlich kam der Februartag, wo alt und jung auf der Straße war, um die Kommission, einen Rat des Kreisamts und seinen Schreiber, einziehen zu sehen. Alle Welt fand dies natürlich; »es hat ja gar nicht anders kommen können!« riefen die Leute einander zu und jubelten.
Da irrten sie; es war ein Erfolg, der kaum zu erwarten gewesen. Daß die Vorsteher auf Rafaels Bitte jeden Ausbruch der Erregung gegen den Kommissär verhindert, so daß niemand in der Gemeinde sich auch nur durch ein unziemliches Wort gegen[267] ihn verging, war nur der erste schwache Schritt zu diesem Ziele gewesen. Auch jene Beweise, welche der Sterbende, dann sein Sohn gegen den feilen Mann gesammelt, hatten viel, aber nicht alles bewirkt. Denn wohl waren die Räte des Lemberger Guberniums aufmerksam geworden und lasen diese Anklagen eifriger als die früheren, aber im Kollegium saß ja auch als hochgeschätztes Mitglied der zärtliche Oheim der Frau Anna. und da dieser versicherte, daß alles erlogen sei, so wäre ein Widerspruch seitens der anderen Herren eine arge Unhöflichkeit gewesen. Und die hohen Beamten im vormärzlichen Österreich waren gegen ihresgleichen immer höflich. Damals gab auch Rosenberg die Hoffnung auf und konnte auf Rafaels verzweifelten Ausruf: »Wie kann eine Staatsordnung bestehen, wo solches möglich ist?!« nur eben erwidern: »Sie besteht aber auch nur diesen Umständen angemessen!« Da erkrankte jener Oheim und mußte einen längeren Urlaub nehmen; das allein hätte noch nicht gefruchtet, aber die Ärzte meinten auch, daß er nie wieder ins Amt zurückkehren werde, und daraufhin kam den Herren die Überzeugung, daß solcher Frevel nicht länger währen dürfe. Die Untersuchung wurde angeordnet, und damit stand auch ihr Ergebnis fest: die Absetzung und Bestrafung des Schuldigen. Denn ein Beamter, der bloß die Absetzung verdiente, kam damals in Österreich nie in Untersuchung; die Gerichte hätten sonst zu angestrengt zu tun gehabt, und der freien Stellen wären zu viele geworden.
Das wußte auch Herr von Wroblewski. Er hatte die ersten Monate in stetem Schwanken zwischen Furcht und Hoffnung zugebracht, der Furcht vor dem Toten und dem bleichen, düsteren Jüngling und der Hoffnung auf die Höflichkeit der Lemberger Räte. Dann war wieder eine Zeit gekommen, wo er sich unbefangen der Geldscheine freuen konnte, die ihm der Güterdirektor des Grafen allmonatlich ins Haus brachte; die meisten behielt er, einige wenige schickte er nach Rußland – »Herrn Anton Brodski in Mogilew« stand auf der Adresse, und innen: »Hier, Herr Trudka, das Geld, welches mir der Graf für Sie überschickt hat. Ich hoffe, Sie werden zufrieden sein, denn wären Sie es nicht, so würde Ihnen dies auch nichts nützen; wir fürchten Sie nicht!« So oder ähnlich, häufig gröber, zuweilen[268] sanfter, je nach der Größe der Sendung. Im übrigen aber – die dummen Juden sollen sich umsonst gefreut haben! dachte er. Als er jedoch die Nachricht von der Untersuchung erhielt, brach er zusammen. Nun war alles entschieden, jeder Kampf nutzlos; er hatte ja seit zwei Jahrzehnten Zeit gehabt, sich genau darüber zu unterrichten, welchen Verlauf solche Dinge nahmen. Das Amt war verloren, nun galt es nur noch einen Versuch, der Strafe zu entrinnen.
Mit dem Stolz des gekränkten Ehrenmannes trat er dem Richter entgegen und überreichte sein Gesuch um Entlassung. »Die Untersuchung wird meine Unschuld erweisen«, sagte er, »aber ich lasse mich nicht ungestraft durch Mißtrauen kränken. Ich bin dies meiner Würde, der Würde meines Standes und jener meiner Kollegen schuldig, die ebenso pflichteifrig gehandelt wie ich; ich darf dies mit voller Bestimmtheit sagen, denn ich kenne ihre Amtsführung.« Und er nannte eine Reihe dieser Kollegen, einer übler beleumdet als der andere.
Der Rat horchte hoch auf, da drohte ein unermeßlicher Skandal. Er begann die Untersuchung, berichtete jedoch gleichzeitig nach Lemberg. Die Herren überlegten; der Schurke war unschädlich gemacht, ob er nun vom Staate eine Pension oder einige Jahre Versorgung im Zuchthaus erhielt, schien ihnen nicht wesentlich; auch der Kostenpunkt war fast gleichgültig, denn diese letztere Versorgung verschaffte er dann gewiß auch einer Reihe von Kollegen. Und da zudem sein Gönner noch lebte, so wurde nach zwei Monaten die Untersuchung eingestellt, Herr von Wroblewski pensioniert.
Das Ergebnis befriedigte niemand; am schwersten traf es Rafael. Der Mann war nun nicht mehr Richter, aber seinem verdienten Los war er entgangen. »Weil er fast nur gegen Juden gefrevelt hat!« klagte der Jüngling, und diese Erfahrung verbitterte ihn noch mehr. Hingegen fand sich Wroblewski, nachdem der erste Ärger überwunden war, leicht in sein Los. Allerdings begegneten ihm die Honoratioren des Städtchens und die Edelleute der Umgebung nur sehr kühl, aber das ließ sich mit einiger Philosophie ertragen, besonders da es noch immer liebenswürdige Menschen genug gab, welche seine und seiner Gattin gesellige Talente zu schätzen wußten. Auch war er nun das langweilige[269] Amt los, und die Sporteln konnte er leicht verschmerzen, da ja ein kurzer Brief an den Grafen genügte, ihm jede beliebige Summe zu schaffen. Agenor antwortete nie, Wroblewski hatte in all den Monaten auch nicht eine Zeile von ihm erhalten und wußte sowenig wie die anderen, wo das Liebespaar weilte, aber der Güterdirektor, Herr Michael Stiegle, ein schweigsamer, bärbeißiger Schwabe, beförderte die Briefe pünktlich und brachte dann die Antwort in einer Form, welche das Herz des Exkommissärs mehr erfreute, als es der zärtlichste Brief vermocht hätte. Allerdings schnitt Herr Stiegle dabei eine verdrießliche Miene, und als Herr Wroblewski, nachdem ihm Rafael die Wohnung gekündigt, einen Flügel des Schlosses eingeräumt wünschte, da schien er sogar unhöflich werden zu wollen. Aber ein Brief an den Grafen brachte auch diesem Wunsche die Erfüllung. Kurz, eigentlich lebte er nun so vergnüglich wie früher, ja noch lustiger und sorgenloser.
Auch die Briefe aus Rußland störten ihm die gute Laune nicht, und je mehr Drohungen darin standen, desto behaglicher las er sie. »Wer alles heutzutage auch ein Schurke sein möchte«, sagte er sehr verächtlich. »So dumm und will ein Schurke sein!« In der Tat, was wollte dieser Ignaz Trudka? Von den dreihundert Gulden, die der Graf für ihn monatlich gab, bekam er hundert, ein Sümmchen, mit dem sich in Mogilew gut leben ließ; es war eigentlich eine Frechheit, daß er den vollen Betrag forderte und sich auf das mündliche Versprechen Agenors berief. »Der Graf gibt eben nicht mehr«, hatte ihm Wroblewski wiederholt geschrieben, »er weiß ja, daß Sie sich in Ihrem eigenen Interesse wohl hüten werden, ihn zu verraten oder nach Österreich zurückzukehren« – und der freche Mensch gab sich mit dieser Beruhigung nicht zufrieden! »Ich werde euch beide zugrunde richten und mich selbst!« schrieb er immer wieder – es war zu komisch!
So verstrichen dem ehemaligen Beamten in ehrbarer Muße die Tage, und da weder der Prior noch der Rittmeister zu jenen engherzigen Menschen gehörten, die an der Untersuchung und ihren Folgen irgendwelchen Anstoß genommen, so war auch Frau Anna wohl zufrieden. Das Ehepaar beneidete wahrlich seine Nachfolger nicht, welche auch ihre Wohnung bei Trachtenberg[270] gemietet, Herrn Kreiskommissär Groza und Frau, bürgerliches Pack, arme Schlucker; der neue Richter lebte mit Weib und Kindern wirklich und wahrhaftig nur von seinem Gehalt. Ein Puritaner, der Mensch zahlte sogar seine Miete! Da war doch wahrlich die Wohnung im Schlosse nicht bloß billiger, sondern auch angenehmer. Der prächtige Park vor den Fenstern, in dem nun obendrein wieder niemals ein Jude zu sehen war! Denn eine der ersten Taten Wroblewskis nach seiner Übersiedlung war es gewesen, jene Tafel am Eingang wieder aufrichten zu lassen. Der plumpe Stiegle hatte sich freilich auch dagegen gesträubt, vermutlich sogar dieser Kleinigkeit wegen beim Grafen angefragt, nachgegeben hatte er schließlich doch. Herrn von Wroblewski schienen die Blumen im Lenze stärker zu duften, die Laubengänge im Sommer kühleren Schatten zu gewähren, seit die Tafel an ihrem alten Platze dastand.
Der Sommer verging, der Tag jenes feierlichen Einzugs des Grafen jährte sich und wurde durch eine Messe in der Patronatskirche festlich begangen; auch beteilte Herr Stiegle in des Grafen Auftrag die Armen des Städtchens, aber wo der Geber weilte, wußte noch immer niemand. Ein Edelmann aus der Nachbarschaft wollte das junge Paar in Verona gesehen haben, an höchst romantischer Stätte, in jenem Garten, wo das Grab Julias gezeigt wird, und versicherte, die beiden hätten ganz verklärt dreingesehen, und der Lohndiener hätte Judith Frau Gräfin genannt. Aber der Mann galt als Lügner, und wenn er diesmal zufällig die Wahrheit sprach, so hatte sich eben der Lohndiener geirrt; daß Graf Agenor die Jüdin geheiratet, glaubte niemand. Und gegen Ende November jährte sich ein anderer Tag, welcher den Bewohnern des Städtchens unauslöschlich in Erinnerung geblieben. Am Morgen konnte die alte Synagoge die Zahl der Beter nicht fassen, welche gekommen waren, die Totenfeier für Nathaniel, seine Jahrzeit zu begehen; dann strömte alt und jung zum »guten Orte«, sie horchten bewegt dem Gebet, welches Rafael am Grabe sprach; »Amen! Amen!« scholl es schluchzend wie ein hundertfaches Echo. Dann betrachteten sie den schönen Denkstein, den Rafael hatte aufrichten lassen, und sprachen die Worte nach, die da, statt aller Lobsprüche, welche die anderen Grabtafeln zierten, eingemeißelt[271] standen: »Das Andenken des Gerechten erlischt nimmer.« Zwischen diesem Grabe und jenem der früh verstorbenen Gattin Nathaniels war ein leerer Raum; Unkraut bedeckte die schmale Stätte, dorniges Gesträuch streckte seine kahlen Zweige darüber hin. Wenige, nur die Vorsteher und die Leute der Begräbnisbrüderschaft, wußten, daß auch dieser Boden vor nun einem Jahre zu nächtlicher Stunde aufgewühlt worden und was sie darein gebettet; die anderen ahnten es bloß, aber niemand fragte, und von all den Hunderten nannte keiner Judiths Namen, solange sie auf dem »guten Ort« verweilten. Das Andenken des Gerechten erlischt nimmer, aber wer in Sünden dahingestorben, »dessen Name soll nie genannt werden«. Sie war tot; am »guten Ort« spricht man nur von jenen Toten, die man rühmen darf. Erst als sie jenes Gitter durchschritten, welches die Welt des Friedens von jener des Kampfes trennt, fluchten sie der Entarteten. Nur einer schwieg auch nun, Rafael. Stumm schritt er neben den Vorstehern einher, die Gestalt aufrecht, das Antlitz düster und unbewegt, wie sie ihn all die Tage gesehen; seit seiner Heimkehr hatte niemand ein Lächeln auf seinen Lippen, aber auch keine Träne an seinen Wimpern gewahrt. Nur als der Zug am Schlosse der Baranowski vorbeikam, zuckte es um seinen Mund, und in dem Blick, den er auf das weiße Gemäuer richtete, das im Glanz der Spätherbstsonne so stattlich inmitten des entlaubten Parks dalag, loderte die Glut ohnmächtigen, unversöhnlichen Hasses.
Vielleicht wäre es dem qualvollen Grimm, in welchem er sich verzehrte, zur Labe gewesen, wenn er geahnt hätte, was sich zur selben Stunde in einem der Zimmer da oben zutrug, im Arbeitszimmer des Güterdirektors. Da saß Herr Michael Stiegle seit dem Morgen an seinem Schreibtisch und rechnete, schüttelte den Kopf und rechnete wieder, brummte vor sich hin und rechnete abermals. Dann starrte er lange in die Luft und faßte sich endlich ein Herz und schrieb einen kurzen, klaren Brief an den Grafen. Das Programm bei seinem Eintreten in Hochdero Dienste habe gelautet: Sparsamkeit und gute Wirtschaft, um die Schulden abzuschütteln, mit welchen der hochselige Herr die Allodialgüter überlastet. Nun habe sich in diesem ersten Jahr der Reinertrag nach Abzug der Zinsen für die Gläubiger auf[272] zwölftausend Gulden gestellt, der Bedarf aber auf das Zehnfache, und diese neuen Anleihen seien nur zu sehr harten Bedingungen möglich geworden. Ob der Herr Graf den Verbrauch nicht etwas einengen und vor allem, ob er nicht selbst einmal nach dem Rechten sehen wolle. Sonst könne er, Michael Stiegle, nicht auf seinem Posten bleiben, auf die Landwirtschaft glaube er sich zu verstehen, auf den Verkehr mit den Wucherern nicht. Dann schrieb er die Adresse: »An das Bankhaus M. L. Biedermann & Komp. in Wien für Herrn Grafen Agenor Baranowski«. Denn wo Agenor verweilte, wußte auch er nicht. Und das drückte Herrn Stiegle; ihn drückte vieles an diesen unklaren Verhältnissen.
Vielleicht lag es an dieser Stimmung, daß er die Meldung des Dieners, draußen harre ein Kapuziner und lasse sich nicht abweisen, unwirscher aufnahm, als sonst seine Art war, auch den gebückten Greis mit langem, weißem Bart, der sich nun schüchtern ins Zimmer schob, derb anfuhr. Doch mochte ihn auch das Anliegen des Bettelmönchs ärgerlich stimmen; derselbe bat um die Adresse des Grafen Baranowski. »Geht Sie nichts an!« brummte er.
Der Mönch trat näher. »Es ist sehr dringlich«, flehte er mit zitternder Stimme, »bei Gott und allen Heiligen – sehr dringlich!«
»Dann schreiben Sie, und ich will diesen Brief befördern.«
Der Mönch schüttelte den Kopf und trat noch einen Schritt vor. Vielleicht könne ihm schon der Herr Direktor helfen. Es handle sich um seinen Vetter in Rußland, einen armen Menschen namens Ignaz Trudka, der Herr Graf habe demselben für wichtige Dienste bei Herrn von Wroblewski ein Gehalt monatlicher dreihundert Gulden angewiesen; der Herr Kommissär schicke aber kaum ein Drittel und auch dieses unpünktlich. Ob der Herr Direktor nicht den Betrag direkt auszahlen könne? Und während er so sprach, spähte er nach den Papieren auf dem Tisch und las die Adresse des Briefes, der dalag.
»Nein!« erwiderte Herr Stiegle. »Weiß nichts von der Sache. Müssen sich an Wroblewski wenden. Adieu!«
Der Mönch stand noch einen Augenblick unschlüssig, dann verließ er gesenkten Hauptes, mit frommem Gruß, die Stube.[273] Auf dem Korridor zog er sein Gebetbuch hervor und schrieb hastig eine Notiz ein. Dann begab er sich zu Wroblewski. Als er vor diesem stand, schien er plötzlich alles Gebrechen des Alters abgeschüttelt zu haben. Aufrecht stand er da, und auch seine Stimme klang fest, als er sagte: »Sie brauchen nicht zu erschrecken, Herr Kommissär, ich bin nur gekommen, mündlich abzurechnen, da es schriftlich schwer geht.«
Herr von Wroblewski erbleichte; in der nächsten Sekunde hatte er seine Fassung wiedergewonnen. »Warum sollt ich erschrecken?« sagte er lachend. »Es ist ja Ihr Hals, den Sie riskieren! Abzurechnen haben wir nicht; was der Graf für Sie bestimmt, übersende ich Ihnen. Für den November ist eben nichts gekommen.«
»Jedes Wort eine Lüge«, erwiderte der andere. »Mein Geld, oder ich schreibe an den Grafen.«
»Warum sollten Sie das nicht tun?« war die Antwort. »Die Adresse kenne ich nicht, sonst würde ich sie Ihnen sagen, aber Herr Stiegle befördert die Briefe. Überlegen Sie jedoch, ob der Graf Ihnen mehr glauben wird als mir. Sie werden ihm meine Briefe einsenden? Aber, guter Trudka, steht denn in diesen Briefen eine Summe?«
Der Besucher schwieg; das schien ihm einzuleuchten. Dann aber brach er wild los und drohte mit der Anzeige bei dem Gericht; ihm sei angenehmer, hier im Kerker satt zu werden, als in Mogilew zu verhungern. Und über den Verlust der Freiheit werde ihn die gute Gesellschaft trösten.
Herr von Wroblewski hörte ihn lächelnd an. »Bon!« sagte er. »Tun Sie, was Sie nicht lassen können. Aber nun hören Sie mein letztes Wort. Hier« – er zog seine Brieftasche – »sind zweihundert Gulden. Ich lege sie in dies Kuvert. Und auf dies Kuvert schreibe ich – sehen Sie, lieber Trudka? –: Herrn Anton Brodski in Mogilew. Mit diesem Brief geht mein Diener zur Post, und Sie begleiten ihn. Hier sind außerdem zwanzig Gulden zur Heimreise. Und nun klingle ich dem Diener – auf alle Fälle: entweder, damit er mit Ihnen zur Post geht, oder damit er Sie hinauswirft!«
Als Herr von Wroblewski einige Minuten später aus einem Fenster den Bettelmönch mit dem Diener friedfertig dem[274] Städtchen zuwandeln sah, mußte er laut auflachen: »Da eilt er nun auf Flügeln der Sehnsucht nach Mogilew!« Vielleicht wäre er minder heiter gewesen, hätte er geahnt, welche Gedanken das Hirn des betrogenen Gauners erfüllten.
|
Ausgewählte Ausgaben von
Judith Trachtenberg
|
Buchempfehlung
Aristophanes
Die Vögel. (Orinthes)
Zwei weise Athener sind die Streitsucht in ihrer Stadt leid und wollen sich von einem Wiedehopf den Weg in die Emigration zu einem friedlichen Ort weisen lassen, doch keiner der Vorschläge findet ihr Gefallen. So entsteht die Idee eines Vogelstaates zwischen der Menschenwelt und dem Reich der Götter. Uraufgeführt während der Dionysien des Jahres 414 v. Chr. gelten »Die Vögel« aufgrund ihrer Geschlossenheit und der konsequenten Konzentration auf das Motiv der Suche nach einer besseren als dieser Welt als das kompositorisch herausragende Werk des attischen Komikers. »Eulen nach Athen tragen« und »Wolkenkuckucksheim« sind heute noch geläufige Redewendungen aus Aristophanes' Vögeln.
78 Seiten, 4.80 Euro
Im Buch blättern
Ansehen bei Amazon
Buchempfehlung
Romantische Geschichten II. Zehn Erzählungen
Romantik! Das ist auch – aber eben nicht nur – eine Epoche. Wenn wir heute etwas romantisch finden oder nennen, schwingt darin die Sehnsucht und die Leidenschaft der jungen Autoren, die seit dem Ausklang des 18. Jahrhundert ihre Gefühlswelt gegen die von der Aufklärung geforderte Vernunft verteidigt haben. So sind vor 200 Jahren wundervolle Erzählungen entstanden. Sie handeln von der Suche nach einer verlorengegangenen Welt des Wunderbaren, sind melancholisch oder mythisch oder märchenhaft, jedenfalls aber romantisch - damals wie heute. Michael Holzinger hat für den zweiten Band eine weitere Sammlung von zehn romantischen Meistererzählungen zusammengestellt.
- Novalis Die Lehrlinge zu Sais
- Adelbert von Chamisso Adelberts Fabel
- Jean Paul Des Feldpredigers Schmelzle Reise nach Flätz
- Clemens Brentano Aus der Chronika eines fahrenden Schülers
- Friedrich de la Motte Fouqué Eine Geschichte vom Galgenmännlein
- E. T. A. Hoffmann Der goldne Topf
- Joseph von Eichendorff Das Marmorbild
- Ludwig Achim von Arnim Die Majoratsherren
- Ludwig Tieck Die Gemälde
- Wilhelm Hauff Die Bettlerin vom Pont des Arts
428 Seiten, 16.80 Euro
Ansehen bei Amazon
- ZenoServer 4.030.014
- Nutzungsbedingungen
- Datenschutzerklärung
- Impressum