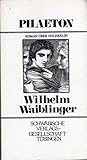|
Phaethon an Atalanta
[211] Nach Dir verlangt es mich, Himmlische! Wenn ich die Augen öffne des Morgens, fühl' ich Deine warmen Lippen im rosigen weichwallenden Morgenrot, und wenn die Nacht kommt, sehe ich Dein Bild durch das Dunkel wie ein lichtvolles Wesen heranschweben zu mir, mich anlächeln. Ich glaube Deinen Kuß zu fühlen und den Druck Deiner Hände und schlummere dann so hinüber! Dann erscheinst Du mir im Traume, ganz wie Du warst, wie Du bist, mit Deinem Angesicht voll Engelsliebe, voll Glauben und Hoffnung. Du streust Blumen auf mich herab, zarte jugendliche Blumen aus Deinem Schoße. Dann blickst Du zum Himmel und gehst wieder von mir.
Du Angebetete, warum bin ich ferne von Dir? Gerade jetzt ferne von Dir? Warum kann ich mein Herz nicht an Deinen Busen legen, Du Zarte, Liebende?
Ein Schmerz füllt meine Seele, und doch lebe ich nur in diesem Schmerz.
Ich kann's nicht nennen mit einem Namen, das Gefühl, mit dem Du meinen Busen füllst. Wo ich[212] fallen will, da glänzt es mir wie ein Licht durch die Finsternis, reinigt mich, läutert mich, gibt mir das vollste erhabenste Bewußtsein meines Selbst, vergeistigt mich, hebt mich auf zum Urbild der Menschheit, zu Gott! Ist es Ehrfurcht, Liebe, Freundschaft, anbetende Neigung?
Dich sehen, Dich lieben war eins. Ich lebte nicht vordem. Ich war nicht. Ich träumte nur zu sein.
Alles ist mir anders in der Natur geworden. Ich bin nicht mehr ihr Kind. Ich bin im Kampfe mit ihr.
Oft wenn ich die Sonne hinabgehen sehe, und alles glüht der Scheidenden und wallt in ihrem unsterblichen Licht, da stürzen mir die Tränen aus den Augen, und ich rufe: Hinab! Hinab! Und wenn des Nachts der Mond am Himmel ist, dann wandl' ich hinaus allein ins Freie. Das magische Licht und die riesigen Schatten, das Zusammenschwimmen der Bilder und Gestalten im Duft, die zitternden funkelnden Wellen im Lichtregen, das geheime tiefe Rauschen und Wogen durch Blätter und Äste, der Mond über den alten Eichenkronen schwebend, der hohe feierliche Geist über der Gegend wallend, die Ruh und Bewegung, die Kinder seines Hauches, das Licht im Wasser, und das Leben und Regen in den Pflanzen ...
Und dann die Welten, wie sie wandeln in ihrem Riesengange, zusammenschwimmen wie bleiche Milch, wie unaussprechliche zerfließende Regungen unserer Sehnsucht! Ein blasser Nebel die unendlichen Körper der Schöpfung, dämmernd wie Träume von Blumen, in ewigem unveränderlichem[213] Schwung, alle, alle! Schneller als Gedanken, geworfen und geschleudert aus der Hand des ordnenden allwaltenden Geistes, Kinder der Unermeßlichen, diese Fülle, diese Größe und doch diese Ordnung!
Atalanta, da weiß ich mich nicht zu fassen. Ich verliere mich selbst. Ich kann die Ordnung der Welten nicht begreifen. Sie wirbeln untereinander, Millionen und wieder Millionen Sonnen. Ich höre das Sausen und Dröhnen ihres Schwunges, das Donnern ihres Zusammenstoßens. Alle wanken und zittern, erlöschen, zertrümmern sich. Alles, alles im Wirbel. Alles aus Schranken und Fugen. Die ganze Schöpfung ein Klang, ein Krachen, ein Knattern, über mir, unter mir!
Wo bin ich, Atalanta, Du Überschwängliche? Ich bin nicht mehr. Ich fühle nicht mehr. Aus, aus! Die Schöpfung, das Dasein aus! Das All ein Nichts!
|
Ausgewählte Ausgaben von
Phaeton
|
- ZenoServer 4.030.014
- Nutzungsbedingungen
- Datenschutzerklärung
- Impressum