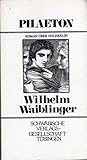|
Phaethon an Theodor
[207] Ich bin so empfindlich, so verletzbar! Das macht mich unglücklich unter den Menschen. Wohin ich mich bewege, stoß' ich an, und das schmerzt und wird nach und nach zu einer großen, vielleicht unheilbaren Wunde.
Ich weiß nicht, ist's meine Schuld oder der Menschen? Jeder nimmt mich nur teilweise, nimmt mich nicht ganz. Darum bin ich jedem ein anderer und keinem der wahre, der ganze.
Ich würde verzweifeln in dieser Zeit; aber ein unendlich seltsames Etwas fühl' ich quillen aus dem Tiefinnersten, aus dem Geiste selbst, aus dem Mittelpunkte meines Wesens, und gründen und bilden aus all der Fülle eine selige Einheit, schaffen und ordnen darin und erzeugen ein volles jugendlichstrebendes Bewußtsein.
Ich blicke dann in mich selbst zurück, verschwimme trunken in meiner eigenen Tiefe, fühl' aus der ersten Quelle mein Ich, mein Sein; fühl' es im Anschaun einer selbstgeschaffenen Welt im Busen. Das, Bruder, das ist so etwas Riesenhaftes, dieses in sich Schauen,[208] dieses in sich Verschwimmen. Das muß die Wonne der Gottheit sein!
Ich kann's nicht leugnen, ich bin stolz. Ich fühle lebhaft in mir etwas Ursprüngliches, Ungeschaffenes, Unzerstörbares, etwas Unabhängiges, das sich genug ist in seiner eigenen Fülle, waltet und herrscht, etwas, das ewig anstrebt, voll Kraft und innerer Stärke, etwas – Göttliches.
Das fühlen alle die Vielen nicht, die sich wegwerfen und krümmen, sei es vor Gott oder Menschen.
Ich lass' alle Kräfte meines Innern wogen und walten, sich anstrengen und erneuern. Aber ich gesteh' es mir selbst, ich halte sie nicht in Zucht, im Gleichmaß.
Meine Seele hat Freiheit, kann wählen nach Gefallen und richten, unmittelbar, aus eigner Quelle über Sein und Nichtsein. Das ist das Göttliche in mir, der unveränderliche Wille zu wählen zwischen Gutem und Bösem. Das ist die hohe ewig lebendige Liebe. Ich fühle: ich bin, bin Mensch!
Überall ist Leben und Wärme. Ich gebe Leben und nehme Leben. Wie unendlich viel Schönes und Gutes um mich; wie viel tausend zum Genuß einladende Dinge! Und ich kann es doch nicht mehr recht genießen. Einst hab' ich alles gewagt, alles gepflegt und genossen; ich hab' auch geduldet, o überschwänglich viel geduldet. Nun ist es aus! Aus, Bruder! Durch alle meine Nerven, meine Muskeln klang es einst: Lebe! Genieße! Die Stimme schweigt. Ich harre vergebens auf sie. Ich sehne mich nach ihr, weine nach ihr; aber sie – schweigt.[209]
Die Blumen meiner Kindheit sind wohl noch; blühen immer noch; aber ich kann, ich darf sie nicht pflücken. Ich sog einst meinen Mut, Glauben und Vertrauen aus ihren Kelchen. Mir fehlt nun der Sinn für ihren Geruch.
O sieh, nicht das Untergehen fürcht' ich, aber jenes Dahinschwinden, jene allmähliche Auflösung, jenes Verdorren und Vertrocknen. So mit einemmal aus den Wurzeln gerissen zu werden, mit einemmal, – das möcht' ich lieber!
Die Menschen sind mir viel zu altklug; haben viel zu wenig Kindersinn. Das Frische, Jugendliche, die Einfalt ist doch mehr als all das verdrießliche Fortschlendern, das Ineinandergreifen von tausend verwobenen Sitten und Gebräuchen.
Das ist die höchste, die allein wahre Tugend, die unmittelbar aus dem Innern quillt, ohne Gesetz und Vorschrift, ohne Buchstaben und Wort, mitten aus dem Geiste, durch seine eigentümliche Kraft, durch die Stimme des Göttlichen in ihm. So geradezu handeln, wie's einem der Geist eingibt, dem innern Drange zu folgen und dem unverdorbnen Sinn und Herzen, das gefällt mir, und das tun die Kinder.
Ich hab' auch so einen Knaben um mich. Du solltest den Jungen sehen mit seiner vollen Traubenwange, seinem Feuerauge, seinen langen blonden Locken.
Oft wandl' ich an seiner Hand durch stille grüne Wiesen. Der Kleine vergnügt mich mit tausend sonderbaren Fragen, die ich oft nicht zu beantworten weiß. O, dieses Schaffen und Treiben, dieses Hinansteigen[210] von der Folge zum Grund, ist dem Menschen so eigen! Und wenn dann das blaue Gebirge vor uns dämmert, worüber ich herkam, Theodor, da wird alles, jeder Pulsschlag wird zum Schmerz, zu einer unüberwindlichen Sehnsucht, die mich hinüberzieht über alle Fernen zu ihr. Ich blicke dann hinaus mit blutendem Herzen und presse den Knaben an mich und seufze: Wärst Du mein! Wäre sie Deine Mutter!
O, ich vergehe über dem Gedanken!
|
Ausgewählte Ausgaben von
Phaeton
|
- ZenoServer 4.030.014
- Nutzungsbedingungen
- Datenschutzerklärung
- Impressum