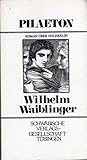|
Phaethon an Theodor
[145] O Theodor, meine Wonne ist aus! Verklungen wie Harfenlaute ist meine Seligkeit. Ich bin aus dem Himmel gestoßen, und auf der Erde soll ich mich nun finden?
Ach, jetzt fühl' ich: mein Glück war einst kein Traum, denn auch mein Unglück ist keiner.
Mein Leben ist wie ein reißend wilder Strom, der unterm Wirbeldrang des Sturmes brausend die Wogen an die Felsenufer schlägt und schäumend sie zu überspringen droht.
Ich bin wie das Reh, das, verwundet vom gierigen Jäger, durch Wald und Felsgeklüft sich drängt und immer und immer schwächer sich fühlt und atemlos zuletzt sich verblutet.
Ich bin angegriffen im Tiefinnersten. Das Heiligste, was ich hatte, das Geliebteste, ist mir entheiligt und geraubt.
Jetzt erst seh' ich ein, wie grenzenlos ich liebe. O ich Armer!
War das Dein Schmerz, Katon, den auf der Brust Du trugst? Und nun ist er weg? So ist es denn also gewiß: kein Mensch trägt ewig einen Schmerz.
Du Guter, Treuer, wenn Du mich liebst, so weine mit mir! Ich schlage krampfhaft meine Hände auf die Brust und wende wie verzweifelt meine Augen[145] umher. Aber das ist kein Trost für mein verwundet Gemüt! Weine! Weine! Mit Tränen will ich auswaschen die blutende Wunde. Ich bin ja unglücklich.
Höre! Schon einige Tage ist's, als wäre zwischen mich und Atalanta ein neidischer Dämon getreten. Es lag schwer auf mir. Ich konnte nicht ruhen des Nachts.
Da wandelt' ich gestern Abend durch den Garten, von meinem Schmerz gequält. Der Himmel war umhüllt von nächtlichen Regenwolken, finster wie meine Seele.
Ich dachte bei mir selbst: Welche Verwegenheit macht Dich so unglücklich? Ein Abbild der höchsten Schönheit hast Du erkannt in ihr, und Du denkst an irdischen Besitz?
Da erinnert' ich mich an alle jene Stunden, wo ihr Herz sich mir geöffnet, wo sie mein war, ganz sich mir gab, in mich verschwamm, mich küßte.
Und dies heiße Herz in meinem Busen, dieses Verlangen und doch dies Versagen, diese Sehnsucht und doch diese Treue, o alles, alles webte zusammen. Ein unendlich tiefes Selbstvertrauen stärkte meine Seele.
Jetzt hört' ich ferne den Klang einer Laute; und leise verhallende Stimmen klangen durch die Wellen der Lüfte.
Auf die drei Säulen ging ich zu. Stille schob ich die Rosengebüsche voneinander und – Atalanta saß auf einem Trümmer, die Laute in der Hand; ihr gegenüber Katon, die Arme stützend auf das Knie.
Der Säulen eine barg mich ihrem Auge. Es herrschte eine fürchterliche Stille. Da liefen ihre Finger wieder durch die Saiten.
Sie sang:
[146]
Wo weilst Du, Vater?
Badet mein weinend Auge
voll Sehnsucht sich im Purpurlicht
der glühenden Abendröte,
so denk ich Dein! Ach, schwimmst Du
drüben in den warmen Wellen?
Schau ich himmelan,
wann im nächtlichen Äther
die goldnen Sterne schweben
wie im dunkeln Laube
die schwellenden Zitronen,
so wein' ich hinauf und rufe:
Bist Du dort, Vater,
Vater, den noch nie mein Auge sah?
O schau auf Deine Tochter,
die um Dich weint!
Schau nieder auf die Liebende!
Nahst Du?
Ist das leise warme Wehen,
das die Wangen mir küßt,
ist es Dein Geist,
ist es Vaterkuß?
Kommst Du zu lösen dies Herz,
zu stillen dies Sehnen,
das mich drängt hinüber,
hinüber zu Dir?[147]
Und ich verlasse die Blumen,
meiner Jugend Gespielen,
um zu pflücken in Unschuld
die Blumen der Wahrheit
und seliger trunkener Liebe,
wo sie blühn um den Quell,
der aus der Gottheit Fülle quillt
wie Milch aus der Brust der Mutter?
Oder sind es Tränen Deines Auges,
die Tautropfen auf den Blättern,
die Du geweint,
weil Dein Kind Du nicht bei Dir hast?
Trockne sie, liebender Vater!
Ach, trockne sie!
Dein Kind wird zu Dir kommen,
weil rein es ist wie das Licht,
in dessen Fülle Du wohnst.
Dein Kind wird Dich sehen!
[148]
Sie schwiegen. Katon zitterte. Zittern sah ich ihn noch nie. Er hob die Arme zum Himmel und rief: O Vaterland und Liebe! Dann schlang er brünstig seine Arme um Atalanta und preßte das bebende Mädchen an seine Brust und küßte ihre Lippen. Ich kann nicht mehr! war das einzige, was er noch ausrief. Nun stand er auf und sagte mit einer Stimme, die nie noch so klang aus seinem Munde: Atalanta, komm!
Sie gab ihm die Hand, und beide verschwanden im Dunkel.
Katon! Katon! Das hätt' ich nicht gedacht!
War dies das fürchterliche Geheimnis, das Du ausgebrütet im Gewölbe beim magisch geisterhaften Schein der Kandelaber? Finsterer Sohn der rätselhaften Nacht, du ewiges Geheimnis! Ich wähnte, Du denkst am alten schwarzen Sarkophag an die abgeschiedenen Brüder und nicht an eine unverblühte Jugend. Ich wähnte, in Deiner Brust wehen die Schauer des Todes, und sie glühet für zarte Mädchenwangen. Der Sarkophag sei bestimmt für die Verstorbenen und nicht für die Lebendigen. Für mich! O Theodor, mir graust![149]
Lange stand ich unbeweglich an der Säule. Dann sank ich auf die Trümmer, wo die Beiden sich umarmt, und kühlte meine brennenden Lippen an dem kalten Stein und benetzt' ihn mit meinen Tränen. Dann rannt' ich davon.
Ich hätte sollen schlafen? Theodor, schlafen?
Ich lief durch die finstern Wiesen. Mein Inneres war nächtlich wie Nebelhaiden Ossians, wann durch die Wolken weht der Geist des schaudrigen Loda, und der Nachtsohn daher fährt auf Orkanen, den grauenvollen Wolkenschild schüttelnd.
Auf einem Berge legt' ich mich nieder. Die Winde rauschten durch die Eichen und schüttelten die Äste wie Nachtgedanken meine arme Brust. Allein saß ich auf dem Berge. Ich fühlte nimmer die Mutterliebe der allbeseelten Natur, nicht mehr das heilige lebendige Glühen um mich her. Es standen die Eichen vor mir wie erstarrte Riesen, und das finstre Tal am Fuß des Berges wie schaurigöde Reste einer zertrümmerten Welt voll Licht und Leben. Tot, tot war es um mich wie in meinem Innern.
O, da fand ich's: Wer den Frieden nicht im Busen trägt, der findet ihn nirgends.
Ach, ein einziger Stern am Himmel hätte mich noch glücklich gemacht. Ich hatte ja Licht gesehen.
Ich lief wieder hinab dem Schlosse zu. Keine Seele begegnete mir unterwegs. Alles, alles schwieg und ruhte, Menschen und Tiere, Bäume, Blumen und Gräser. Ich allein ruhte nicht. Am Ufer des Sees[150] setzt' ich mich nieder. Seine Wellen klangen durch die Stille. Das einzige Bewegliche in der entschlummerten Welt! Aber ach, mir schien's, als klängen die Wellen nur, die Minuten des Todes zu zählen.
Gegen Morgen ging ich nach Hause.
|
Ausgewählte Ausgaben von
Phaeton
|
Buchempfehlung
Hoffmannswaldau, Christian Hoffmann von
Gedichte
»Was soll ich von deinen augen/ und den weissen brüsten sagen?/ Jene sind der Venus führer/ diese sind ihr sieges-wagen.«
224 Seiten, 11.80 Euro
Im Buch blättern
Ansehen bei Amazon
Buchempfehlung
Große Erzählungen der Hochromantik
Zwischen 1804 und 1815 ist Heidelberg das intellektuelle Zentrum einer Bewegung, die sich von dort aus in der Welt verbreitet. Individuelles Erleben von Idylle und Harmonie, die Innerlichkeit der Seele sind die zentralen Themen der Hochromantik als Gegenbewegung zur von der Antike inspirierten Klassik und der vernunftgetriebenen Aufklärung. Acht der ganz großen Erzählungen der Hochromantik hat Michael Holzinger für diese Leseausgabe zusammengestellt.
- Adelbert von Chamisso Adelberts Fabel
- Jean Paul Des Feldpredigers Schmelzle Reise nach Flätz
- Clemens Brentano Aus der Chronika eines fahrenden Schülers
- Friedrich de la Motte Fouqué Undine
- Ludwig Achim von Arnim Isabella von Ägypten
- Adelbert von Chamisso Peter Schlemihls wundersame Geschichte
- E. T. A. Hoffmann Der Sandmann
- E. T. A. Hoffmann Der goldne Topf
390 Seiten, 19.80 Euro
Ansehen bei Amazon
- ZenoServer 4.030.014
- Nutzungsbedingungen
- Datenschutzerklärung
- Impressum