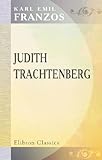Drittes Kapitel
[215] Herr Thaddäus von Wiliszewski war, einige geringe Unterschiede abgerechnet, eine Art polnischer Walther von der Vogelweide. Auch er wirkte weniger durch sein Wissen als durch sein Talent, zog von Hof zu Hof, mahnte die Adligen zur Milde, jubelte, wenn er ein neues Gewand bekam, und bemühte sich viel um Lehen; so viel mag sogar selten ein Mensch geliehen haben. Und gleich Walther war auch er ein vorwiegend politischer Lyriker, aber von der Einseitigkeit des Deutschen fern; den Adligen las er Kampflieder gegen Österreich vor und besang auf Bestellung des Kreisamts den Geburtstag des Kaisers; für Bürgerliche hatte er Spottverse auf den Adel, für Adlige Verhöhnungen des Bürgertums bereit. Auch er war später sicherlich von Adel, denn das »von« stand unter seinen Gedichten und auf seinen Briefen ein Wappen, aber auch seine adlige Geburt ließ sich nicht bestimmt erweisen; einige hielten ihn für einen Schusterssohn, der im Gymnasium durchgefallen, die übrigen für einen ehemaligen Barbiergesellen. Auch seine Geburtsstätte ließ sich nicht erkunden; auch um ihn stritten einige Landschaften, da jede die Ehre ablehnte; er selbst pflegte sich immer als den Sohn jener Gegend zu bezeichnen, in welcher er gerade Subskribenten für seine Gedichte erwarb. Wäre dies Buch je erschienen, so hätte es in sehr großer Auflage hergestellt werden müssen, denn von wie vielen Thaddäus die drei Gulden dafür erhob, ist nicht zu zählen; aber gleich dem Minnesänger ließ er sich an der mündlichen Wirkung genügen. Ungeladen und plötzlich, recht wie eine Gabe des Himmels, pflegte er auf den Gutshöfen einzutreffen; einige warfen ihn nach drei, andere nach acht Tagen hinaus, freiwillig ging er niemals. Da man von[215] der Poesie allein nicht leben kann, so vermittelte er zuweilen eine kleine Bestechung oder sonstige Niedertracht; daher auch seine Freundschaft mit dem Kreiskommissär.
Dieser Sohn der Musen war's, dem zu Ehren Frau Anna die kleine Gesellschaft versammelt. Die langen, graublonden Locken noch wirrer als gewöhnlich, auf den hageren Wangen die Röte der Erregung, saß Thaddäus da und deklamierte die Gedichte zur Verherrlichung des Adels. Ein Graf hatte ihn schon lange nicht angehört, und Agenor war gekommen, obwohl er gestern abgesagt – nur aus Interesse für den Dichter hatte er es in letzter Stunde ermöglicht! Was aber Thaddäus am meisten beglückte, war die gespannte Aufmerksamkeit dieses reichen Mannes. Er las eben seine historische Ballade »Der blutige Tag«; der Held war eigentlich ein Poniatowski, aber der Dichter las immer »Baranowski« – ins Versmaß paßte es ja! Das Hochgefühl dichterischer Begeisterung erfüllte seine Brust; hol mich der Teufel, dachte er, wenn das nicht fünfzig Gulden trägt!
Nachdem er geschlossen, blieb es still; die Gesichter seiner Hörer konnte er nicht genau unterscheiden, weil Frau Anna den Lampenschirm so gestellt, daß das Licht nur auf das Manuskript fiel, aber dies Schweigen war ja das deutlichste Zeichen der tiefen Wirkung.
»Wunderbar!« sagte endlich die Hausfrau. Das Versgeklingel war unbeachtet an ihrem Ohr vorbeigeglitten; sie hatte nur den Grafen betrachtet, wie er so regungslos dasaß, befangen wie ein Knabe. Ein Seufzer hob den üppigen Busen: Ein Prachtmensch! Und das alles dieses Judenmädels wegen!
»Sehr – sehr anmutig«, murmelte nun auch der Graf und fuhr aus seinem Brüten empor.
»Besonders die Schilderung der Landschaft!« rief der Kreiskommissär.
»Der Landschaft?« fragte Judith erstaunt. Sie allein war dem Gedichte gefolgt, schon um Fassung zu gewinnen, das unruhig pochende Herz zur Ruhe zu zwingen. Daß sie leichteren Herzens dem Befehl des Vaters gehorcht und gekommen, war nur des Grafen Verdienst, seine Beteuerung hatte ihr den Glauben an diese Menschen zurückgegeben, aber nun er so unvermutet eingetreten, war es ihr, als müßte sie fliehen, sich selbst entfliehen.[216]
Herr von Wroblewski tat, als hätte er ihren leisen Einwand überhört. »Und diese Menschen –!« rief er begeistert. »Man sieht sie ordentlich vor sich stehen! ... Und die Gefühle!« fügte er vorsichtshalber hinzu. Etwas, zum Henker, dachte er, wird doch in dem langweiligen Zeug vorgekommen sein. Dann gab er seiner Tochter einen Wink, sie glitt unbemerkt zur Türe hinaus.
»Ein Meister, unser Thaddäus!« fuhr er laut fort. »Einige seiner Balladen reichen an Mickiewicz heran, auf Ehre, an Mickiewicz! Und wie vielseitig er ist! Sie würden ihn wohl, lieber Graf, nach dem bisher Gehörten unter die sentimentalen Poeten zählen? Und nun, Thaddäus, nun lesen Sie uns die Lieder ›Venus im Schlafrock‹!«
Es war eine Reihe schlüpfriger Gedichte, welche Judith bei der letzten Vorlesung ins Nebenzimmer getrieben. Sie hatte nicht recht verstanden, warum die anderen Hörer so sehr gekichert, aber ihr Instinkt hatte ihr gesagt, daß derlei nicht für ihre Ohren tauge.
»Vielleicht später«, sagte der Poet. »Nun möchte ich das Gedicht ›König Kasimir und die schöne Esther‹ lesen.«
»Was fällt Ihnen bei?« rief Wroblewski erschreckt; er kannte es, es war ein wüster Schimpf gegen die Juden.
»Lassen Sie nur«, beruhigte ihn Thaddäus. »Sie kennen die neue Fassung noch nicht!« Da sich nämlich in den letzten Jahren auch einige jüdische Gutspächter in Ostgalizien so weit für die polnische Literatur interessierten, daß sie ihn ab und zu einige Tage beherbergten, so hatte er die Geschichte von Kasimir dem Großen und seiner jüdischen Geliebten auch in judenfreundlicher Tendenz bearbeitet. Das paßt heute ausgezeichnet, dachte er, und bringt die fünfzig vielleicht auf hundert Gulden! Denn jene Ballszene war ihm ja wohlbekannt, und der Charakter seines edlen Freundes bürgte ihm dafür, daß er heute nicht zufällig bloß Judith und den Grafen zu seinen Hörern zählte.
Und er begann zu lesen; schon die ersten Verse beruhigten den Hausherrn; die Worte der früheren Fassung, der Dichter wolle verkünden, wie sich die Judenpest in Polen eingenistet, waren nun durch die sanfte Wendung ersetzt: wie das Volk des alten Bundes hier eine Freistatt gefunden. In dieser Tonart war das ganze Gedicht umgeschrieben: wie Kasimir, der schönen[217] Esther zuliebe, den Juden Freibriefe geschenkt und sogar die Geliebte zur Königin erhoben – der Schluß war eine warme Mahnung zur »Brüderlichkeit«.
Wieder war es eine Weile still. »Ausgezeichnet!« murmelte endlich der Hausherr und blickte dabei nach dem Grafen. Aber diesem war nur eine Empfindung vom Antlitz abzulesen: wie verzückt starrte er in die erregten Züge des schönen Mädchens ihm gegenüber. Judith gewahrte es nicht; schwer atmend, mit halbgeschlossenen Augen saß sie, in sich versunken, den stürmischen Empfindungen hingegeben, welche die Dichtung in ihr erweckt. Sie hatte nie vorher von der schönen Esther vernommen; wie eine tröstliche Offenbarung überkam nun ihr verzagtes Herz die Erkenntnis, daß jene Schranken, welche sie in den letzten Tagen so qualvoll empfunden, nicht von der Natur selbst gesetzt seien. Es hatte eine Zeit gegeben, wo sie nicht bestanden; eine Jüdin war Königin von Polen gewesen – und Gott hatte es nicht gewehrt und die Menschen nicht gehindert! Und dann mußte sie des heißen, dunklen Gefühls gedenken, welches sie seit jener Ballszene erfüllte – ein Graf war noch lange kein König ... Sie richtete sich auf, als wollte sie den Gedanken abschütteln, der sie überkommen, und begegnete dabei dem starren, glutvollen Blick des Grafen. Sie zuckte zusammen, eine Blutwelle jagte über ihr Antlitz, sie erhob sich, als wollte sie fliehen ...
»Ausgezeichnet!« wiederholte Wroblewski mit ungeheuchelter Wärme – nun aber um Gottes willen, fügte er in Gedanken bei, ein Gespräch unter vier Augen. »Und jetzt, bitte, bitte, lieber Poet, die Venuslieder!« Er lachte wie ein Faun. »Sie sind köstlich, Graf, auf Ehre!«
Gefügig griff der Sänger nach dem sehr verschlissenen Manuskript; diese Lieder wurden am häufigsten von ihm gewünscht. Aber der Graf legte sich ins Mittel. »Ich denke«, sagte er sehr bestimmt, »wir bitten Herrn Wiliszewski um etwas anderes, was auch für Damen taugt.« Dagegen gab es keinen Widerspruch, der Dichter las eine schauerliche, aber unbedenkliche Ballade. Dann ging man zum Souper; es verlief still genug. Der Graf und Judith schwiegen, und der Poet hielt, wie immer, Sprechen bei der Mahlzeit für sündige Vergeudung einer kostbaren[218] Zeit, die ja für ihn nicht alle Tage wiederkehrte. So mußte Wroblewski allein die Kosten der Unterhaltung tragen, denn auch Frau Anna blickte in stummem Sinnen vor sich nieder. Sie war übel gelaunt; den Plan ihres biederen Eheherrn zu fördern, war sie nicht gewillt – im Gegenteil! »Der Prachtmensch!« seufzte sie immer wieder. Und wie sie sich so das junge, verträumte Mädchen ansah, schien ihr ein guter Einfall zu kommen.
»Aber Judith«, sagte sie lachend, »du nimmst ja keinen Bissen! Hat es dich so tief gerührt, daß unser Wiliszewski die schöne Esther Königin werden läßt?«
Die Wirkung war tiefer, als Frau Anna gehofft. Das Mädchen zuckte zusammen und wechselte die Farbe. »Wurde sie dies nicht?« fragte sie fast tonlos.
Frau Anna lachte laut auf. »Aber du hast es doch nicht im Ernst geglaubt?«
»Warum nicht?« rief der Kommissär und warf seiner Gattin einen wütenden Blick zu. »Auch ich glaube es. Es war doch wirklich so, lieber Wiliszewski?!«
Der Poet hatte gerade den Mund so voll, daß er zunächst gar nichts erwidern konnte. Eine ausweichende Antwort schien ihm geraten. »Einige« – er schluckte krampfhaft –, »einige Chronisten sagen es.«
»Die verläßlichsten!« bestätigte Wroblewski energisch.
»Aber so kommen Sie mir doch zu Hilfe!« wandte sich Frau Anna an den Grafen. »Ich habe immer nur gelesen: sie war des Königs Geliebte!«
Der Graf zauderte, aber kaum eine Sekunde lang. »So war es auch«, sagte er. »Unser Poet kennt ja die alten Chronisten zweifellos besser als ich, aber vor der modernen Forschung würde sein Gedicht überhaupt schlecht bestehen. Es ist erwiesen, daß Kasimir der Große den Juden nur aus denselben Gründen das Land öffnete wie den Deutschen: um Ersatz für den fehlenden Bürgerstand zu schaffen. Daß ihn die schöne Esther länger gefesselt als seine anderen Freundinnen, steht fest, aber großen Einfluß auf seine Handlungen schreibt ihr die Geschichte nicht zu.«
»Ihre Kenntnisse in Ehren«, sagte der Kommissär, »doch ich habe oft das Gegenteil gelesen – auf Ehre, sehr oft. Aber daß[219] der große Kasimir, der letzte Piast, die Jüdin heißer geliebt hat als je vorher eine Christin, geben auch Sie zu?«
»Gewiß!« erwiderte Agenor, »das berichten alle.«
Die Tafel wurde aufgehoben; die Gesellschaft ging in den Salon. Wanda und Judith setzten sich an den Albumtisch, Frau Anna verwickelte den Grafen in ein Gespräch; der Poet nahm den Hausherrn in Beschlag. Aber dieser hörte zerstreut zu, obwohl Wiliszewski ein geschäftliches Anerbieten, das er ihm bereits früher gemacht, nun neuerdings und dringlicher entwickelte. Der Kommissär hatte einen Spitzbuben aus guter Familie verschiedener Betrügereien wegen in Untersuchungshaft gesetzt. Thaddäus schilderte beweglich den Schmerz der Angehörigen; nachdem der Mensch als Novize in einem Franziskanerkloster nicht gut getan, wollten sie ihn nun nach Rußland schicken, aber eine Verurteilung werde seine Geschwister schwer treffen. »Es ist gut«, fiel ihm der Kommissär endlich ins Wort. »Ich bin ja kein Unmensch – wir sprechen nächstens darüber. Nun aber gehen Sie ins Rauchzimmer!« Der Poet gehorchte, der Kommissär trat auf Wanda zu, sie verschwand auf seinen Blick, und die gleiche Wirkung erreichte er auch bei seiner Gattin, wenn auch nicht ganz so rasch. Aber Frau Anna verstand sich auf seine Mienen; sie erkannte, daß sie ihm heute nicht straflos zum zweiten Male den Willen durchkreuzen würde.
»Und nun, lieber Graf«, bat der Kommissär mit einem Blick auf Judith, »müssen Sie auch mich entschuldigen!«
»Herr von Wroblewski ...«, begann Agenor.
»Sie befehlen?«
»Ich muß Ihnen sagen, daß ich – daß ich die Art nicht billigen kann, mit welcher Sie ...«
Er verstummte, obwohl der Hausherr mit gesenktem Blick, wie ein reuiger Sünder, vor ihm stand. »Schelten Sie mich nicht«, sagte der Kommissär. »Verderben Sie mir die Freude, die große Freude nicht, Sie heute unvermutet hier zu haben, trotz Ihrer gestrigen Ablehnung.« Er verbeugte sich und glitt geräuschlos hinaus.
Der Graf biß sich auf die Lippen; unschlüssig blickte er ihm nach und dann auf Judith; sie starrte auf das Buch, das vor ihr lag; das Licht der Lampe beschien die rotgoldenen Flechten, das[220] feine Oval des blühendes Gesichts. Er holte tief Atem und trat auf sie zu.
Sie schreckte bei seinem Nahen empor, und als sie sah, daß sie mit ihm allein war, schien es, daß sie fliehen wollte. »Was hat Sie so gefesselt?« fragte er möglichst unbefangen und blickte auf den aufgeschlagenen Stahlstich. »Heidelberg? Eine herrliche Stadt! Mein Regiment lag einige Zeit als Bundesgarnison in Mainz, da bin ich oft drüben gewesen.«
»Mein Bruder soll dort studieren«, sagte sie.
Er fragte, warum Rafael nicht eine österreichische Hochschule aufgesucht; sie erwiderte, es sei auf Bergheimers Rat geschehen, der die Heidelberger Juristenfakultät besonders gerühmt. Der Vater habe zu Bergheimer das größte Vertrauen, wie er ihm ja auch des Bruders und ihre Erziehung ganz anvertraut. Und als er nun wissen wollte, in welchen Gegenständen und wie sie von ihm unterrichtet worden, erzählte sie eingehend darüber. Wenn der Kreiskommissär etwa horchte, so konnte er von dieser Führung des Gesprächs wenig erbaut sein.
Aber es sollte bald eine bedeutungsvollere Wendung nehmen. Sie erzählte, daß Bergheimer ein überaus eifriger Botaniker sei und ein großes Herbarium Ostgaliziens angelegt habe.
»Da hat ihn wohl auch der Schloßgarten sehr interessiert?« fragte Agenor.
»Gewiß! Aber dort ist er nie gewesen.«
»Warum nicht?«
»Er durfte ja nicht. Der Eintritt ist Juden verboten, wie die Tafel am Eingang sagt ... Sie dürfen aber nicht glauben«, fügte sie hinzu, »daß ihn dies verbittert hat. ›Es ist wohl kein böser Wille unserer Herrschaft‹, pflegte er zu sagen, ›an jedem Schloßgarten in Podolien steht eine solche Tafel; wer sie wegtun wollte, dem würde das am Ende gar verargt werden!‹ Bergheimer ist ein so milder, edler Mensch! Und für sich eine Ausnahme zu erwirken, war er nicht zu bewegen, sosehr es ihn zu den Blumen zog. ›Vielleicht erlaubt es der Gärtner‹, meinte er, ›aber ich will's nicht besser haben als meine Brüder!‹, und er hat recht gehabt!«
»Da haben wohl auch Sie den Garten nie betreten?«
»O doch!« erwiderte sie errötend. »Ich bin oft dort gewesen,[221] mit Wanda oder den Töchtern des Bürgermeisters, zuweilen auch allein. Die Wächter kannten mich, aber sie schwiegen. Und ich« – sie stockte –, »ich war schwach genug, mich dessen zu freuen; ich dünkte mich besser als die andern. Aber ich habe es redlich abgebüßt! Wie mir zumute war, als ich erkannte ...«
»Durch die Szene hier im Hause?« fiel er ihr ins Wort. »Ich weiß ja seit gestern, welchen Eindruck sie Ihnen gemacht haben muß. Mit Unrecht, Fräulein Judith! Glauben Sie mir, diese Kluft ...«
Sie lauschte regungslos, gleichwohl stockte er. Nein, er konnte und durfte nicht lügen.
»Diese Kluft!« mahnte sie endlich.
»Ist doch wohl nicht so tief ... Aber wozu darüber sprechen ... Also in Heidelberg wird ...«
Ein trauriges Lächeln umspielte ihren Mund. »Sie sind ein ehrlicher Mann, Herr Graf«, sagte sie. »Auch vorhin hatten Sie allein den Mut, die Wahrheit zu sagen. Und nun verstehe ich auch, warum ich den Namen jener Esther nie gehört habe, weder von meinem Vater noch von Rafael oder von Bergheimer ...«
»Wieso?«
Ihr Antlitz flammte. »Sie war ja eine Verworfene«, sagte sie.
»Ein sehr herbes Urteil! Erwägen Sie doch, wie sehr Kasimir sie liebte ...«
»Das eben glaub ich nicht ... Ich sollte vielleicht nicht darüber sprechen, es gilt ja als unschicklich. Aber warum sollte ich's verschweigen? Liebte er sie wahrhaft, so mußte er sie zu seinem Weibe machen, und war dies nicht möglich, weil er ein König war und sie ein Judenkind, so mußte er ihr fernbleiben und sie nicht dem schlimmsten Geschick preisgeben: der Verachtung. Unter uns Juden wenigstens wird ihr Name sicherlich, wenn überhaupt, dann nur zum Bösen genannt.«
»Das weiß ich freilich nicht«, erwiderte er, »aber wer menschlich fühlt, dürfte sie selbst dann nicht erbarmungslos richten, wenn Kasimir kein König gewesen wäre. Nehmen Sie an, sie habe ihn aus ganzer Seele geliebt!«
Sie schüttelte den Kopf.
»Das glauben Sie nicht?«
»Ich weiß nicht ...« Sie schien fassungslos vor Scham und[222] Verlegenheit, fuhr dann jedoch tapferer fort: »Wenigstens habe ich von solcher Liebe nie unter uns gehört. Meine Eltern – eine zärtlichere und glücklichere Ehe hat es schwerlich gegeben, und doch haben sie sich erst bei der Verlobung kennengelernt. Und so ist's fast immer. Ich glaube, darin sind wir anders!«
»Glauben Sie dies wirklich?« rief er. »Dann wäre ja auch jene Kluft von der Natur selbst gezogen, dann wären Sie nicht Menschen wie wir. Aber ich meine, Sie verwechseln Ursache und Wirkung. Die Abgeschlossenheit, das Festhalten an der uralten Sitte hat Ihr Volk dazu geführt. Wenn ich Sie so vor mir stehen sehe, warum sollte Ihnen ...«
»Sprechen Sie nicht von mir!« bat sie mit gefalteten Händen und so flehenden Tones, daß er schwieg.
»So stumm?« klang eine lachende Stimme in diese schwüle Stille hinein, es war Frau Anna.
... Als Judith am nächsten Tage zur Mittagsstunde das Speisezimmer betrat, kam ihr der Vater freudig entgegen. »Ein Brief von unseren Lieben«, rief er. »Aus Breslau. Sie haben die Reise bisher ohne Unterbrechung zurückgelegt, wollen aber nun acht Tage dort bleiben, ehe sie über Sachsen und Bayern an den Neckar gehen. Denke nur, Bergheimer hat in Breslau einen ehemaligen Mainzer Schüler gefunden, der jetzt als Bankier dort etabliert ist, Berthold Wertheimer heißt er; er kann den jungen Mann nicht genug rühmen. Ich habe schon an Rafael geschrieben, auch die heutige Tat unseres Grafen habe ich ihm mitgeteilt – wie hat er, wie haben wir alle dem edlen Manne unrecht getan!«
»Welche Tat?« fragte Judith.
»Du weißt es noch nicht? In der ganzen Stadt spricht man von nichts anderem. Die Tafel am Eingang des Schloßgartens steht nicht mehr, und er hat es uns Vorstehern in einem freundlichen Briefe mitgeteilt ... Du schreibst doch an Rafael ein Wort hinzu? Er läßt dich herzlich grüßen und fügt bei: ›Judiths Versprechen beim Abschied, unserer letzten Unterredung eingedenk zu bleiben, macht mich froh und heiter!‹ Was meint er damit?«
»Nichts«, murmelte sie, halb abgewendet. »Eine Kinderei.«
»So dachte ich. Aber bist du nicht wohl, Kind? Du bist so blaß!«[223]
|
Ausgewählte Ausgaben von
Judith Trachtenberg
|
Buchempfehlung
Gellert, Christian Fürchtegott
Die zärtlichen Schwestern. Ein Lustspiel in drei Aufzügen
Die beiden Schwestern Julchen und Lottchen werden umworben, die eine von dem reichen Damis, die andere liebt den armen Siegmund. Eine vorgetäuschte Erbschaft stellt die Beziehungen auf die Probe und zeigt, dass Edelmut und Wahrheit nicht mit Adel und Religion zu tun haben.
68 Seiten, 4.80 Euro
Im Buch blättern
Ansehen bei Amazon
Buchempfehlung
Geschichten aus dem Biedermeier. Neun Erzählungen
Biedermeier - das klingt in heutigen Ohren nach langweiligem Spießertum, nach geschmacklosen rosa Teetässchen in Wohnzimmern, die aussehen wie Puppenstuben und in denen es irgendwie nach »Omma« riecht. Zu Recht. Aber nicht nur. Biedermeier ist auch die Zeit einer zarten Literatur der Flucht ins Idyll, des Rückzuges ins private Glück und der Tugenden. Die Menschen im Europa nach Napoleon hatten die Nase voll von großen neuen Ideen, das aufstrebende Bürgertum forderte und entwickelte eine eigene Kunst und Kultur für sich, die unabhängig von feudaler Großmannssucht bestehen sollte. Dass das gelungen ist, zeigt Michael Holzingers Auswahl von neun Meistererzählungen aus der sogenannten Biedermeierzeit.
- Georg Büchner Lenz
- Karl Gutzkow Wally, die Zweiflerin
- Annette von Droste-Hülshoff Die Judenbuche
- Friedrich Hebbel Matteo
- Jeremias Gotthelf Elsi, die seltsame Magd
- Georg Weerth Fragment eines Romans
- Franz Grillparzer Der arme Spielmann
- Eduard Mörike Mozart auf der Reise nach Prag
- Berthold Auerbach Der Viereckig oder die amerikanische Kiste
434 Seiten, 19.80 Euro
Ansehen bei Amazon
- ZenoServer 4.030.014
- Nutzungsbedingungen
- Datenschutzerklärung
- Impressum