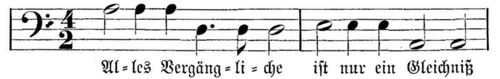|
III.
Robert Schumann's Künstlerlaufbahn.
[152] Leipzig, Dresden, Düsseldorf.
1840–1854.[153]
Das Jahr 1840 bezeichnet, wie schon bemerkt wurde, einen entschiedenen Wendepunkt in der Künstlerlaufbahn Schumann's. Ehe diese Erscheinung näher beleuchtet wird, ist zuvor eines Ereignisses zu gedenken, welches in den Beginn dieses Zeitabschnittes fällt. Es betrifft die Promotion Schumann's zum Dr. philos.
Wie aus Schumann's Briefen hervorgeht, hatte er schon Anfang 1838 die Absicht, sich um diese Würde zu bewerben1; doch führte er sie jetzt erst wirklich aus. Hierbei bediente er sich der Mitwirkung seines Freundes Keferstein2, auf dessen Rath er ein Gesuch wegen Erlangung des Doctortitels an die philosophische Fakultät der Jenenser Universität richtete. Folgender Auszug aus demselben ist wegen der darin enthaltenen Bekenntnisse von Interesse: Daß ich eine Reihe Jahre hindurch mir und meinen Ansichten treu geblieben bin, stärkt mich oft in meinem Glauben darin; denn Irrthum kann nicht so lange haften. Einer treuen Verehrung für das Ueberkommene, das Alte, bin ich mir vor Allem bewußt, nicht minder habe ich jedoch auch die Talente der Gegenwart zu fördern gesucht, fußen sie nun auf dem Alten, wie zum Theil Mendelssohn, oder haben sie wirklich Eigenthümliches und Neues ersonnen, wie etwa Chopin. Als Componist gehe ich vielleicht einen von allen andern verschiedenen Weg; es spricht sich nicht gut über die geheimsten Dinge der Seele. – So möchten Sie denn freundlich anblicken, was ich Ihnen vorgelegt, und auch der Zukunft vertrauen und dem höheren Mannesalter, wo es sich ja immer erst am deutlichsten zeigt, was Kern war, was nur Hoffnung.
Der dieser Eingabe ordnungsgemäß beigefügte Lebenslauf lautet wörtlich:[155]
Ich bin zu Zwickau in Sachsen geboren, den 8. Juni 1810. Mein Vater war Buchhändler, ein höchst thätiger und geistreicher Mann, der sich namentlich durch seine Einführung der ausländischen Classiker in Taschenausgaben, durch die zu ihrer Zeit vielgelesenen Erinnerungsblätter, durch eine Menge wichtiger kaufmännischer Werke und noch kurz vor seinem Tod durch Uebersetzung mehrerer Byron'scher Werke bekannt gemacht hat. Meine Mutter war eine geborene Schnabel aus Zeitz. Ich genoß die sorgfältigste und liebevollste Erziehung. Starke Neigung zur Musik zeigte sich schon in den frühesten Jahren, ich erinnere mich ohne alle Anleitung Chor- und Orchester-Werke schon in meinem 11. Jahre geschrieben zu haben3. Der Vater wollte mich auch durchaus zum Musiker bilden; die Verhandlungen, die deshalb mit C. M. von Weber in Dresden gepflogen wurden, zerschlugen sich jedoch. So erhielt ich denn eine gewöhnliche Gymnasialbildung, nebenbei mit ganzer Liebe meine musikalischen Studien verfolgend, und nach Kräften selbst schaffend. 1828 bezog ich die Universität Leipzig, hauptsächlich um philosophische Vorträge zu hören, so namentlich bei Prof. Krug, 1829 ging ich nach Heidelberg, wohin mich Thibaut und sein Ruf als ausgezeichneter Musikkenner und Forscher vor allem gezogen hatte. Hier fing ich an, mich ausschließlich mit Musik zu beschäftigen, worin mich bedeutende Fertigkeit des Clavierspiels um so schneller vorwärts brachte. Zu weiterer Fortbildung ging ich 1830 nach Leipzig zurück, vollendete bei dem damals anwesenden Musik-Direktor Heinrich Dorn, jetzt Kapellmeister in Riga, meinen Compositionscursus und gab meine ersten Compositionen heraus. Die Kritik nahm mich wohlwollend auf. Durch einiges Vermögen gegen die Schattenseiten musikalischen Künstlerlebens gesichert, konnte ich mich ganz dem Studium der höhern Composition widmen. Es war damals die Zeit der Bewegung in ganz Europa, die auch auf das künstlerische Zusammenleben in Leipzig Einfluß übte, indem ich in Gemeinschaft mit einigen andern Musikkundigen, von denen namentlich mein früh verschiedener Freund Ludwig Schunke[156] zu nennen ist, auf den Gedanken der Herausgabe einer neuen musikalischen Zeitschrift kam, der auch im April 1834 ausgeführt wurde. Die Zeitschrift erwarb sich Beifall, und steht im Augenblick durch eine gesteigerte Theilnahme des Publikums sicher. 1835 ging die Redaktion auf mich allein über. War ich so genöthigt, meine Kräfte zu spalten, so überwog doch immer die productive Thätigkeit und milderte das auch oft Mißliche jenes andern Wirkungskreises. In dieser Stellung befinde ich mich noch; sie brachte es mit sich, daß ich mit den meisten der jetzt lebenden Künstler in nahe Verbindung kam, die von Jahr zu Jahr sich mehrten, wo ich es mir denn vorzüglich angelegen sein ließ, das Streben der bedeutendsten jüngeren Talente zu fördern. So wurde Chopin, Clara Wieck, Henselt u. A. namentlich durch die Zeitschrift bekannt.
Wichtige äußere Lebensmomente wüßte ich keine zu bezeichnen. Neuerdings wurde mir die freundliche Auszeichnung, von der Gesellschaft zur Beförderung der Tonkunst in Rotterdam, von dem deutschen Nationalverein zu Stuttgart und der Musikgesellschaft Euterpe in Leipzig zum correspondirenden und Ehrenmitglied ernannt zu werden.
Von musikalischen Compositionen sind bis jetzt 22 erschienen, von denen auch Liszt4, Clara Wieck, Henselt u. A. öffentlich spielten. Auch schrieb ich Einiges unter dem Namen Florestan und Eusebius. In der Zeitschrift rühren die meisten kritischen Artikel über Instrumentalmusik von mir und haben entweder meinen Namen, oder auch den von Florestan und Eusebius, so wie die Zahlen 2 und 12 zur Unterschrift.
Leipzig, den 17. Februar 1840.
Robert Schumann.
Schumann hatte nicht lange auf den Doktorhut zu warten. Nachdem Hofrath Reinhold, Dekan der philosophischen Fakultät an diese selbst unterm 22. Februar desselben Jahres den betreffenden Antrag gestellt hatte, wurde das Diplom zwei Tage später ausgefertigt und Schumann übermittelt. Es lautet wie folgt:
[157] Viro praenobilissimo atque doctissimo
Roberto Schumann
Zwickaviensi
complurium societatum musicarum sodali qui rerum Musis sacrarum et artifex ingeniosus et judex elegans modis musicis tum scite componendis tum docte judicandis atque praeceptis de sensu pulchritudinis venustatisque optimis edendis magnam nominis famam adeptus est
Doctoris Philosophiae honores
dignitatem jura et privilegia ingenii, doctrinae et virtutis spectatae insignia atque ornamenta detulit est.
Die schöpferische Thätigkeit Schumann's während des Jahres 1840 war eine seinen früheren Bestrebungen durchaus entgegengesetzte. Sie galt ausschließlich der Lyrik. Ein reicher Liederstrom entquoll gleichsam in einem Athemzuge der Dichterbrust des Meisters, und mit Recht darf man daher dieses Jahr geradezu das »Liederjahr« nennen. Unter dem 19. Februar 1840 berichtet er an Keferstein5: »Ich schreibe jetzt nur Gesangsachen, großes und kleines, auch Männerquartette, die ich meinem verehrten Freund, der eben diese Zeilen liest, zueignen möchte, wenn er mir freundlich verspricht, mich nicht mehr vom Componiren abzuhalten. Darf ich? Kaum kann ich Ihnen sagen, welcher Genuß es ist, für die Stimme zu schreiben im Verhältniß zur Instrumentalcomposition, und wie das in mir wogt und tobt, wenn ich in der Arbeit sitze. Da sind mir ganz neue Dinge aufgegangen und ich denke auch wohl an eine Oper, was freilich nur möglich, wenn ich ganz einmal von der Redaktion los bin.«
Mit Vorliebe setzte er die Lieder Heinrich Heine's in Musik. Nächstdem begegnet man in seinen Gesangscompositionen vorzugsweise den Dichternamen Goethe's, Byron's, Geibel's, Reinick's, Chamisso's, Rückert's, Eichendorff's und Justinus Kerner's, von[158] denen die vier letzteren seiner poetischen Richtung so wie seiner ganzen Empfindungsweise wohl am Nächsten stehen.
Das plötzliche Hinüberspringen Schumann's in ein Gebiet der Composition, welches von ihm bisher nur vorübergehend betreten wurde, und zwar zu einer Zeit, in der er der Kunst noch nicht berufsmäßig angehörte, erklärt sich durch die Einwirkung eines besonderen Umstandes. Wie nämlich Schumann selbst in einem Briefe an H. Dorn ausdrücklich bemerkt6, daß Clara Wieck eine Anzahl seiner in der zweiten Hälfte der dreißiger Jahre entstandenen Werke für Pianoforte »beinah allein veranlaßt habe,« so ist hier mit voller Ueberzeugung auszusprechen, daß eben auch sie wiederum den entscheidenden Anstoß zum Erfassen des Gesangliedes gab. Der im Hinblick auf die nahe Verwirklichung seiner Herzenswünsche gesteigerte Seelenzustand Schumann's läßt es erklärlich erscheinen, wenn er nun zum Worte griff, um seinen Empfindungen noch bestimmteren Ausdruck zu geben, als bisher. So ist es denn zur Hauptsache und zunächst eine seelische Feier beglückendster Inbrunst und Liebe, die Schumann, oft hell aufjubelnd und frohlockend, in dem Reich der Lyrik begeht. Es fehlt ihr aber auch nicht ganz jener schmerzliche Zug, der hier und da als ein Reflex erduldeten Wehes und bangen Zweifels durchschimmert. Mit Worten läßt sich das freilich eben so wenig nachweisen, als das Wesen der Liebe an sich darstellbar ist. Doch dem offenen Blick zeigt sich in den, während des Jahres 1840 componirten Liedern erotischen Inhalts, mit denen bezeichnend genug die lange Liederreihe nach Schumann's Compositionsverzeichniß beginnt, das ganze, durch die Gewalt einer edeln Leidenschaft in tiefste Erregung versetzte und entzündete Menschenherz.
Was Schumann als Liedersänger den andern epochemachenden Meistern gegenüber ganz besonders auszeichnet, ist jene edle Gefühlsschwärmerei, die man als eine echt weibliche bezeichnen könnte. Ein glänzendes Beispiel bietet dafür Chamisso's Liedercyklus »Frauenliebe und Leben.« Es sind darin von Schumann die Gemüths- und Seelenstimmungen des liebenden Mädchens, der glücklichen Braut so wie der Gattin in Freud und Leid zu einem so tiefinnigen, lebenswahren und schwärmerisch erregten Ausdruck gebracht, als ob es unmittelbar aus dem liebeerfüllten Herzen einer keuschen Weiblichkeit zu[159] uns spräche, Diesen Ton in solcher Reinheit, Treue und poesieverklärten Wahrhaftigkeit auszusprechen, ist in solchem Maaße wohl keinem andern Meister gelungen.
Der Zahl nach sind es 138 verschiedene Gesangsstücke größeren und kleineren Umfanges, theils für eine Singstimme, theils für's Ensemble, welche im Laufe des Jahres 1840 nach und nach entstanden. Dieselben folgen hier in der Reihe, welche Schumann's Compositionsverzeichniß vorschreibt.
»Liederkreis von Heine op. 24. – Myrthen, vier Hefte op. 25 – 3 Gedichte von Geibel für mehrstimmigen Gesang op. 29. – 3 Gedichte von Geibel op. 30. – Die Löwenbraut, die rothe Hanne, die Kartenlegerin nach Beranger von Chamisso op. 31. – 6 Gesänge für vierstimmigen Männergesang op. 33. – 4 Duette von R. Burns, A. Grün etc. für Sopran und Tenor mit Pianoforte op. 34. – 12 Gedichte von J. Kerner, eine Liederreihe op. 35. – 6 Gedichte von Reinick op. 36. – 12 Gedichte aus Rückert's Liebesfrühling, 2 Hefte op. 377. – 12 Gedichte von Eichendorff [160] op. 398. – 4 Gedichte von Anderson übersetzt von Chamisso und eines aus dem Neugriechischenop. 40. – 8 Lieder aus Chamisso's ›Frauenliebe und Leben‹ op. 42. – 3 Balladen und Romanzen für eine Singstimme mit Pianoforte, 1. Heft op. 45. – ›Dichterliebe,‹ 16 Lieder von H. Heine op. 48. – Balladen und Romanzen 2. Heft op. 49. – Desgleichen 3. Heftop. 53. – ›Belsazar,‹ Ballade von Heine, op. 57. – 3 Duette für zwei weibliche Stimmen op. 43. –
Die vorstehend verzeichneten Gesangs-Compositionen, deren Zahl einen glänzenden Beweis für die reiche, mannichfaltige und schnell gestaltende productive Kraft des Meisters liefert, sind in jeder Beziehung echte Kinder Schumann'schen Geistes. Sie lassen den ganzen innern Menschen mit allen Licht- und Schattenseiten erkennen. Tiefe und Wärme des Gemüths, schwunghafte Inspiration phantastische Versenkung der Auffassung, geistreiche Fälle und poetische Sinnigkeit des Ausdrucks, und eine bis in's Detail gehende, vorzugsweise der Pianofortebegleitung einverleibte, meist sehr glückliche Charakterisirung, – alle diese Eigenschaften finden sich hier in seltenster Vereinigung. Aber auch Barockes, ja, Unschönes läuft mit unter, und man könnte kaum begreifen, wie Schumann als ästhetisch gebildeter Mann, im Stande war, eine prosaische Poesie wie die Heine'sche:
›In Lappland sind schmutzige Leute,
Plattköpfig, breitmäulig, klein,
Die kauern um's Feuer und backen
Sich Fische, und quäcken und schrei'n.‹[161]
oder Burns'
›Ein hochbeglückter Weib als ich
War nicht auf Thal und Höh:
Denn damals hatt' ich zwanzig Küh',
O weh, o weh, o weh!
Die gaben Milch und Butter mir,
Und weideten im Klee,
Und zwanzig Schaafe hatt' ich dort,
O weh, o weh, o weh,
Die wärmten mich mit weichem Vließ,
Bei Frost und Winterschnee.‹9 etc.,
oder auch selbst Gedichte wie die Kartenlegerin, der Schatzgräber, die rothe Hanne, und Nr. 11 in op. 48 in Musik zu setzen, wenn man sich nicht zu vergegenwärtigen hätte, daß seine eigenthümliche Organisation, wie im Leben, so auch in der Kunst, ein Sichbewegen in Extremen nicht allein begünstigte, sondern auch geradezu veranlaßte.
Indessen gebührt Schumann trotz alledem ein Ehrenplatz unter den Großmeistern des Liedes. Denn ganz abgesehen von der hohen geistigen Bedeutung seiner lyrischen Erzeugnisse, hat er auch das deutsche Lied, wie es uns von Beethoven und Franz Schubert überkommen, im Einzelnen mit liebevoller Hingebung weiter ausgestaltet. Er fußt auf beiden genannten Meistern, hat aber bei dem Streben nach innerer Einheit noch einen innigeren, detaillirteren Anschluß an die Einzelmomente des Gedichtes bezweckt und erreicht, und dadurch diese Kunstgattung thatsächlich in bedeutsamster Weise gefördert. Das von ihm hierin Geleistete selbst vollkommen würdigend, schreibt er an Kahlert:10 Meinen Liedercompositionen wünschte ich, daß Sie sich sie genauer ansähen. Sie sprechen von meiner Zukunft. Ich getraue mir nicht, mehr versprechen zu können, als ich (gerade im Lied) geleistet und bin auch zufrieden damit.«
Es wurde vorhin ausgesprochen, daß Clara Wieck den entscheidenden Anstoß zum Erfassen der Lyrik gegeben habe, und daß ihr mittelbar die Entstehung der, im Jahre 1840 componirten Lieder erotischen Inhalts zuzuschreiben sei. Was nun das längere Beharren im Gebiete der Lyrik betrifft, so ist auf die analoge Erscheinung in[162] der ersten Schaffensperiode Schumann's hinzuweisen. Wie dort im Bereiche der Claviermusik das entschiedene, einseitige Festhalten einer besonderen, in Fluß gerathenen Geistesströmung sich offenbart, so zeigt sich auch hier auf lyrischem Boden dieselbe Erscheinung, welche wohl hauptsächlich, wie bereits bemerkt, offenbar mit dem Bestreben zusammenhängt, eine bestimmte Kunstsphäre nach allen Seiten zu durchmessen, und sich formell unterthan zu machen. Das anhaltende Schaffen in der Gattung des Liedes war indeß für Schumann noch mit dem besonderen, nicht hoch genug zu veranschlagenden Vortheil des melodischen Gestaltens verbunden, eines Vortheils, der ihm bei seiner weiteren produktiven Thätigkeit sehr zu Statten kam. Denn durch die längere eindringliche Beschäftigung mit der Vokalcomposition gelangte er zu breiterer, und schärfer ausgeprägter Melodiebildung, kräftigte und läuterte er überhaupt sein ganzes Empfindungsleben. Daß der errungene Vortheil ihm später selbst klar wurde, geht aus einer brieflichen Aeußerung an Reinecke hervor, dem er schreibt: »Zur Ausbildung eignen melodischen Sinnes bleibt immer das Beste, viel für Gesang, für selbstständigen Chor zu schreiben.« Freilich konnte Schumann noch günstigere Resultate für die Vokalcomposition im Besonderen erzielen, wenn er um einen Schritt weiter gegangen wäre, und neben dem Streben nach prägnanter plastischer Durchbildung des Melodischen, zugleich die unabweisbaren Forderungen des Gesangsgemäßen erfüllt hätte. In dieser Hinsicht gewähren aber seine Gesangscompositionen, theilweise keine volle Befriedigung. Hier fehlte ihm die klare Erkenntniß, und der in seinen Schriften niedergelegte Ausspruch: »Von Sängern läßt sich Manches lernen, doch glaube ihnen auch nicht Alles,« beweist, daß er den, nicht gerade auf der flachen Hand liegenden Theil jener Anforderungen, welche das Wesen des Gesanglichen an den Componisten stellt, für unberechtigte Launen der Sänger hielt. Diese Meinung mußte nothwendig durch die, in Schumann's Wesen begründete Eigenschaft, sich gegen gewisse wohlberechtigte, ihm jedoch nicht einleuchtende Ansprüche beharrlich zu verschließen, eine kräftige Stütze erhalten. Er glaubte, um für den Gesang zu schreiben, bedürfe es außer melodischer Gestaltung11 nur noch der Berücksichtigung des Stimmenumfanges einer jeden Stimmgattung;[163] im Uebrigen habe sich der Sänger den Intentionen des Componisten, die als rein Geistiges höher ständen, zu fügen. So wahr dies Letztere nun auch in einem gewissen Sinne ist, so darf doch nur derjenige, welcher das Wesen der Gesangskunst durchaus studirt hat, sich mit Entschiedenheit und Nachdruck darauf stützen.
Schumann's Kenntniß des vokalen Elementes war indessen für jenes freie Schalten und Walten, wie es die Werke Händel's, Mozart's, und in der Neuzeit auch Mendelssohn's erkennen lassen, nicht völlig ausreichend. Lieder wie z.B. Nr. 1 in op. 25 (Widmung), Nr. 1 in op. 36 (Sonntags am Rhein), Nr. 9 in op. 37, Nr. 4 in op. 39 (Waldesandacht), Nr. 4 in op. 40 (der Spielmann), Nr. 15 in op. 48 und Nr. 2 in op. 53 veranschaulichen das Gesagte. Es zeigt sich in ihnen ein plötzlicher, die Stimme ermüdender und irritirender Wechsel, bald hoch bald tief liegender gesanglich unvermittelter Perioden.
Einen weiteren Mangel genügender Erkenntniß bekundet Schumann in der Art und Weise, wie er für bestimmte Stimmgattungen schreibt, und wären in dieser Hinsicht beispielsweise die Gesänge Nr. 2 in op. 35 und Nr. 6 in op. 36 als Belege anzuführen; sie sind ausdrücklich dem »Tenor« zugedacht, liegen aber für einen solchen im Ganzen zu tief, und können daher nicht recht zur Wirkung gelangen. Dieselbe Bewandtniß hat es theilweise mit der Tenorpartie in »Paradies und Peri«, sowie mit der Sopranpartie in dem dritten Theil der Faustscenen, anderer Beispiele nicht zu gedenken. Wenn aber Schumann in einzelnen Fällen vorschreibt: »Mezzosopran oder Alt«, und »Tenor oder Baryton«, so dürfte dies wohlgeeignet sein, den ihm eigenen Standpunkt in Sachen des Gesanges zu bezeichnen.
Otto Jahn sagt in seiner Biographie Mozart's treffend: »Daß der Gesang heutzutage nicht mehr der Ausgangspunkt der musikalischkünstlerischen Bildung zu sein pflegt, ist schwerlich als ein günstiger Umstand anzusehen.« In diesem Ausspruch liegt der Schlüssel zur Erklärung der Unzulänglichkeit, welche Schumann's Vokalcompositionen hinsichtlich der Handhabung des rein gesanglichen Theiles wahrnehmen lassen. Diese Unzulänglichkeit eben findet ihren Grund in den Umständen, unter welchen er die Singstimme in den Bereich seiner schöpferischen Thätigkeit hineinzog.
Schumann war, wie man gesehen, am Clavier aufgewachsen, und hatte während einer Reihe von Jahren fast ausschließlich für dieses,[164] ja, ohne Ausnahme an diesem Instrument geschaffen. Statt der Singstimme gab ihm dieses die wesentlichen Haltpunkte für die Vokalcomposition, und somit ist es erklärlich, daß die erstere, deren Natur er nicht durchaus studirt hatte, durch ihn manchmal eine instrumentale, claviermäßige Behandlung erfuhr. Es wird deshalb die große Mehrzahl seiner Lieder freilich nicht weniger gesungen werden, wie dieselben denn vermöge ihres herrlichen Gehaltes ja auch nur herzerfreuend, erhebend und gemüthveredelnd wirken können. Allein trotzdem darf der Wunsch nach entsprechender Berücksichtigung des feinsten und zartesten Organes, welches die Tonkunst in der menschlichen Stimme besitzt, nicht unterdrückt werden.
Die weiterhin noch in großer Anzahl entstandenen, und theils für Solostimmen, theils für den Chor geschriebenen Liedercompositionen sind im Wesentlichen von derselben Beschaffenheit, wie die eben Besprochenen; nur erreichen sie diese, vereinzelte Ausnahmen abgerechnet, hinsichtlich des Schwunges und der Gefühlstiefe nicht wieder.
Mit dem Jahre 1841 tritt Schumann als schaffender Musiker abermals in eine neue Phase der Entwickelung; er wendet sich zurück zur Instrumentalmusik, aber in einem andern Sinne, als er sie verlassen. Während er nämlich vorher mit Ausschluß von einigen, der Sonatenform angehörenden Werken vorzugsweise das Streben erkennen läßt, neugestaltend aufzutreten, läßt er jetzt, das symphonische Element ergreifend, ein hingebendes und ausdauerndes Anschließen an die überkommenen Formen der Instrumentalmusik erkennen. Diese Reaction ist ganz erklärlich; einem so bedeutenden Geiste, wie Schumann, konnten die bisher erlangten Erfolge im Gebiete der Instrumentalcomposition nicht mehr ganz genügen. Schon im Jahr 1839 schreibt er an H. Dorn: »– – – und dann giebt es nur Symphonieen von mir zu verlegen und zu hören. Das Clavier möcht ich oft zerdrücken, und es wird mir zu eng zu' meinen Gedanken. Nun hab ich freilich im Orchestersatz noch wenig Uebung; doch denke ich noch Herrschaft zu erreichen.«12
Aber nicht allein die Unzufriedenheit mit der Mehrzahl jener, auf der früher eingeschlagenen Bahn erzielten Resultate erklärt die plötzliche Umkehr zu dem Ueberkommenen. Schumann hatte erkannt, daß, um mit Freiheit schaffen zu können, erst formelle Beherrschung[165] erlangt sein müsse. Hierauf bezüglich schreibt er später an L. Meinardus: »Wenn man in freien Formen schaffen will, so muß man erst die gebundenen für alle Zeiten gültigen Formen beherrschen.« Und hier möchte der Einfluß Mendelssohns, überhaupt vielleicht der einzige dieses Künstlers auf Schumann, erkennbar sein; denn daß bei Beiden hier und da verwandte Elemente zu Tage treten, ist nur als eine Folge ihrer Zeitgenossenschaft aufzufassen, – eine Erscheinung, die mehr oder minder bei allen andern gleichzeitig lebenden Componisten wahrnehmbar ist. Im Wesentlichen waren und blieben beide Meister sich selbst treu.
Es ist begreiflich, daß eine Künstlernatur, wie die Mendelssohns, Schumann imponirte und beziehentlich zur Nacheiferung anspornte, denn gerade das, was ihm theilweise mangelte, wonach er Jahre lang unaufhörlich gerungen hatte, fand er bei Mendelssohn als Haupteigenschaft im vollsten Maaße: formelle Vollendung. Sehr natürlich ist es daher, daß Schumann endlich noch gegen seine ursprüngliche Ansicht, eine Beherrschung des Formellen auf dem Wege zu erlangen suchte, auf dem Mendelssohn sie, gleich allen andern Koryphäen der Kunst gefunden hatte, nämlich im Anschluß an die Meisterwerke der Vergangenheit. Wie überraschend ihm dies sofort gelang, beweist die erste in solchem Sinne unternommene künstlerische That: die B-dur Symphonie op. 3813. Mit ihr beginnt in Schumann's schöpferischer Laufbahn eine Reihe verschiedenartiger Instrumentalwerke, welche in ihrer meisterlichen Haltung großentheils unstreitig zu den werthvollsten und genußbringendsten Compositionen gehören, die er überhaupt geschaffen. Und noch mehr. Schumann erwarb sich durch einen Theil seiner im Laufe der vierziger Jahre entstandenen zahlreichen Werke jenes Ansehn, das ihm neben den größten Meistern deutscher Kunst eine hervorragende Stellung anweist, – ein beneidenswerthes Loos, welches er keineswegs allein seiner reichen Begabung, sondern ebensosehr dem unermüdlichen Streben verdankte, sich den Kunststoff unterthan zu machen.
Was die so eben erwähnte erste der im Jahr 1841 entstandenen Orchestercompositionen anlangt, so hatte unser Meister ursprünglich[166] im Sinne, sie als »Frühlingssymphonie« zu betiteln. Auch die einzelnen Sätze sollten mit Ueberschriften versehen werden. So waren für das erste und letzte Stück die Bezeichnungen »Frühlingserwachen« und »Frühlingsabschied« beabsichtigt. Aehnliche Epitheta hatte Schumann auch den beiden Mittelsätzen zugedacht. Bei der Herausgabe des Werkes sah Schumann indessen von diesen Benennungen gänzlich ab. Er wollte den Geist der Composition frei wirken lassen, und hat insofern Recht darin gehabt, als derselbe an sich sprechend genug ist, um auch ohne derartige Fingerzeige verständlich zu sein. In der That wird jeder Einsichtsvolle zugeben, daß das Werk unverkennbar eine Stimmung in sich trägt, welche geeignet ist Lenzesempfindungen zu erwecken. Und ähnliche Gefühle beseelten Schumann offenbar, als er die B-dur-Symphonie schrieb. War doch nach einer düster umwölkten Vergangenheit endlich der sehnsüchtig erwartete Sonnenschein des Lebens bei ihm zum Durchbruch gekommen, – war er doch nach langen, harten Stürmen und Kämpfen nunmehr an der Seite eines über Alles geliebten Wesens in den Hafen der Ruhe eingelaufen. Sein Herz jauchzte auf vor Freude. Der ganzen Welt mußte er verkünden, daß es endlich Frühling geworden in seinem Innern.
Gleich einem Heroldsruf kommt dies sofort in den ersten Takten der fraglichen »Tondichtung« zum entschiedenen Ausdruck. In schmetternden Hörner- und Trompetenklängen schallt es hinaus, was sein vom Druck der Verhältnisse befreites Gemüth bewegt: es ist der Kern des Hauptthema's vom ersten Allegro, mit dem die genannten Instrumente siegesbewußt auftreten. Das ganze Orchester wiederholt den Ruf, mit Ausnahme der beiden ersten Hörner, sowie der Posaunen und Pauken, die aber einen Takt später mit einstimmen. Ein kleines Motiv wehmüthigen Ausdrucks, beantwortet von markigen Akkordschlägen, schließt sich in zweimaliger Wiederholung an. Dann erscheint das erste Glied des Thema's in den Holzblasinstrumenten, lieblich wie lindes Frühlingswehen. Und nun leitet ein Accelerando in's Allegro hinüber, in welchem sich ein heiter bewegtes Leben entfaltet. Das treibt und wächst so lustig aus dem kleinen fast unscheinbaren Anfangsmotiv hervor, wie das keimende und hervorsprießende junge Grün in Wald und Flur, – eine echte Frühlingsstimmung. Zwar in der Durchführung, bald nach Beginn des zweiten Theiles, werfen trübe Erinnerungen ihre dunkelen Schatten über das lachende Bild, aber doch nur für Augenblicke. Alsbald bricht wieder[167] der volle Sonnenschein hervor: in heiterer Stimmung geht es weiter, und durch die gefühlswarme, innig empfundene Coda zum Schluß, welcher sich in der fanfarenartigen Achtelfigur der Fagotten, Hörner und Trompeten bis zum höchsten Jubel steigert. Mit guter Wirkung ist der Idee dieses Satzes entsprechend, im zweiten Theil desselben der Triangel benutzt. Das ganze Stück athmet Grazie, Anmuth und Frohsinn in einem Maaße, wie es eben nicht häufig in Schumann's Compositionen der Fall ist.
Des zweite langsame Satz, Larghetto betitelt, lehnt sich an die im Vorhergehenden entwickelte Stimmung an, indem er sie nach Seite einer gemüthvoll vertieften Beschaulichkeit zum Ausdruck bringt. Auch hier verdunkelt sich im Verlaufe des Satzes, gleich nachdem die schöne Anfangsmelodie von den Violoncellen gespielt worden ist, einmal das Tongemälde: doch bald gewinnt die warme, innige Empfindung, von welcher der ganze lyrische Erguß erfüllt ist, wieder die Oberhand.
Sehr sinnig und geschmackvoll hat Schumann die Hauptcantilene – ein eigentliches zweites Thema ist nicht vorhanden, da das kleine Motiv des beim 25. Takt beginnenden Seitensatzes lediglich aus der Umkehrung des 13. und 14. Taktes besteht – zu behandeln gewußt. Zuerst erscheint sie in der ersten Violine, getragen von begleitenden Streichinstrumenten, zu denen sich weiterhin melodieverstärkende und harmoniefüllende Bläser gesellen; sodann tritt sie in den Violoncellen mit einer duftig zarten Begleitung von Blasinstrumenten auf, zu welcher die ersten Geigen mit den Bässen im Pizzicato erklingen, während die zweiten Geigen und Bratschen durch eine auf- und abwogende Figur die Bewegung im Fluß erhalten. Und endlich wird sie zum dritten Mal von der Oboe und dem Horn, in lieblicher Figuration von Geigen und Violen umspielt, vorgetragen. Alsdann folgt die sanft auslaufende Coda, an deren Ende unerwartet die feierlich erklingenden Posaunen auftreten, um das Motiv des folgenden Satzes anzudeuten. Einen wirklichen Schluß hat das Larghetto nicht. Mit kurzer modulatorischer Wendung wird der Dominantdreiklang vonG-moll ergriffen, welcher unmittelbar in das mit zwei Trio's versehene und in D-moll stehende Scherzo hinüberführt.
Dieses beginnt in leidenschaftlicher Bewegung und entsprechender kräftiger Rhythmisirung, ist aber in seinem weiteren Verlaufe in scharf entgegengesetzten Contrasten gehalten, da zu Anfang des zweiten[168] Theiles heiter frohlockende Weisen ertönen, welche jedoch bald wieder von der Grundstimmung abgelöst werden.
Das erste der beiden Trio's, dessen gleichmäßig springender Rhythmus die Erinnerung an das Hauptthema des ersten Satzes zurückruft, ist ein reizender Tonsatz, in welchem Bläser und Streicher auf originelle Art miteinander in kurzen Phrasen alterniren, was übrigens bei dem äußerst schnellen Tempo – der Dirigent muß ganze Takte markiren – für eine entsprechende Wiedergabe nicht ohne Schwierigkeiten ist. Von eigenthümlicher Wirkung erweist sich dabei die im Verlaufe des Stückes auftretende, und wie ein zart geflochtenes Band sich durch den 2/4 Takt hindurchziehende Triolenbewegung. Das ganze Trio hat etwas ungemein Phantastisches; man könnte fast glauben, daß dem Componisten bei der Conception desselben folgende Worte Faust's vorgeschwebt haben:
»Wie alles sich zum Ganzen webt,
Eines in dem andern wirkt und lebt!
Wie Himmelskräfte auf- und nieder steigen
Und sich die goldnen Eimer reichen!
Mit segenduftenden Schwingen
Vom Himmel durch die Erde dringen
Harmonisch all' das All durchklingen!«
Nachdem das Scherzo ganz in der erstmaligen Weise wiederholt worden, tritt das zweite Trio ein, welches mit Ausnahme der letzten acht Takte durchweg aus der, schon im ersten Satz vorkommenden Skala nebst deren Umkehrung aufgebaut ist. Es erfolgt die abermalige Wiederholung des Scherzo's, doch in wesentlicher Abkürzung. Auf überraschende Art wird schon nach sechzehn Takten die im hellenD-dur stehende Coda eingeführt, welche mit feinsinnigen Beziehungen auf das Vorhergegangene den Satz in originellster, aber durchaus ungezwungener Weise zu erfreuendem Abschluß bringt.
Das Finale beginnt mit einigen einleitenden Takten, deren Kern, in rhythmischer Beziehung auf das gegen Schluß des ersten Theiles auftretendeF-dur-Motiv hindeutend, in der Skala besteht, welche auch in diesem Satz wiederum als wesentliches Glied der Entwickelung erscheint. Der Grundzug dieses Stückes entspricht hinsichtlich der Stimmung dem ersten Allegro der Symphonie; es ist eine stellenweise bis zum Uebermuth gesteigerte Fröhlichkeit, die dann aber auch hier und da von ihrem Gegensatz abgelöst wird. Am stärksten tritt der letztere in der sogenannten Durchführung hervor, welche ganz und[169] gar auf der geistvollen Benutzung des so eben erwähntenF-dur-Motiv's, (es ist das zweite Thema des Satzes) beruht. Das Streichquartett ist dabei tremolirend in wirkungsvoller Weise thätig; erst pp und in kurzen Absätzen, zwischen denen das gedachte Thema theilweise oder ganz in den Holzblasinstrumenten erscheint, – sodann aber unausgesetzt in einem langen, von dem erschütternden Ruf der Posaune angekündigten Crescendo mit thematischer Beziehung, während Blasinstrumente langgedehnte Töne aushalten, um dann schließlich wieder auf jenes Thema zurückzukommen. Es ist, als ob ein angstvoll banger Traum herauf- und vorüberzieht. Doch der verdüsterte Horizont hellt sich wieder auf. Mild beruhigend und versöhnend ertönt der Hörner Klang mit der Flöte, und eine anmuthige Cadenz der letzteren führt wieder zum ersten Thema zurück, dem alsdann die entsprechende Fortsetzung folgt. Und nochmals taucht weiterhin das düstre Bild bedrohlich auf, welches uns der Tondichter in der Durchführung gezeigt hat: aber es vermag die rauschenden Klänge der Lebensfreudigkeit nicht mehr zu verdrängen, und glanzvoll aufleuchtend schließt das Werk, wie es begonnen.
Die B-dur-Symphonie in ihrer Totalität, hinterläßt entschieden den Eindruck einer Schöpfung, welche bedeutungsvoll Erlebtes in tondichterischer Sprache zu beinahe greifbarem Ausdruck bringt. In diesem Sinne könnte man, wie Schumann es selbst in Betreff der Schubert'schen C-dur-Symphonie gethan14, sehr wohl von dem »novellistischen Charakter« des fraglichen Kunstgebildes sprechen. Daß dieser Charakter sich nicht auf Kosten der Gesammtdarstellung geltend macht, sondern in wohlgestalteten und knapp gehaltenen Formen sich ausspricht, verleiht dem Werke einen dauernden Kunstwerth.
Schumann hat das Wesen des Symphonischen, auf dem Studium der Meisterwerke dieser Gattung fußend, mit eigenthümlichem Geist erfaßt und behandelt. Wenn demgemäß der Inhalt dieser seiner Werke als ein echt Schumann'scher bezeichnet werden muß, so läßt sich doch nicht verkennen, daß ihm bei Gestaltung derselben insbesondere Beethoven's Kunst vorgeschwebt hat, und dies zunächst in formeller Beziehung. Indessen unterscheidet er sich hierbei in einem Punkt wesentlich von seinem hohen Vorbilde. Es betrifft die Durchführung des sogenannten, von Haydn vervollkommneten Sonatensatzes, wie er[170] sich hauptsächlich in dem ersten Stück der höher stylisirten Instrumentalmusik manifestirt. Derselbe besteht, wie allgemein bekannt, aus drei in ein und demselben Tonstück aufs Engste miteinander verbundenen Theilen. Zwei dieser Theile, nämlich der erste und dritte, correspondiren nach Form und Inhalt miteinander. Zwischen ihnen liegt die Durchführung, welche gewöhnlich aus einem der im ersten Theil auftretenden Themen (oder auch aus beiden vereint) im Wege der contrapunktisch imitatorischen Gestaltung entwickelt wird. Den Modus für diese Durchführung hat Haydn insofern erfunden und normirt, als er der erste Tonmeister war, der sich in Betreff der mittleren Abtheilung des Sonatensatzes jener Behandlungsmethode bediente, die man mit dem technischen Ausdruck als »thematische Arbeit« bezeichnet.
Mozart befolgte in der angedeuteten Beziehung Haydn's Verfahren, und nach ihm nicht minder Beethoven, der die »thematische Arbeit« in der Durchführung seiner Symphonien insbesondere zum Gegenstande tiefsinniger Combinationen machte. Die bewundernswerthe Verwendung der Motive zu immer wieder sich neu gestaltenden Tonbildern in stetig gesteigertem architektonischen Aufbau, verleiht seinen Schöpfungen eine ganz besonders hohe Bedeutung.
Anders verfährt Schumann in seinen Durchführungssätzen. Dieselben sind unter Benutzung der Themen des ersten Theiles, zur Hauptsache aus größeren in sich abgeschlossenen Perioden gebildet, welche mittelst Transposition in andern Tonarten entweder ganz oder theilweise wiederholt werden. Diese Manier, welche unser Meister wie es scheint, von Franz Schubert entlehnt hat15, findet sich mehr oder minder in fast allen größeren Instrumentalwerken Schumann's vor. Sie tritt uns vornehmlich in der B-dur-, D-moll- und C-dur-Symphonie, im Clavierquintett, und bis zu einem gewissen Grade auch in den Streichquartetten entgegen. Am stärksten ist aber das bezeichnete Verfahren wohl in der D-moll-Symphonie ausgeprägt. Hier bringt die Durchführung einen weit ausgestalteten Tonsatz von 74 Takten, der unmittelbar darauf eine kleine Terz höher repetirt wird, was denn doch trotz aller Schönheit der betreffenden Musik einigermaßen monotonieerzeugend wirkt.
Die D-moll-Symphonie, welche man hinsichtlich ihres Charakters[171] als das Gegenstück des vorher besprochenen Werkes bezeichnen könnte, ist der Entstehungszeit nach die zweite in der Reihe ihrer Schwestern, weshalb die Besprechung derselben gleich an dieser Stelle erfolgen möge. Sie rührt ebenfalls aus dem Jahr 1841 her, erhielt indessen erst nach Ablauf eines vollen Decenniums ihre jetzige Gestalt. Gleich wie die B-dur-Symphonie besteht sie aus vier, in formeller Hinsicht durch knappe und klare Gliederung sich auszeichnenden Sätzen, die unmittelbar in einander übergehen, und also ohne irgend welche Unterbrechung gespielt werden müssen. Zu dieser Anordnung wurde Schumann vielleicht durch die kurze Romanze (an Stelle des langsamen Satzes) veranlaßt, wenn nicht etwa das Streben nach größerer formeller Abrundung dazu geführt hat.
Dies Verfahren steht übrigens nicht vereinzelt in der Musikliteratur da. Mendelssohn fordert für seine,A-moll-Symphonie gleichfalls die unmittelbare Aufeinanderfolge der vier Sätze; wobei jedoch zu bemerken ist, daß er die einzelnen Stücke vollständig abgeschlossen, mithin der Möglichkeit Raum gegeben hat, zwischen denselben Ruhepausen eintreten zu lassen, – eine nicht zu verkennende Annehmlichkeit für den Zuhörer.
Die instrumentalen Abänderungen, welche Schumann der, kurz nach ihrer Niederschrift am 6. December 1841 in Leipzig zur Aufführung gebrachten, dann aber bis zum Jahre 185116 unbenutzt gebliebenenD-moll-Symphonie angedeihen ließ, beziehen sich auf die Blasinstrumente. Das Streichquartett wurde im Wesentlichen beibehalten, wie es ursprünglich geschrieben war.17 Außerdem kam ein Instrument, welches in der Romanze dem ersten Entwurf gemäß eine Rolle spielen sollte, in Wegfall: die Guitarre. Schumann mochte sich bei der ersten Leipziger Aufführung davon überzeugt haben, daß dieses dürftige[172] Tonwerkzeug den andern Orchesterinstrumenten gegenüber nicht zur Geltung zu bringen sei.
Das erste Allegro des Werkes unterscheidet sich in formeller Beziehung dadurch von dem Herkommen, daß der erste Theil desselben, welcher im Wesentlichen aus der im ersten Takt auftretenden Sechzehntheilfigur entwickelt ist, kein deutlich hervortretendes Seitenmotiv hat. Ein zweites, gesanglich schön wirkendes Thema erscheint erst im Verlaufe der Durchführung, also im zweiten Theil dieses Satzes.
Dem Ganzen ist eine kurze, spannende Einleitung vorangestellt. Sie kündigt sich gleich einem festen Entschluß, mit dem vom ganzen Orchester – nur die Posaunen pausiren – im kräftigen Unisono angeschlagenen A als Dominant der gewählten Haupttonart an. Im Diminuendo bis zum Pianissimo verhallend, geht dieses A in eine sanft auf- und absteigende Achtelfigur von fastwehmüthig bittendem Charakter über. Doch schon nach wenigen Takten rafft die herabgestimmte Empfindung sich wieder auf, und in jähem Wechsel erklingt nochmals das A nebst der Wiederholung der sich daranschließenden und bereits einmal vernommenen Takte. Die Bitte steigert sich, wird dringlicher, und indem sie wieder nachläßt, tritt das geschwungene Sechszehntheil-Motiv des ersten Satzes in der Primgeige auf. In beschleunigtem Zeitmaaß treibt dasselbe dem Allegro zu, bei dessen Eintritt es in wuchtiger Bewegung unaufhaltsam fortstürmt. Es ist ein düster bewegtes Gemälde, welches der Tondichter hier vor unsern Sinnen entfaltet, eindringlicher noch wirkend durch den prononcirten Rhythmus. Dringt auch hier und da ein Lichtblick durch das düstere Gewölk, wie bei der im zweiten Theil wiederholt auftretenden lieblich beruhigenden Cantilene, so waltet doch der tief ernste, stellenweise sogar ins Dämonische hinübergreifende Ausdruck entschieden vor. Und selbst der aus den beiden Hauptmotiven des Satzes gebildete Schluß, welcher die düstere Stimmung verdrängend, etwas Triumphirendes hat, vermag sich noch nicht so recht zum vollen ungebundenen Frohsinn zu erheben.
Dieser Kampf zwischen den zwei angedeuteten Gegensätzen wiederholt sich, obwohl auf modificirte Art, in den beiden folgenden Sätzen. Mehr aber schon wie im ersten Stück gelingt es dem Tondichter, sich von dem auf seinem Gemüth lastenden Druck in der folgenden Romanze zu befreien, in deren träumerisch schwermüthige, dabei aber doch zum Herzen gehende Weisen sehr entsprechend ein Theil der[173] oben betrachteten Einleitung verwoben ist. Denn wahrhaft tröstend und erquickend, läßt sich alsbald eine Solovioline vernehmen, welche beim Eintritt des D-dur-Satzes den aus dem Einleitungsmotiv weiter entwickelten Gedankengang in anschmiegender Figuration lieblich umspielt.
Aber auch damit ist der Sieg über die finsteren Gewalten nicht errungen, die vielmehr nochmals ihre Macht im Scherzo zu behaupten suchen. Besänftigend, lindernd, tritt das dazu gehörige Trio mit seinen zart bewegten, dem leichtbeschwingten Vogelfluge vergleichbaren Linien ein. Sehr schön ist bei der Wiederholung dieses B-dur-Satzes dessen allmählige Auflösung und Verflüchtigung gedacht.
In das duftige Verklingen dieses reizenden Tonspieles mischt sich unerwartet und plötzlich ein ernstes Element. Es ist jenes Sechszehntel-Motiv des ersten Satzes, welches hier wieder auftaucht. In ruhig gemessener Haltung bewegt es sich durch verschiedene Positionen, begleitet von tiefliegenden und im Tremolo erzitternden Harmonien unter schmetternden Rufen der Blechinstrumente, – ein spannender Moment, dem die schönste und für das Gefühl wohlthuendste Lösung durch den schnellkräftigen und siegesbewußten Eintritt des Finale zu Theil wird. Der Anfang desselben ist aus den letzten Takten des ersten Satzes mit Hinzufügung einer kurzen, scharf markirten Achtelfigur gebildet, aus welcher sich im Verein mit anderen, neu eingeführten Motiven der ganze Satz des Weiteren in schlanker, lebendiger und eindringlicher Weise entwickelt. Also auch hier wird wieder auf schon Bekanntes zurückgegriffen, so daß die einzelnen Sätze der D-moll-Symphonie einen organischen Zusammenhang untereinander aufweisen, der das Ganze wie aus einem Guß erscheinen läßt.
Das prächtige Werk erinnert trotz seiner geistigen Selbstständigkeit in mehr als einer Beziehung an Beethoven, wie denn Schumann überhaupt dem Großmeister der Symphonie um Vieles näher steht, als die andern hervorragenden Tonsetzer der Neuzeit. Namentlich ist es das Zwingende und Beherrschende seiner Gedankenkraft, was man als einen dem Wesen Beethoven's geistesverwandten Zug bezeichnen könnte. Hier liegt auch die unwiderstehliche Macht seiner Individualität, welche uns im Augenblicke des Genusses jene Bedenken völlig vergessen läßt, die bei ruhiger Betrachtung einiger der größeren Werke des Meisters erregt werden.
Was speciell seine ersten beiden Symphonien anlangt, so macht[174] sich in denselben eine Behandlung der Instrumente fühlbar, die stellenweise entschieden dem Claviersatz angehört und daher auch mitunter dem Charakter einzelner Tonwerkzeuge entgegensteht. Indessen nicht allein das bisweilen Unpraktikable der Instrumentenbehandlung wäre hervorzuheben, sondern auch die mehrfach in Schumann's Orchesterwerken zum Vorschein kommende sehr dunkle und sogar trübe Klangwirkung. Diese findet mit ihren Grund in der Ausdehnung des Modulationskreises auf die fernliegenden B- und Kreuztonarten, welche einer offenen, hellen und glänzenden Tongebung hinderlich sind, weshalb denn auch nicht selten Schumann's Toncolorit mehr charakteristisch als schön im euphonischen Sinne erscheint. Daß aber diese beiden Eigenschaften sich sehr wohl miteinander vereinigen lassen, zeigen uns die Instrumentalwerke der Heroen. Auch an dem rechten Maaß im Gebrauch der orchestralen Mittel läßt es Schumann in einzelnen Fällen fehlen. Es sei nur auf die D-moll-Symphonie hingewiesen, in welcher hier und da ein unverkennbares Mißverhältniß zwischen dem Streichquartett und den Blechinstrumenten besteht. Nichts desto weniger ist und bleibt es bewundernswerth, wie überraschend schnell Schumann den ihm im Hinblick auf seine vorhergehende schöpferische Thätigkeit so gut wie völlig unbekannten Orchestersatz im Ganzen und Großen zu erfassen und zu bewältigen wußte. Auch in formeller Hinsicht zeigen die beiden ersten Symphonien einen sehr bedeutenden Fortschritt. Ganz zweifellos ist es, daß für den Meister hierbei die hingebende Beschäftigung mit der Liedcomposition während des Jahres 1840 von wesentlichstem Nutzen war.
Zwischen die beiden besprochenen Symphonien ist der Entstehungszeit nach noch ein drittes größeres Instrumentalwerk, betitelt: »Ouvertüre, Scherzo und Finale«, (op. 52)18 einzureihen, welches sich in seiner Umgebung ausnimmt, wie ein geistreiches, sorgfältig ausgeführtes Genrebild inmitten zweier großstylisirter Gemälde. Die Motive desselben sind anmuthig, aber in ihrem knappen Zuschnitt eben nicht bedeutend, wie denn auch das Ganze in seiner Gesammtgestaltung nicht hervorragend ist. Den anziehendsten Theil bildet jedenfalls das originelle, aus einer kurzen punktirten Figur entwickelte Scherzo mit seinem graziösen Trio. Nach diesem Satz kann das Finale, welches[175] im Jahre 1845 einer Umarbeitung unterzogen wurde, keine Steigerung mehr ergeben.
Ohne Frage steht diese Schöpfung in ihrer Totalität gegen die übrigen symphonischen Gebilde Schumann's zurück; allein trotzdem läßt sie überall die Hand des Meisters erkennen.
Gleichzeitig mit den drei Orchesterwerken machte Schumann noch den unvollendet gebliebenen Entwurf zu einer Symphonie in C-moll: es zeigt sich also auch hier wiederum das Beharren in einer bestimmten Kunstthätigkeit. Ein späterer Versuch die betreffende Skizze auszuführen, war leider vergeblich, da Schumann seinen Aeußerungen zufolge sich nicht mehr in dieselbe hineinzufinden vermochte.
Außerdem entstanden im Laufe des Jahres 1841 noch ein, weiterhin als erster Satz zum Clavierconzert (op. 54) benutztes Allegro, ferner eine Composition für Gesang zur »Tragödie« von Heine »mit Orchesterbegleitung«,19 wie Schumann's Compositionsverzeichniß ausdrücklich besagt, und endlich einige kleine Clavierstücke, die später als Nr. 4, 12 und 13 inop. 99, sowie als Nr. 16 in op. 124 zur Veröffentlichung gelangten.
Durch seine vorstehend betrachteten symphonischen Werke löste Schumann das Problem, Eigenthümliches und Bedeutendes in einer schon völlig ausgestalteten, und bis zur Spitze entwickelten Kunstgattung zu schaffen20.
Ganz dieselbe Bewandtniß hat es auch mit seinen im folgenden Jahre componirten Kammermusikstücken. Diese bestehen speciell in den drei Streichquartetten (op. 41), in dem allbekannten, überall mit ungetheiltem Enthusiasmus aufgenommenen Quintett (op. 44), so wie in dem Quartett (op. 47) für Pianoforte und Streichinstrumente.[176]
Das Clavierquintett nimmt nicht allein unter den Schumann'schen Geistesprodukten einen sehr hohen Rang ein, sondern überhaupt, unter allen gleichartigen Werken seiner Zeitgenossen bis zu der Markscheide hinauf, welche die neuere Musik von der sogenannten »klassischen«, mit Beethoven schließenden Periode trennt. Es ist ohne Bedenken sogar als das bedeutendste, seit Beethoven's Erscheinung entstandene Kunstwerk im Kammerstyl zu bezeichnen. Denn bei aller Gedrängtheit, Geschlossenheit und Abrundung der Form, die hier wie ein schönes, kleidsames, eine edle Gestalt umhüllendes Gewand erscheint, birgt es eine so reiche Kraft und Originalität der Erfindung, einen so kräftigen und kühnen, und doch nirgend extravagirenden Aufschwung, eine so glückliche Polarisation aller, zur Gestaltung des wahren Kunstwerkes erforderlichen Kräfte und Faktoren in sich, wie keine zweite derartige Composition der Neuzeit. Was diesem Tonstücke aber noch als ein ganz besonderer Vorzug angerechnet werden muß, ist der Umstand, daß der von vornherein genommene Aufschwung sich durch alle vier Sätze ebenmäßig in steter Steigerung fortsetzt. Ja, am Schlusse des Finale's, da man die Kraft des Componisten endlich erschöpft glauben könnte, gipfelt sich das Ganze noch in bedeutsamer Weise durch die geistvolle Combinirung der beiden in verwandtschaftlicher Beziehung zu einander stehenden Hauptmotive des ersten und letzten Stückes in strenger Durchführung. So gewährt dies Werk gleichsam das Bild eines Wanderers, der durch die blühend reiche, am Bergeshange sich ausbreitende Landschaft dahinziehend, immer höher steigt, um sich auf der Spitze des Gipfels umschweifenden Blickes noch einmal der Betrachtung des zurückgelegten Weges zu erfreuen. In diesem Kunstwerke treffen die höchsten Bedingungen künstlerischen Schaffens zusammen. Begeisterte Inspiration, schwunghafter Ausdruck, schön beherrschte Leidenschaft, Noblesse der Empfindung, Reichthum der Phantasie, Frische und Gesundheit der Stimmung, und vollendete Durchführung zeichnen es in seltenem Grade aus.
Ganz besonders fesselnd ist der erste Satz durch die in ihm sich vollziehende thematische Arbeit. Das ganze Stück ist fast allein aus dem ersten, so entschieden wie urkräftig auftretenden Motiv gebildet; man muß staunen, welche Mannichfaltigkeit der Erscheinungen aus demselben abgeleitet ist. Darin aber zeigt sich die wahre Bedeutung der poetischen Gestaltungskraft, einen Gedanken in wechselnder Metamorphose fortwährend unter anderen, immer wieder neu erscheinenden[177] Gesichtspunkten und Beleuchtungen vorzubringen, ohne den Hörer irgendwie zu ermüden. Auch das Scherzo bietet einen merkwürdigen Beleg dafür; es ist einzig und allein aus einer geistvollen Benutzung der Skala gleichsam hervorgezaubert, – ein äußerst belebtes, geistsprühendes Tonbild, zu welchem die originellen und phantastischen Trio's einen wirksamen Contrast bilden. Diesem Stück geht der langsame, in marschartigem Character beginnende und schließende Satz mit seiner wehmüthig süßen Melodie des Maggiore und dem leidenschaftlich erregten Agitato voraus. Das mehrentheils humoristisch gehaltene Finale beschließt dies herrliche Werk.
Nicht so durchaus körnig und gedrungen, nicht so aus dem Vollen geschnitten wie das Quintett, ist das Clavierquartett (op. 47). Allein es entschädigt dafür durch mancherlei Feinheiten des Detail, die wiederum jenem Werke nicht in gleichem Maaße eigen sind; wie denn überhaupt beide Tonschöpfungen, den gleichartig angelegten Schluß der Finale's ausgenommen, ihrem Wesen nach sich als grundverschieden von einander erweisen. Wenn das Quintett, namentlich in den drei ersten Sätzen etwas ausgesprochen Heroisches hat, so ergeht sich das Quartett in einem von wohlthuender Wärme und Lebendigkeit durchdrungenen Charakter, der als ein zwischen den verschiedenartigen Gefühlstonarten gleichsam schwebender zu bezeichnen sein dürfte. Jedenfalls ist das Clavierquartett eine höchst werthvolle Bereicherung der Kammermusik von bleibendem Werth.
Dasselbe gilt auch von den drei Streichquartetten, die, obschon sie sich theilweise von den durch Haydn gegebenen Normen des Quartettstyls entfernen, dennoch durch, Originalität und Reichthum der Erfindung ungemein fesselnd wirken.
Am gelungensten und zugleich ergiebigsten für den Genuß, sind wohl in allen dreien Compositionen die beiden mittleren Sätze. Dieselben enthalten seltene Kostbarkeiten der Kunst. Vor Allem aber sind die As-dur-Variationen21 des zweiten Quartetts von hervorragender Bedeutung, wenn auch die Ausführung derselben bezüglich einer[178] vollkommen saubern Intonation den Spielern die ausgesuchtesten Schwierigkeiten bietet. Dies findet seinen Grund darin, daß der Meister nicht hinreichend berücksichtigte, für welche Instrumente er schrieb; und so mischt sich, gleichwie in den Symphonien, so auch hier der Claviersatz in mitunter recht fühlbarer Weise mit ein. Derselbe macht sich auch sonst in den Streichquartetten noch stellenweise bemerklich, so namentlich in dem, für Schumann's Empfindungsart höchst charakteristischen Eintritt der Begleitungsstimmen auf den schlechten Takttheilen. Dieses sogenannte Nachschlagen der Instrumente, welches z.B. beim Anfang des »Trio« im zweiten Quartett insofern ganz unpraktisch ist, als kein einziger der vier Spieler vorschlägt, mag in zweihändigen Claviercompositionen nicht eben störend sein. Beim Ensemblespiel dagegen, insbesondere aber im Streichquartette, wird es immer, und selbst bei gelingender Darstellung als eine für das Gefühl unbehagliche Licenz empfunden werden.
In formeller Hinsicht stehen alle so eben betrachteten Kammermusikwerke Schumann's, wenn man von gewissen, durch den angeborenen Hang zu freierer Gestaltung bedingten Modificationen absieht, zur Hauptsache im Anschluß an die Ueberlieferungen der Meisterwerke, was denselben denn nächst der ihnen innewohnenden geistigen Bedeutung, auch den Werth einer wohlgebildeten äußeren Erscheinung verleiht.
Noch sind hier die gleichfalls dem Jahre 1842 angehörenden »Phantasiestücke« (op. 88), für Pianoforte, Violine und Violoncello zu erwähnen. Den eben betrachteten Werken stehen sie nicht ebenbürtig zur Seite. Ursprünglich sollten sie, im Ganzen betrachtet, als Claviertrio gelten; doch sah Schumann von dieser Bezeichnung später ab, die allerdings nach den üblichen Begriffen wenig passend gewesen wäre, da die fraglichen Tonsätze nicht der Sonatenform angehören, sondern aus einer freieren Anwendung der Lied- und annäherungsweise auch der Rondoform hervorgegangen sind. Bilden indessen die Phantasiestücke auch kein geschlossenes und tiefer angelegtes Ganzes, so können sie doch durch die ihnen eigenen ansprechenden Stimmungen interessiren.
Es ist schon mehrfach von dem stillen, in sich gekehrten Wesen Schumann's die Rede gewesen. Dieses ihn so sehr charakterisirende Wesen gewann in der inzwischen geschlossenen Ehe noch schärfere Ausprägung. Nicht nur bot sich ihm fortan seltener Gelegenheit, in[179] diejenige Berührung mit der Außenwelt zu treten, welche dem Einzelstehenden in gewissen Fällen durchaus nicht erspart bleibt, seine Gattin suchte auch in bewundernswerther weiblicher Aufopferung alles Gewöhnliche des Daseins möglichst von ihm ferne zu halten, was hemmend oder störend auf seine Berufsthätigkeit hätte einwirken können. So bildete sie recht eigentlich die Vermittlerin zwischen ihrem Gatten und dem praktischen Leben überall da, wo nicht die zwingende Macht besonderer Beziehungen vermochte, die Schranke seines äußerlich passiven Verhaltens fallen zu machen. Unter diesen Umständen ist nichts begreiflicher, als daß Schumann's ohnehin schon schwer zugängliche und unmittheilsame Persönlichkeit, um so weniger zur Bethätigung eines umfassenderen praktischeren Wirkens in öffentlichen Kreisen geneigt und geeignet sein konnte. Dies bewahrheitete sich denn auch zunächst bei dem im Hinblick auf seine künstlerische Bedeutung ihm dargebotenen Wirkungskreise an der Leipziger Musikschule, welche am 2. April 1843, unter Oberleitung Felix Mendelssohn-Bartholdy's, und unter Mitwirkung der bedeutendsten, damals in Leipzig lebenden künstlerischen Persönlichkeiten, so wie der besten vorhandenen Lehrkräfte eröffnet wurde. Schumann's Lehrfächer waren laut eines vom Directorium der Musikschule erlassenen Programms: Pianofortespiel, Compositionsübungen und Partiturspiel. Offenbar handelte es sich hier bei weitem mehr um Gewinnung der bedeutenden künstlerischen Persönlichkeit, als um einen Lehrer. Zu einem solchen mangelte ihm vor allem diejenige Eigenschaft, ohne welche das Lehramt kaum gedacht werden kann, nämlich eine beredte Mittheilsamkeit22, überhaupt die Fähigkeit, sich mit Entschiedenheit und Sicherheit in jedem Augenblicke verständlich zu machen. Wie sehr Schumann dies selbst fühlte, geht aus einem an *** gerichteten Briefe hervor, welcher also beginnt:
»Euer Wohlgeboren
wünscht der Unterzeichnete in einer für ihn höchst wichtigen Angelegenheit womöglich noch heute zu sprechen. Da ich mündlich mich aber[180] vielleicht nicht so klar und deutlich auszusprechen vermag, erlaube ich mir vorläufig Ihnen Folgendes der strengsten Wahrheit gemäß mitzutheilen.«
Gewiß wäre es durchaus ungerecht und unzulässig, Schumann aus dieser Eigenthümlichkeit seines Wesens einen Vorwurf formiren zu wollen, wie es denn überhaupt unbillig wäre, von Jemand die Bethätigung einer Eigenschaft zu verlangen, welche er nicht besitzt.
Uebrigens stand Schumann dem neu gegründeten Kunstinstitut, bei welchem er mitwirkend betheiligt war, keineswegs gleichgiltig gegenüber. Sein Projektirbuch beweist es, daß er auf seine Weise ein warmes Interesse für das Gedeihen desselben hegte. Es finden sich dort folgende auf die Leipziger Musikschule bezügliche Ideen verzeichnet: »Möglichst deutsche Bezeichnungen des Verlags einzuführen. – Wegen Ausschreibung eines Operntextes sich mit der Dresdner Intendanz der Oper zu verständigen. – Eine Herausgabe von S. Bach's Werken (in Sektionen) unter Aufsicht der Musikschule. – Preisvertheilungen. – Anlegung einer mus. Bibliothek.« –
Man sieht, Schumann war neben seiner schöpferischen Thätigkeit auch nach dem Rücktritt von der Zeitung unablässig mit zeitgemäßen tonkünstlerischen Fragen von größerer oder geringerer Wichtigkeit beschäftigt. So hatte er auch »Motionen an eine zukünftige Musiker-Versammlung« in sein Projektirbuch eingetragen, die gleichfalls an dieser Stelle zur Charakterisirung seiner Denkweise einen Platz finden mögen: »1) Verein gegen Modernisirung älterer klassischer Werke. 2) Verein zur Ausmerzung ital. u. franz. Vortragsbezeichnungen (wenn nicht aller, so doch der entbehrlichen), Desgl. gegen Titel in ausländischen Sprachen. 3) Untersuchung über die Echtheit des Mozart'schen Requiems, und Kritik dieses matten Werkes von Kunstverständigen und Künstlern. 4) Gründung einer Sektion zur Ausmerzung corrumpirter Stellen in classischen Werken. 5) Preisaufgabe wegen d. Operntextes.«
Schumann's Beziehungen zur Musikschule währten, mit Ausnahme einer Periode, in welcher er während des Jahres 1844 abwesend von Leipzig war, bis zu seiner bald darauf erfolgten Uebersiedelung nach Dresden. Sie waren ohne merklichen Einfluß auf sein äußeres Thun und Treiben, und Schumann blieb, was er bisher gewesen: der eifrig in aller Stille schaffende Künstler. Diesem Umstande verdanken wir denn nach dem Vorgange der lieblichen, ja, reizenden Variationen für[181] zwei Pianoforte's op. 46, zunächst die, in's Jahr 184323 fallende Entstehung eines seiner umfangreichsten Werke: »das Paradies und die Peri«, veröffentlicht als op. 50. Die nächste Veranlassung dazu erhielt er durch seinen schon mehrfach erwähnten Jugendfreund Emil Flechsig. Dieser war neben dem theologischen Berufe seiner, schon in den Jünglingsjahren gemeinschaftlich mit Schumann genährten Neigung zur Poesie treu geblieben, und hatte die Uebersetzung des, in Lalla Rookh von Thomas Moore enthaltenen Gedichtes »das Paradies und die Peri« unternommen. Er übergab dieselbe seinem Freunde mit dem Wunsche, sie zu einer musikalischen Composition benutzt zu sehen. Dies geschah bereits im Jahre 1841. Obwohl Schumann sofort nach der Bekanntschaft mit dem Gedichte, das nicht allein durch Gehaltsreichthum, sondern auch durch eigenthümliche Farbengebung ganz wie für des Tondichters Phantasie geschaffen war, begeisterungsvoll darauf einging, so kam es doch erst nach Verlauf zweier Jahre zur Composition desselben.
Die im engen Anschluß an das Original gehaltene Uebersetzung Flechsig's mußte, um sie brauchbar für ein größeres Tonwerk zu machen, eine formelle Umgestaltung erleiden. Schumann unternahm sie selbst,24 vermochte indessen die damit verbundene Aufgabe nicht ganz zu bewältigen; denn trotz mancher zweckmäßigen Aenderungen ist schließlich doch der ganze Text, wie er der Musik untergelegt wurde, ein Produkt ohne völlige formelle Einheit geblieben. Theilweis liegt dies zwar in der Dichtung selbst begründet, aber eine kritisch vollkommen klare und sichere Hand hätte zweifelsohne doch eine festere, einheitlichere Gestaltung in den Text zu bringen gewußt. Seine jetzige Beschaffenheit macht es kaum möglich, diese Composition mit Bestimmtheit einer der bestehenden Kunstgattungen beizugesellen. Die äußere Anordnung erinnert im Ganzen und Großen an das Oratorium, welchem aber der Inhalt des Werkes insofern entgegensteht, als er nichts mit dem für diese Kunstform erforderlichen Epos[182] gemein hat. Am nächsten kommt die fragliche Schöpfung im Hinblick auf das sich überwiegend geltend machende lyrische Element wohl der Cantate. Aber auch von dieser ist sie wesentlich unterschieden durch die Einführung einer erzählenden Person, die ohne alle Betheiligung an der Sache selbst, nur ein äußerliches Band für die Einzelmomente der Handlung bildet. Diese erzählende Person ist offenbar dem Evangelisten in den Bach'schen Passionsmusiken nachgebildet; aber keineswegs lag für Schumann jene Nöthigung vor, der sich Bach fügte. Wenn dieser den biblischen Text unberührt ließ, so hatte er gute Gründe dafür, Gründe, die ihm sicher wichtiger waren, als die Vermeidung eines ästhetischen Fehlers. Ohne Frage theilte er, ganz abgesehen von der kunsthistorischen Ueberlieferung, mit seiner Zeit die Ueberzeugung, daß das biblische Dogma nicht nur dem Inhalt sondern auch der Form nach unantastbar sei. In einem solchen Falle befand sich Schumann keineswegs. Er hatte in dem zur Composition gewählten Gedicht ein Kunstprodukt vor sich, welches, wenn es einmal umgearbeitet wurde, auch jede durch ästhetische Rücksichten gebotene formelle Aenderung zuließ. Wie leicht wäre z.B. nicht die erzählende Person, als die Einheit aufhebend, in Wegfall zu bringen gewesen? Jedenfalls hätte dabei auch der erlahmende und an Monotonie leidende dritte Theil des Werkes gewinnen müssen, dem übrigens – da er eigentlich gar keine Handlung enthält – die Einschaltung eines geeigneten Motives dienlich gewesen wäre.
Immerhin läßt sich bei Aufführungen dieser so reiz- und anmuthvollen Tonschöpfung, und zwar zum entschiedenen Vortheil für die Gesammtwirkung, dadurch etwas gewinnen, daß man die an sich musikalisch interessante, aber doch sehr gedehnte und für den Zusammenhang des Ganzen eben nicht wesentlich nothwendige Baßarie in Fis-moll »Jetzt sank des Abends goldner Schein« fortläßt.
Die Abweichungen des Textes zu »Paradies und Peri« von dem Originalgedichte rühren, wie schon bemerkt, von Schumann's Hand her. Sie bestehen mit Ausnahme einiger zweckmäßiger Kürzungen, in der Hinzufügung des Chors der »Genien des Niels«, des Chors der »Houri's«, des Solo's der Peri: »Verstoßen«, des Quartetts: »Peri ist's wahr«, des Solo's: »Gesunken war der goldne Ball« und des Schlußchors. In Betreff des letzteren gelang es dem genialen Tondichter nicht, einen wahrhaft wirkungsvollen, poetisch gesteigerten Abschluß des Ganzen zu erreichen.[183]
Trotz der bereits angedeuteten formellen Mängel des Textes, übt das Werk von musikalischer Seite her eine ungemeine Anziehungskraft aus, und dies zwar durch die Innigkeit und Wahrheit des Ausdrucks, so wie durch die blendende, schimmernde Färbung, man möchte sagen, durch die orientalische, lichtvolle Wärme, die das Ganze durchzieht und ausströmt. Schumann hat es verstanden, den Grundton der Dichtung meisterlich zu treffen und vermöge des Reichthums seiner Phantasie musikalisch wiederzugeben.
Gleich die an der Spitze des Werkes stehende, duftig zarte, und wie aus lichten Tönen gewobene Instrumentaleinleitung bereitet entsprechend auf die so ganz eigenartige Tonschöpfung vor, welche der Hörer zu erwarten hat. Sie baut sich, im hellen E-dur stehend, aus einer kurzen melodischen Figur in contrapunktisch imitatorischer Durchführung auf. Diese letztere wird nur einmal vorübergehend durch den Eintritt eines kleinen, aber charakteristischen Gegenmotivs in Moll, als Hindeutung auf die vor Edens Thor harrende »schmerzbefangene« Peri unterbrochen. Diese Anfangsfigur taucht weiterhin noch mehrfach in passenden Momenten als glückliche Reminiscenz wieder auf.
Bevor wir das Werk einer näheren Betrachtung unterziehen, sei bemerkt, daß die Peri's »nach der orientalischen Sage anmuthige Wesen der Luft sind«, welche wegen eines Fehltrittes aus dem Paradiese verwiesen wurden. Eines dieser ätherischen Geschöpfe benutzt nun der Dichter, um auf ethischer Grundlage in sinniger Weise zu zeigen, wie die versöhnende Gnade des Himmels zu erlangen sei, wenn sie auch einmal verwirkt worden. Die Peri ersehnt Einlaß in des Paradieses Garten. Solches verkündet in unmittelbarem Anschluß an die oben erwähnte Instrumentaleinleitung eine weibliche Stimme (Alt). Nun aber spricht das holde Kind der Lüfte selbst zu uns in einem reizenden, allmählig zu schnellerer Bewegung übergehendem Gesange in erweiterter Liedform. Sie preist die seligen Geister glücklich, denen es beschieden ist, im Lichte des ewigen Friedens zu wandeln, denn »ein Stündlein des Himmels ist schöner« als Alles, was die Erde bieten kann. Die dieser Betrachtung zu Grunde liegende Empfindung hat unser Meister in Weisen auszusprechen verstanden, welche richtig wiedergegeben, herzbewegend wirken müssen. Der »die Pforte des Lichts« bewachende Engel hört den Gesang der Peri, und mitleidvoll sagt er ihr zum Trost, es sei noch die[184] Möglichkeit zu ihrer Rückkehr ins Paradies vorhanden, wenn sie »des Himmels liebste Gabe« zu erlangen und darzubringen vermöge. Sinnend begiebt sie sich von dannen; sie vergegenwärtigt sich alle ihr bekannten Wunder der Welt, ohne doch darunter etwas zu finden, was geeignet sein könnte, den Himmel zu versöhnen. So schwebt sie gedankenvoll über Indiens Blumenhügel dahin, deren Pracht und Herrlichkeit von vier Solostimmen in warmen Tönen, getragen von einer farbenreichen Instrumentalbewegung, geschildert werden. Doch die vor ihrem Auge sich ausbreitenden lachenden Fluren sind von einem verheerenden Kampfe heimgesucht. Es ist der durch blutige Tyrannei hervorgerufene Verzweiflungskampf gegen herrschsüchtige Eroberer. Hier nun tritt der volle Chor ganz der Bedeutung des Momentes entsprechend ein, um die Schrecken dieses Vorganges zu schildern. Was er singt, ist von angemessen düsterem, aber dabei energischem Charakter, zum Theil im Unisono deklamirt, – ein Tonbild von mächtiger, stark ergreifender Wirkung.
Aber Schumann hat damit seine Kraft nicht erschöpft. Er gebietet über die Mittel, den Ausdruck noch um ein Bedeutendes zu steigern. Nachdem er in einem Instrumental-Zwischenspiel treffend die wild dahinstürmenden Kriegshorden und den Beginn des Vernichtungskampfes gemalt hat, läßt er den Chor wieder eintreten, und das gefürchtete Herannahen Gazna's, des zornschnaubenden Führers der feindlichen Schaaren verkünden, wobei außer dem vollen Orchesterapparat höchst charakteristisch die Schlaginstrumente nebst der schrill ertönenden Piccoloflöte auftreten.
Nun scheidet sich der Männerchor in den der Eroberer (Baß) und der Indier (zwei Tenore), die abwechselnd einander zurufen: »Gazna lebe«, und »Es sterbe der Tyrann.« Da entbrennt der Kampf aufs Neue, – der Tondichter drückt es meisterhaft in einem auf Cis ruhenden Orgelpunkt aus, dessen verhallender Schluß andeutet, daß das Schicksal der, ihre Heimath vertheidigenden Krieger entschieden ist.
Die Eroberer, das Schlachtfeld behauptend, rufen abermals den Namen ihres Führers Gazna aus, diesmal mit der Geltung des vollen Triumphes. Nur noch ein kühner Jüngling wagt es, sich ihm entgegenzustellen. Er ist bereit im Zweikampf mit dem Gefürchteten sein Leben einzusetzen. Bald auch sinkt er, tödtlich getroffen, dahin. Ein Schmerzensruf entringt sich bei seinem Fall den Lippen seiner[185] ihn überlebenden Kampfesgenossen. Diesen Moment hat Schumann zu einem sehr ausdrucksvollen, auf den Worten »Weh', er fehlte das Ziel, es lebt der Tyrann, der Edle fiel« sich aufbauenden Chor benutzt. Es ist ein Meisterstück der Charakteristik für den schmerzlich bewegten Ausdruck einer in banger Erwartung harrenden Menge. Die meist gedoppelt auftretenden Singstimmen bewegen sich wechselweise in breit gelagerten und theilweise dissonirenden Akkorden als ausgedehnte Orgelpunkte über den Noten H und Cis – das dem Vorhergehenden entsprechend gebildete Nachspiel ruht auf dem Ton Fis – während die Violoncelle mit den Bratschen und Fagotten unisono in einer, die Gesammtwirkung wesentlich erhöhenden Viertelbewegung dagegen contrapunktiren.
Die ganze Scene vom ersten Eintritt des Chores ab bis hierher ist von außerordentlich energischem, schwungvollem Wesen, und einer an's Dramatische streifenden Lebendigkeit, welche kaum noch eine Steigerung zuläßt. Im Hinblick auf die hier in knapper, conciser Form entwickelte Schlagfertigkeit des Ausdrucks ist es ganz erklärlich, wenn Schumann daran dachte, auch der Bühne seine Kräfte zu widmen, worüber die folgende Darstellung das Erforderliche berichten wird.
Verfolgen wir jetzt die weitere Entwickelung des von uns betrachteten Werkes. Auf dem Kampfplatz, den nunmehr die Peri betritt, ist es still geworden. Wie herrlich und ruhmvoll ist's, sein Leben für's geliebte Vaterland zu opfern! In diesem Gefühl nimmt die Peri einen Tropfen des von dem jugendlichen Helden vergossenen Blutes, durch dessen Darbringung sie sich Eden's Pforten zu erschließen hofft. Unter Harfenklängen erhebt sie freudig gehobenen Sinnes ihre Stimme zu dem Lobgesang: »denn heilig ist das Blut, für die Freiheit versprützt vom Heldenmuth«, welchen der volle Chor beantwortet. Und nun folgt, der damit ergriffenen Stimmung entsprechend, ein feuriges, sich ebenmäßig steigerndes Allegro, welches in theilweise freierer und theilweise strengerer, fugirter Form dem zu Grunde liegenden dichterischen Gedanken erschöpfenden Ausdruck giebt. Dies geistsprühende, den Hörer unwiderstehlich mit sich fortreißende Musikstück bildet den ebenso glänzenden als erhebenden Schluß des ersten Theiles.
Zum Beginn der zweiten Abtheilung führt uns die Dichtung wiederum an des Paradieses Pforten, wo die Peri mit ihrer Sühnengabe[186] bereit steht. Erwartungsvoll hart sie des Einlasses; aber noch wird ihr dieser nicht gewährt:
»Viel heil'ger muß die Gabe sein
Die dich zum Thor des Lichts läßt ein,«
so lautet das abwehrende Wort des Engels, welches zu größerer Bekräftigung von einem vierstimmigen weiblichen Chor in kleiner Besetzung wiederholt wird. Dieser in Ariosoform gehaltene Einleitungssatz, bei dem zunächst der erzählende Tenor auftritt, ist in seiner einfach schmucklosen Haltung von seltener Lieblichkeit; jeder Ton derselben athmet jenen seligen Frieden des Ortes, an welchem die geschilderte Scene vorgeht. Sehr schön ist, um nur eine der Feinheiten des musikalischen Ausdrucks anzudeuten, durch den Eintritt der Posaunen der Moment hervorgehoben, in welchem der Engel aus der sich öffnenden Paradiesespforte hervortritt.
Enttäuscht begiebt sich die Peri wieder auf die Wanderung. Sie schwebt hernieder zu den Quellen des Nil's, »dessen Entsteh'n kein Erdgebor'ner noch gesehn«, um ihr mattes Gefieder zu netzen und zu erfrischen. Mit glücklichem Griff hat Schumann an dieser Stelle den »Chor der Genien des Nil's« eingefügt, – ein wahres Kabinettstück an reizvoller Tonmalerei, welches die anmuthvollste Wirkung ausübt. Der Grundgedanke desselben erinnert etwas an Mendelssohn, aber die Art der gedanklichen Entwickelung und des Colorits ist doch ganz selbstständig und durchaus Schumannisch. Eine im Streichquartett durchgeführte Sechzehntheilfigur hebt an; sie versinnlicht die lebendige Bewegung der Gewässer, während die drei Stimmen des Chores, – der schwerfällige Baß pausirt sehr angemessen während des ganzen Satzes – mit einem leicht beschwingten Motiv einander auffordern, herbeizueilen, um das fremde, liebliche Kind zu schauen, und dessen klagendem Gesange zu lauschen. Denn immerdar beschäftigt die Peri das Sehnen nach dem Himmel, und auch jetzt mischt sich der Ausdruck davon unter die Klänge des um sie geschaarten lustigen Völkchens. Mit seinem poetischen Takt legt Schumann hier der Peri wiederum jene reizende Anfangsmelodie des ersten Sopransolo's zu Anfang des Werkes in den Mund, – ein wahrhaft genialer Zug.
Doch hinweg treibt es die Peri, das köstliche Gut zu suchen, welches ihr die Seligkeit wiedergeben soll. Die Heimathstätte der Pharaonen durchstreifend, erblickt sie Egypten's Königsgrüfte, lauscht[187] sie dem Naturleben des wunderbaren Landes. Dies Alles schildert uns der erzählende Tenor, dessen gleichmäßig recitirender Gesang von einer treffend illustrirenden Instrumentalbegleitung umgeben ist. Sanft getragene, abwechselnd vom Streichquartett und den Bläsern ausgeführte Akkorde sind es, die wie ein lindes Spiel sonniger Aetherwellen auf und niederwogen.
Aber nun wendet sich das freundliche Bild plötzlich ins Gegentheil. Der unheimlich spitze Klang der Piccoloflöte läßt sich vernehmen, und unter ihren lang gehaltenen. Tönen bewegen sich die Bläser mit den Streichern geisterhaft dahinschleichend in die Tiefe. Sodann antworten beide Instrumentengruppen einander wiederum mit Akkorden wie vorher; aber an Stelle des Wohllautes tritt nun die herbste Dissonanz. Schwer wie Blei lasten diese düstergefärbten Harmoniefolgen auf dem Gemüth, welches sich wie von einer schwülen Athmosphäre bedrückt fühlt. Gespenstisch zieht durch's Land, ringsumher ihre verheerenden Spuren zurücklassend, die furchtbare Geißel der Pestkrankheit, und die grauenvolle Empfindung, welche sich an diese Vorstellung knüpft, hat unser Meister in wenigen Takten, ohne die Gränze des Unschönen irgendwie zu berühren, oder forcirt zu werden, mit einer Wahrheit ausgedrückt, die eben so schlagend als überraschend ist. – Es sind Farbentöne, einzig in ihrer Art und wie man sie sonst in der Musik noch nicht gehört hat.
Die Peri sieht das Elend der heimgesuchten Menschheit; es entlockt ihrem Auge verklärende Thränen des Mitleids,
»Denn in der Thrän' ist Zaubermacht,
Die solch ein Geist für Menschen weint.«
Diese Worte geben dem Tondichter Veranlassung zu einem, mit äußerst zarter Instrumentalbegleitung versehenen wunderlieblichen Satz für vier Solostimmen, der nicht allein durch seine innig lebenswarme Stimmung, sondern auch durch die interessante contrapunktische Behandlung fesselt.
Und nun zeigt er uns eine Trauerscene, welche im Gefolge der Seuche ist. Ein Jüngling, von der Krankheit befallen, erwartet einsam und verlassen von den Seinen das Ende. In einem liedmäßig gebildeten Gesange, wird uns von einer Altstimme das schmerzvolle Weh' geschildert, welches er erdulden muß. Dann spricht er selbst, die ausdrucksvolle Melodie wiederholend, mit gebrochener Stimme zu uns. Nur nach einem Tropfen Wasser verlangt es ihn, um die[188] »fiebrische Glut« zu stillen. Die Wirkung dieses kleinen Tonsatzes liegt nicht allein in der angemessenen Behandlung des melodischen Theiles, sondern ebensosehr in der treffenden Anwendung von Vorhalten, welche auf die Qualen des Sterbenden hindeuten sollen.
Nothwendig ist es im Gefühl begründet, daß der in diesem Stück zum Ausdruck gelangende schmerzhaft düstere Ton von einem anderen abgelöst wird. Eine heitere war natürlich wegen des allzu schroffen Contrastes mit dem unmittelbar vorher Gehörten unzulässig; es konnte nur eine Gefühlstonart ergriffen werden, bei welcher das Gemüth wieder zum Gleichgewicht gelangt. Und von dieser Art ist das sich anschließende, lind beruhigende Sopransolo »Verlassener Jüngling«. Es erscheint um so willkommener an dieser Stelle, als sofort wieder ein tief ernster Vorgang folgt: die Braut des sterbenden Jünglings von böser Ahnung getrieben, erscheint um den Geliebten zusuchen, unvermuthet an dessen Seite. Er fleht sie an hinwegzueilen, ihr Leben zu schonen. Doch beglückt ihren Herzensfreund wiedergefunden zu haben, scheut sie es nicht von dem giftigen Hauch der Krankheit ergriffen zu werden, und vereint mit ihm in den Tod zu gehen. Die liebeseligen Empfindungen von denen sie erfüllt ist, sind in der über Alles schönen Arie »O laß mich von der Luft durchdringen«, einem unvergleichlichen Juwel der musikalischen Lyrik, wiedergegeben. Aus diesem köstlichen Tonsatz spricht, gleichwie aus dem Liedercyklus »Frauenliebe und Leben«, aber in potenzirter Steigerung, die innige Gefühlsschwärmerei edelster Weiblichkeit zu uns.
Und nun, im höchsten Affekt, sinkt das edle Mädchen dahin, mit dem Geliebten zugleich den Geist aushauchend.
Tief bewegt von der ergreifenden Scene singt die Peri den Entschlafenen in geheiligten Tönen das Grablied, an welchem sich auch der Chor mitwirkend betheiligt. Es ist dieses Musikstück von einer wahrhaft verklärten und verklärenden Reinheit der Empfindung. Ganz besonders schön wirken im Verlaufe desselben die Piano und Pianissimo gehaltenen, intensive Wärme und milden Glanz ausstrahlenden Posaunen, während das Streichquartett, welches Anfangs mit dem Bläserchor zum Gesange einfach die Harmonie angiebt, in Sechzehntheil-Sextolen eine sanft schwebende und schwingende Bewegung bis zum Schluß unterhält.
Der zweite Theil von »Paradies und Peri« kann nicht, wie der erste, durch imponirende Massenwirkungen sich Geltung verschaffen.[189] Aber er erweckt nichts desto weniger einen tiefgehenden Antheil durch das Anmuthige, Schöne und Ergreifende, was er in seltener Fülle und Abwechselung enthält. Jedenfalls kann mit dem günstigen Eindruck desselben der dritte und letzte Theil nicht rivalisiren, wenn auch vieles Einzelne in ihm an sich als sehr gelungen und sogar bedeutend zu bezeichnen ist. Der Grund hiervon liegt lediglich in dem Stoff, dem es für das noch Folgende an der nöthigen Spannung fehlt, um das Interesse an der Sache wieder von Neuem zu beleben oder doch bis zu einem gewissen Grade rege zu erhalten. Abgesehen davon, daß es an einer bedeutsamen Handlung in der Schlußabtheilung mangelt, übt auch der Umstand einen ungünstigen Einfluß, daß die Peri, welche natürlich auch hier wiederum die Hauptrolle spielt, sich genau in derselben Situation befindet, wie vorher. Sie glaubt im Hinblick auf die bewährte Liebestreue des, dem Manne ihres Herzens in Leben und Tod hingegebenen Mädchens jenes Kleinod gefunden zu haben, welches ihr die Rückkehr in des Paradieses Garten ermöglichen soll. Und abermals schwingt sie sich empor zum Himmelszelt, um als Unterpfand der geforderten Sühne der »reinsten Liebe Seufzer« darzubringen.
Der Dichtung entsprechend, hätte hiermit der dritte Theil beginnen müssen, wodurch indessen eine bedenkliche Gleichartigkeit mit den Anfängen des ersten und zweiten Theiles entstanden wäre. Um diese zu vermeiden, stellte Schumann den Chor der »Houri's«25: »Schmücket die Stufen zu Allah's Thron« voran, durch dessen heiteren Charakter die bereits etwas matte Haltung der Dichtung auch eine vortheilhafte Belebung erhält. Er ist selbstverständlich für weibliche Stimmen (zwei Soprane und zwei Alte) unter passender Anwendung der sogenannten »türkischen Musik« gesetzt, welche sich jedoch nur ganz discret im Pianissimo vernehmen läßt. Dies Stück, in dessen Textesworten eine Ermahnung an die Peri enthalten ist, nicht zu verzweifeln, gewährt einen anspruchslos anmuthigen Genuß. Die beiden Oberstimmen sind theilweise canonisch im Einklange geführt, mit Ausnahme einer Stelle, bei welcher der zweite Alt die Nachahmung des[190] ersten Sopranes in der Unterquart übernimmt. In einzelnen Perioden wird der Chor von Solostimmen abgelöst, so daß es auch an einer gewissen Mannichfaltigkeit nicht fehlt.
Hierauf folgt die schon erwähnte Scene des Wiedererscheinens der Peri an Eden's Pforten, von denen sie abermals mit den Worten »viel heil'ger muß die Gabe sein« zurückgewiesen wird.
Und zum dritten Mal pilgert die Peri von dannen. Schwer ist ihr Herz. Schon beginnt ihr Muth zu sinken, aber der Gedanke an Eden sacht aufs Neue ihre Hoffnung an: sie will, sie muß das heh're Kleinod des Himmels finden, um wieder unter den Seligen wandeln zu können. Diesen entgegengesetzten Gefühlen giebt ein schwungvoll concipirtes und breit angelegtes arienartiges Allegro mit langsamer Einleitung wirksamen Ausdruck. Das sich daranschließende, schon oben erwähnte Barytonsolo in Fis-moll leitet zu einem mehr originellen als schönen Gesang für vier weibliche Solostimmen hinüber, den Schumann seinem Werke offenbar nur zur Hebung der erlahmenden Handlung hinzufügte, da er an sich nicht wesentlich für die Sache ist. Durch seine leichtbeschwingte, springende Rhythmik so wie durch das eigenthümlich pikante Colorit der Instrumentation ist er wohlgeeignet, die Geister wieder etwas zu erfrischen. Dennoch kann er die fühlbar werdende Monotonie nicht ganz beseitigen.
Der dem Quartett zu Grunde liegende Gedanke ist, daß einige Peri's in spöttischem Tone den Wunsch äußern, von ihrer Schwester in den Himmel mitgenommen zu werden, was auch in der Musik zum Ausdruck kommt. Die dadurch schmerzlich Berührte eilt vorüber, und mit dem sinkenden Tageslicht will sie einen einst ihr eigenen Sonnentempel aufsuchen, aus dessen Hieroglyphenschrift sie zu entziffern hofft, was dem Himmel etwa erwünscht und genehm sein könnte. Ueber »Balbeck's Thal« dahin schwebend, erblickt sie einen holden Knaben, lieblich wie des Feldes Blumen, die ihn umgeben. Während er mit seinem Spiel beschäftigt ist, kommt ein wilder Reitersmann herzu, der vom Pferde steigt, um den brennenden Gaumen in dem nahen Quell zu lechzen. Seinem Antlitz ist das Kainszeichen schrecklicher Verbrechen aufgedrückt.
Das Kind hört den durch die Luft erschallenden Vesperruf von »Syriens tausend Minareten«, und als bald erhebt es andachtsvoll die Hände zum Gebet. Der Mann aber, überwältigt von dem Anblick[191] unschuldvoller Frömmigkeit, die ihn an seine eigene unbefleckte Jugend mahnt, weint Thränen inniger Reue über das sündhaft geführte Leben. Und diese Thränen, – sie sind's, welche der Peri die Himmelspforten eröffnen.
Dies Alles ist dichterisch wie musikalisch sehr weitläufig und detaillirt geschildert. Es würde schwer zu entscheiden sein, wer seine Sache hier besser gemacht, der Wort- oder der Ton-Poet, denn Beide leisten ganz Vortreffliches. Allein nach allem Schönen, was man schon gehört hat, wird es denn doch endlich zu viel des Guten in ein und derselben Richtung, und dies um so mehr, als das Gefühl schon mit Ungeduld nach der Lösung verlangt. Indessen macht sich doch noch ein erhebender Moment mit voller Wirkung geltend. Es ist der herrliche, von tiefer Frömmigkeit des Sinnes zeugende Chor: »O heil'ge Thränen inn'ger Reue«, an welchem auch ein Soloquartett in obligater Weise betheiligt ist. Er bereitet die Stimmung des Hörers in angemessener Weise auf den Schluß vor, welchen Schumann, wie bereits bemerkt wurde, der Dichtung eigenhändig hinzugefügt hat, und unter dessen Jubelklängen die Peri in das Reich des ewigen Friedens einzieht.
Hier ergiebt sich nun ganz von selbst das Zusammenwirken der, wieder in den Himmel Aufgenommenen mit dem Chor der Seligen, wodurch bei richtiger Disposition ein musikalisch höchst bedeutsames Finale zu gewinnen war. Allein Schumann hat – vielleicht mit voller Absichtlichkeit – die schwungvoll gedachte Sopranpartie der Peri so sehr in den Vordergrund gestellt, daß der Chor dabei zu kurz kommt. Jedenfalls mußte eine intensivere Wirkung zu erreichen sein, wenn dieser mit einer mehr polyphonen Behandlung bedacht worden wäre, was auch durchaus der dichterischen Idee entsprochen hätte. In der hier getroffenen Anordnung überschreitet der Chor indessen kaum die Grenzen einer einfach harmonischen Füllung, was ihm das Gepräge des bloß Accessorischen verleiht. Wie dem aber auch immer sei, als Ganzes genommen ist »das Paradies und die Peri« ein äußerst glücklicher Wurf, – eine Schöpfung, für deren hohe künstlerische Bedeutung der Umstand vernehmlich genug spricht, daß sie sofort bei ihrem ersten Erscheinen von sieghaften Erfolgen begleitet war, die auch heute noch nicht nachgelassen haben.
Als sehr rühmenswerthe Eigenschaften des Werkes sind hervorzuheben: der schöne, kaum irgendwo durch die früher bemerkbaren[192] Eigenheiten Schumann's getrübte melodische Fluß, so wie die klare Gliederung der musikalischen Gedanken. Namentlich in letzterer Hinsicht ist ein, durch das formenstrengere, während der beiden vorhergehenden Jahre stattgehabte Schaffen bewirkter Fortschritt unverkennbar. Dagegen vermochte Schumann gleichwie in den, während des Jahres 1840 entstandenen Lieder-Compositionen auch hier nicht den Anforderungen an das gesangliche Element vollkommen zu entsprechen. Die Schwierigkeiten, welche die, nicht selten unzureichende Handhabung der Singstimme den Ausführenden entgegenstellen, werden indeß noch erhöht durch eine an sich zwar farbenschöne, blühende, aber doch stellenweise etwas zu reiche Instrumentation. Daher fehlt an gewissen Stellen mitunter das richtige Verhältniß zwischen dem Vocalen und Instrumentalen. Auch Declamationsmängel26 machen sich fühlbar, da sie den dichterischen Gedanken zerreißen.
Das Paradies und die Peri hat nächst den Phantasiestücken (op. 12), den Kinderscenen (op. 15), einer Anzahl jener im Jahr 1840 componirten Lieder und des Clavierquintetts (op. 44), am meisten zur Anerkennung von Schumann's schöpferischer Begabung in weiteren Kreisen beigetragen. Es fand dies schöne Werk schnelle Verbreitung, und erlebte in Folge dessen viele Aufführungen auch jenseits des Oceans27.
Ihre erste Wiedergabe fand diese Composition im Gewandhause zu Leipzig unter persönlicher Leitung des Autors am 4. December 1843. Sie wirkte so zündend auf das zahlreich versammelte Publikum, daß schon acht Tage darauf unter lebhaftester Theilnahme eine Wiederholung stattfinden konnte. Diese Aufführungen wurden ganz besonders durch die Mitwirkung von Frau Livia Frege geschmückt, welche die Partie der gewissermaßen für sie gedachten und geschriebenen »Peri«, und außerdem auch bei der zweiten Production die reizende Arie der Jungfrau mit wärmster Hingebung und bezaubernder Anmuth ausführte.
Die gleichförmige Ruhe, in welcher Schumann lebte und schuf, wurde durch den Wunsch seiner Gattin, nach längerer Pause wieder[193] einmal eine größere Kunstreise zu unternehmen28, während des folgenden Jahres (1844) zeitweilig unterbrochen. Diese Reise war schon früher beabsichtigt, wie aus einem Briefe an Keferstein29 hervorgeht, in welchem Schumann schreibt: »Die Reise nach Petersburg hab' ich Klara'n feierlich angeloben müssen; sie wolle sonst allein hin, sagte sie. Ich traue es ihr in ihrer Sorglosigkeit für unser äußeres Wohl auch zu. Wie ungern ich aus meinem stillen Kreise scheide – das erlassen Sie mir zu sagen. Ich denke nicht ohne die größeste Betrübniß daran, und darf es doch Klara nicht wissen lassen.« Jetzt erst jedoch kam diese Reise zur Ausführung. Das Künstlerpaar machte sich Ende Januar 1844 auf den Weg, der über Königsberg, Mitau und Riga genommen wurde. In der erstgenannten Stadt gab Clara Schumann zwei, in Mitau und Riga zusammen fünf Concerte. In Petersburg selbst fanden vier Concerte statt, in denen ebensosehr die Compositionen Schumann's, als die unvergleichlichen Leistungen seiner Gattin enthusiasmirten. Ueber den mehrwöchentlichen Aufenthalt in der Czarenstadt giebt folgender Brief an Friedrich Wieck, mit dem inzwischen eine, wenigstens äußerlich befriedigende Aussöhnung stattgefunden hatte, näheren Aufschluß.
St. Petersburg, den 1. April 1844.
Lieber Vater,
Ihren freundlichen Brief beantworten wir erst heute, da wir Ihnen doch auch gern über den Erfolg unseres hiesigen Aufenthaltes berichten wollten. Wir sind nun vier Wochen hier. Klara hat vier Concerte gegeben und bei der Kaiserin gespielt; wir haben ausgezeichnete Bekanntschaften gemacht, viel Interessantes gesehen, jeder Tag brachte etwas Neues – so ist denn heute herangekommen, der letzte Tag vor unserer Weiterreise nach Moskau, und wir können, wenn wir zurückblicken, ganz zufrieden sein mit Dem, was wir erreicht. Wie viel habe ich Ihnen zu erzählen und wie freue ich mich darauf. Einen Hauptfehler hatten wir gemacht; wir sind zu spät hier angekommen. In so einer großen Stadt will es viele Vorbereitungen; Alles hängt hier vom Hof[194] und der haute volée ab, die Presse und die Zeitungen wirken nur wenig. Dazu war Alles von der italienischen Oper wie besessen, die Garcia hat ungeheures Furore gemacht. So kam es denn, daß die beiden ersten Concerte nicht voll waren, das dritte aber sehr, und das vierte (im Michaelistheater) das brillanteste. Während bei andern Künstlern, selbst bei Liszt, die Theilnahme immer abgenommen, hat sie bei Klara sich immer gesteigert und sie hätte noch vier Concerte geben können, wenn nicht die Charwoche dazwischen gekommen und wir doch auch an die Reise nach Moskau denken müssen. Unsere besten Freunde waren natürlich Henselt's, die sich unserer mit aller Liebe angenommen, dann aber und vor Allem die beiden Wielhorsky's,30 zwei ausgezeichnete Männer, namentlich Michael eine wahre Künstlernatur, der genialste Dilettant, der mir je vorgekommen, – beide höchst einflußreich bei Hof und fast täglich um Kaiser und Kaiserin. Klara glaub' ich, nährt eine stille Passion zu Michael, der, beiläufig gesagt, übrigens schon Enkel hat, d.h. ein Mann über die 50 hinaus, aber frisch und ein Jüngling an Leib und Seele. Auch an dem Prinzen von Oldenburg (Kaisers Neffe) hatten wir einen sehr freundlichen Gönner, wie an seiner Frau, die die Sanftmuth und Güte selbst ist. Sie führten uns gestern selber in ihrem Palais herum. Auch Wielhorsky's erzeigten uns eine große Aufmerksamkeit, indem sie uns eine Soirée mit Orchester gaben, zu der ich meine Symphonie31 einstudirt hatte und dirigirte. Ueber Henselt mündlich; es ist ganz der Alte, reibt sich aber auf durch Stundengeben. Zum Oeffentlichspielen ist er nicht mehr zu bringen; man hört ihn nur beim Prinzen von Oldenburg, wo er auch einmal in einer Soirée die zweiflügeligen Variationen von mir mit Klara spielte.
Kaiser und Kaiserin sind sehr freundlich mit Klara gewesen; sie spielte dort gestern vor 8 Tagen im engen Familienkreise zwei ganze Stunden lang. Das Frühlingslied32 von Mendelssohn ist überall das Lieblingsstück des Publikums geworden; Klara mußte es in allen Concerten mehrmal wiederholen; bei der Kaiserin sogar 3 mal. Von der[195] Pracht des Winterpalastes wird Ihnen Klara mündlich erzählen; Herr von Ribeaupierre (der frühere Gesandte in Constantinopel) führte uns vor einigen Tagen darin herum; das ist wie ein Märchen aus »tausend und Einer Nacht«.
Sonst sind wir ganz munter; auch von den Kindern haben wir die besten Nachrichten.
Nun denken Sie sich meine Freude: mein alter Onkel33 lebt noch; gleich in den ersten Tagen unseres Aufenthaltes hier war ich so glücklich, den Gouverneur aus Twer kennen zu lernen, der mir sagte, daß er ihn ganz gut kenne. Ich schrieb also gleich hin und empfing vor Kurzem von ihm und seinem Sohn, der Commandeur eines Regimentes in Twer ist, die herzlichste Antwort. Nächsten Sonnabend feiert er seinen 70jährigen Geburtstag, und ich denke, daß wir da grade in Twer sind.34 Welche Freude für mich und auch für den alten Greis, der nie einen Verwandten bei sich gesehen.
Vor dem Weg nach Moskau hat man uns bange gemacht; im Uebrigen glauben Sie uns, es reist sich in Rußland nicht schlimmer und besser, als irgendwo, eher besser, und ich muß jetzt lachen über die fürchterlichen Bilder, die mir meine Einbildung in Leipzig spielte. Nur theuer ist es sehr (hier in Petersburg zumal, z.B. Wohnung täglich 1 Louisd'or, Kaffee 1 Thlr., Mittagessen 1 Dukaten etc. etc.)
Wir denken wieder über Petersburg zurückzukommen (ohngefähr in 4 Wochen), nach Reval zu Land zu reisen, von da mit dem Dampfschiff nach Helsingfors und über Abo nach Stockholm, und dann wahrscheinlich die Ca naltour nach Copenhagen und in unser liebes Deutschland zurück.35 Anfang Juni hoffe ich gewiß sehen wir Sie wieder, lieber Papa, und vorher schreiben Sie uns noch oft, vor der Hand immer nach Petersburg mit Henselt's Adresse. Henselt schickt uns die Briefe dann nach.
Alwin36 hat uns mehrmal geschrieben, es scheint ihm ganz leidlich[196] zu gehen; in Reval werden wir wohl das genauere erfahren. – Molique ist gestern wieder nach Deutschland zurück; die russische Reise hat ihm wohl kaum die Kosten gebracht; es geschieht ihm recht, dem nichts recht ist, der über Alles raisonnirt und dabei ein so trockener Gesell ist.
Die hiesigen Musiker haben sich alle höchst freundlich gegen uns gezeigt, namentlich Heinrich Romberg; für ihre Mitwirkung im letzten Concert lehnten sie alle Entschädigung ab; es wurde uns dabei nichts zugemuthet, als sie sämmtlich in Wagen abholen zu lassen zum Concerte, was wir denn mit größter Zufriedenheit thaten. Sehr viel, so sehr viel hätte ich Ihnen noch zu schreiben; aber wir haben heute noch viel zu präpariren zu der Moskauer Reise; so nehmen Sie denn das Wenige liebreich auf. Grüßen Sie Ihre Frau und Kinder herzlich von Klara und mir und behalten Sie mich lieb.
R. S.
P. S.
Heute ist ein kleines Jubiläum für mich – Sie wissen wohl – der 10. Geburtstag unserer Zeitschrift. Von den Beilagen senden Sie wohl Einiges nach Leipzig; bitten Sie aber, daß nichts verloren gehen möge. Noch eine Bitte; Schreiben sie doch an Wenzel ein paar Worte, er möge sich, wenn er in Zeitungen etwas Allgemein- Interessantes oder mich besonders Interessirendes findet, die Nummern der Blätter merken und für mich aufnotiren, man bekömmt hier fast gar keine Zeitungen zu sehen. Die Gedichte37 würden wohl auch Dr. Frege's38 interessiren.
Nachdem Clara Schumann auch in Moskau drei Concerte gegeben hatte, trat das Künstlerpaar die Rückreise an und traf Anfangs Juni wieder in der Heimat ein. Inzwischen war in Schumann's Innerem ein Plan reif geworden, dessen Ausführung sogleich nach der Ankunft in Leipzig erfolgte. Er betraf den Rücktritt von der[197] musikalischen Zeitung. Fast scheint es, daß diese ihm durch das Mißlingen der beabsichtigten Verlegung nach Wien gleichgiltiger geworden war; denn so enthusiastisch er noch unmittelbar vor der Wiener Reise von der Zeitung und ihrer Zukunft spricht,39 so apathisch äußert er sich betreffs seiner Stellung zu ihr, ganz seiner früheren Ansicht entgegengesetzt, unmittelbar nach der Rückkunft von Wien40: »Ich bin im Grund sehr glücklich in meinem Wirkungskreis; aber könnte ich erst die Zeitung ganz wegwerfen, ganz der Musik leben als Künstler, nicht mit so vielem Kleinlichen zu schaffen haben, was eine Redaction ja mit sich bringen muß, dann wäre ich erst ganz heimisch in mir und auf der Welt. Vielleicht bringt dies die Zukunft noch;« schreibt er um diese Zeit an H. Dorn. Zwar veränderte sich seine Stimmung bald darauf noch einmal zu Gunsten der Zeitung, wie folgende briefliche Aeußerung vom 27. April 1839 an Zuccalmaglio zeigt: »Die Entfernung von der Zeitschrift ist mir, glaub' ich, wohlthätig gewesen; sie lacht mich wieder so jugendlich an als damals wir sie gründeten«; doch diese Schwankung war eine nur vorübergehende. Thatsächlich wurde Schumann demnächst schon so sehr durch sein musikalisches Schaffen in Anspruch genommen, daß die bisherige so hingebende Wirksamkeit für die Zeitung wesentliche Einbuße erleiden mußte. Uebereinstimmend damit schrieb er am 19. Februar 1840 an Keferstein41: »Die Redaction der Zeitung kann nur Nebensache sein, mit so großer Liebe ich sie auch hege. Ist doch jeder Mensch auf das Heiligste verpflichtet, die höheren Gaben, die in ihn gelegt sind, zu bilden. Sie selbst schrieben mir, wie ich mich erinnere, vor einigen Jahren das Nämliche, und ich habe seitdem wacker fortgearbeitet. Ich schreibe Ihnen das, mein verehrter Freund, weil ich in Ihren letzten Zeilen einen kleinen Vorwurf über meine Redactionsverwaltung zu sehen glaube, den ich wahrhaftig nicht verdiene, eben weil ich soviel außerdem arbeite und weil dieses das Wichtigere ist und die höhere Bestimmung, die ich in diesem Leben zu erfüllen habe.« Wie ernstlich er damals schon darauf bedacht war, eine passende Persönlichkeit an seiner Statt für die Zeitschrift zu ermitteln, zeigt ein Brief vom 9. Mai 1841 an Koßmaly, in welchem er sagt:[198] »Hätten Sie Lust, später einmal meine Stelle an der Zeitung einzunehmen – als ordentlicher Redacteur – ich ziehe später in eine größere Stadt und wünschte das von mir gegründete Institut von guten Händen verwaltet.« Eine nahliegende Folge des Wunsches, sich von der Redaction der Zeitung zurückzuziehen war, daß der warme Antheil, den Schumann seinem kunstliterarischen Unternehmen Anfangs in so reichem Maaße widmete, sich nach und nach verminderte. Die Correspondenzartikel, denen man vorher nur selten in den Spalten desselben begegnete, nehmen an Stelle der freien Aufsätze mehr und mehr zu, und so konnte denn ein allmähliges Sinken des Kunstorgans nicht ausbleiben. Vielleicht wäre trotzdem die Redaktion, welche Ende Juni 1844 an Oswald Lorenz überging42, von Schumann noch weiter beibehalten worden, wenn nicht eine körperliche und geistige, fast besorgnißerregende Abspannung ihm den Rücktritt von derselben doppelt wünschenswerth gemacht hätte. Mit dem gestörten Gesundheitszustande Schumann's fand außer dem Verlassen der schriftstellerischen Thätigkeit auch eine theilweise Umgestaltung seines sonstigen Lebens statt, indem er zu Ende des Jahres 1844 den bisherigen Wohnsitz aufgab, um zunächst in Dresden seinen Aufenthalt zu nehmen. Ehe wir ihn jedoch dorthin begleiten, sind zuvor noch die, während des Jahres 1844 entstandenen Tonschöpfungen zu nennen. Die Ausbeute war wenn auch nicht quantitativ, so doch qualitativ bedeutend. Sie bestand in nichts Geringerem, als in der Composition der Schlußscene zu Göthe's Faust für Solostimmen, Chor und Orchester. Außerdem nennt das Compositionsverzeichniß noch einen Chor und eine Arie zur Oper: »Der Corsar« nach Byron.43
Schumann ging im Herbst 1844 nach Dresden; die vollständige Uebersiedelung dorthin erfolgte aber erst im December desselben Jahres, nachdem er nebst seiner Gattin mit einer, am 8. December gegebenen[199] musikalischen Matinée förmlich öffentlich von Leipzig Abschied genommen hatte.
In Dresden wartete seiner eine schlimme Zeit; er war hier während des ersten Jahres sehr leidend, lebte zurückgezogener denn je, und war vor allem darauf bedacht, seine schwankende Gesundheit wiederherzustellen. Sein körperliches Befinden zeigte eine Reihe von krankhaften Symptomen, die in dem folgenden, von seinem damaligen Arzt Dr. med. Helbig herrührenden Berichte näher bezeichnet sind:
»Rob. Schumann kam im October 1844 nach Dresden und war namentlich durch die Composition des Epilogs von Göthe's Faust so sehr in Anspruch genommen worden, daß er bei Abfassung des. Schlusses dieses Musikstückes in einen krankhaften Zustand verfiel, der sich durch folgende Erscheinungen aussprach: Sobald er sich geistig beschäftigte, stellten sich Zittern, Mattigkeit und Kälte in den Füßen und ein angstvoller Zustand ein mit einer eigenthümlichen Todesfurcht, die sich durch Furcht vor hohen Bergen und Wohnungen44, vor allen metallenen Werkzeugen (selbst Schlüsseln), vor Arzneien und Vergiftungen zu erkennen gab. Er litt dabei viel an Schlaflosigkeit und befand sich in den Morgenstunden am schlechtesten. Da er an jedem ärztlichen Recepte so lange studirte, bis er einen Grund gefunden hatte, die ihm verschriebene Arznei nicht einzunehmen, so verordnete ich kalte Sturzbäder, welche auch seinen Zustand so weit verbesserten, daß er wieder seiner gewöhnlichen (einzigen!) Beschäftigung, der Composition, nachhängen konnte. Da ich eine ähnliche Gruppe von Krankheitszufällen mehrmals bei solchen Männern, namentlich bei Expeditionern, beobachtet hatte, welche im Uebermaaß mit einer und derselben Sache (stetem Addiren etc.) beschäftigt waren, so führte dies zu dem Rathe, daß Schumann sich mindestens zeitweis mit einer Geistesarbeit anderer Art, als Musik, beschäftigen und zerstreuen möge. Er wählte selbst bald Naturgeschichte, bald Physik etc., stand aber schon nach 1–2 Tagen davon ab, und hing, er mochte sein wo er wollte, in sich gekehrt seinen musikalischen Ideen nach.«
»Lehrreich für den Beobachter, waren die mit dem hohen Grad von Entwickelung des Musik- und Gehörsinnes zusammenhängenden Gehörstäuschungen und das eigenthümliche Gemüthsleben des Mannes.[200] Das Ohr ist der Sinn, welcher in Nacht und Finsterniß am thätigsten ist, am spätesten einschläft, am frühesten erwacht, durch den sich selbst bei Fortdauer des Schlafs auf den Menschen durch Zuflüstern wirken läßt, der am meisten mit dem Gefühlsvermögen in Verbindung steht und in dessen Nähe die Organe der Vorsicht, Rache, Offensive, des Tonsinns45 etc. gelegen sind. Wer die Attribute der Finsterniß und Nacht, welche aufzuzählen der Raum nicht gestattet, sich vergegenwärtigt und damit Schumann's Gemüthsleben vergleicht, dem wird hierüber Vieles erklärlich werden. Wenn wir bedenken, daß das Auge kein Licht empfinden, das Hirn keinen Gedanken verstehen könnte, wenn ersteres nicht Licht, letzteres nicht Gedanken in sich schaffen könnte, so wird uns auch ein Aufschluß über Schumann's Gehörstäuschungen werden.«
Schumann's Zustand wurde wieder so weit gehoben, daß der Meister sich von Neuem ungestört seinen Arbeiten hingeben konnte. Freilich war die krankhafte Anlage, in einem tieferen Leiden beruhend, nicht völlig zu heben, und in der Folgezeit traten mehr oder minder die Symptome desselben hervor, wie denn auch die meisten Briefe aus jener Zeit Klagen über körperliche Indisposition enthalten. So konnte er, wie man weiterhin aus einem Briefe an F. Hiller ersehen wird, den Anblick des Sonnenstein (eine Irrenanstalt bei Pirna in der Nähe von Dresden) nicht ertragen, und nach Mendelssohn's Dahinscheiden fühlte er in der Furcht, eines gleichen Todes sterben zu müssen,46 sich sehr niedergedrückt.47 Selbst seinen Freunden fiel Schumann's abnormer Zustand in besorgnißerregender[201] Weise auf, und Dr. Keferstein berichtet: »Als ich in den vierziger Jahren Schumann in Dresden aufsuchte, fand ich ihn bereits sehr leidend, durch anhaltendes Arbeiten waren seine Nerven so geschwächt, daß ich schon damals um sein Leben ernstlich besorgt wurde. – Auffallend war mir unter andern auch der Umstand, daß er mir Steinwein vorsetzte, den er sich für theures Geld vom Brockenwirth verschrieben hatte, indem er behauptete, daß er nirgends so gut zu haben sei. – Er mied geflissentlich allen Umgang48 und suchte mit seiner Clara die einsamsten Spaziergänge.« Professor Kahlert aus Breslau schreibt unterm 6. Januar 185749: »zum letzten Mal sahen wir uns (Kahlert und Schumann) im Herbst 1847 in Dresden. Er war eben aus dem Seebade zurückgekommen; Genoveva lag auf dem Clavier fast vollendet: einige Zweifel über die Construktion des Textes mußte ich unterdrücken, da sie zu spät gekommen wären.« Schumann schilderte mir den qualvollen Zustand seines Geistes vor der Seereise; »ich verlor jede Melodie wieder«, sagte er, »wenn ich sie eben erst im Gedanken gefaßt hatte, das innere Hören hatte mich zu sehr angegriffen.«
Alles vorstehend Mitgetheilte zusammengefaßt, macht es höchst wahrscheinlich, daß die Geistesumnachtung, der Schumann endlich in beklagenswerther Weise verfiel, die Folge eines organischen Leidens war, welches während des Dresdner Aufenthaltes bereits umfänglichere Dimensionen angenommen hatte. Als einen frühzeitigen Vorläufer davon könnte man jenen exaltirten Zustand betrachten, von dem der Meister nach dem Tode seiner Schwägerin heimgesucht wurde. Es kann keine Frage sein, daß Schumann's abermals und stärker hervorgetretener krankhafter Zustand einen Einfluß auf seine schöpferische Thätigkeit ausgeübt hat. Doch würde man sehr irren, wenn man voraussetzen wollte, daß die in die folgenden Jahre fallenden[202] Geistesprodukte, schon irgend welche Spuren des über Schumann verhängten tragischen Endes in und an sich trügen. Sie sind vielmehr trotz ihres mitunter düsteren Hintergrundes, mit voller geistiger Kraft gedacht und geschrieben. Als nachweisbare Folge seines Leidens dagegen dürften anzunehmen sein: zunächst zeitweilige Unterbrechungen des Schaffens, und dann eine auffallend große, mit 1847 beginnende Steigerung der productiven Thätigkeit, die im Jahre 1849, in welchem Schumann nahe an 30 Werke größeren und kleineren Umfanges schrieb, ihren Höhepunkt erreichte.
Wann Schumann sich in Dresden seinen musikalischen Arbeiten wieder aufs Neue zugewendet hat, ist unklar. Sein Compositionsverzeichniß enthält nur folgende Notizen:
»1845 (Dresden) Viele contrapunktische Arbeiten.50 – Vier Fugen für das Pianoforte (op. 72). – Studien für den Pedalflügel 1. Heft (op. 56). – 6 Fugen über den Namen Bach für Orgel (op. 60). – Skizzen für den Pedalflügel (op. 58). Intermezzo und Rondo, Finale als Schluß meiner Phantasie für Pianoforte – als Concert (op. 54) erschienen. – Symphonie für Orchester in C-dur skizzirt.«
Auch hier zeigt sich wiederum das Beharren in einseitigem künstlerischem Schaffen; in diesem Falle ist es aber, da die Mehrzahl der eben genannten Arbeiten dem strengen Styl angehört, ganz augenfällig, daß Schumann eine noch freiere Handhabung des Formellen erstrebte, als ihm bereits zu Gebote stand. Unser Meister erlangte dadurch insbesondere auch das Vermögen, in durchaus spontaner Weise charakteristische, für höhere contrapunktische Zwecke geeignete Ideen zu erfinden, ohne dies gerade absichtlich zu wollen, was ihm denn in einem gewissen Sinne für die weiterhin zu unternehmenden complicirteren Schöpfungen wesentlich zu Statten kam. Ueber diese Fähigkeit äußerte er gelegentlich: »es ist mir selbst eigenthümlich und wunderbar, daß fast jedes Motiv, welches sich in meinem Innern heranbildet, die Eigenschaften für mannichfache contrapunktische Combinationen mit sich bringt, ohne daß ich im Entferntesten auch nur daran denke Themen zu formiren, welche die Anwendung des strengen[203] Styles in dieser oder jener Weise zulassen. Es giebt sich unwillkürlich von selbst, ohne Reflexion, und hat etwas Naturwüchsiges.«
Die Studien op. 56 und die Skizzen op. 58 für den Pedalflügel51 sind anziehend durch das Combinatorische wie durch das Erfinderische. Die ersteren haben aber ungleich mehr Bedeutung als die zweiten; manches in ihnen klingt ziemlich stark an Bach'sche Kunst an, die Schumann dabei besonders vorgeschwebt haben mag. Von den beiden Fugenwerkenop. 72 und 60 beansprucht das letztere, welches 6 Fugen auf den Namen Bach enthält, eine außerordentliche Anerkennung. Namentlich die fünf ersten Fugen lassen eine so sichere und meisterliche Handhabung der strengsten Kunstformen erkennen, daß Schumann schon allein durch diese vollen Anspruch auf den Namen eines tiefsinnigen Contrapunktisten hat. Und wenn er auch hier, wie in vielen anderen seiner Werke das Streben erkennen läßt, durch einzelne formelle Modificationen neugestaltend zu wirken, so bleibt er doch in der Hauptsache den Traditionen der Kunst treu. Dabei offenbaren diese Arbeiten eine mannichfaltige Bildkraft auf ein und dieselben vier Noten. Der Grundton ist in allen 6 Stücken von einander abweichend, und, was immer als Hauptsache gelten muß, von poetischer Stimmung. Es sind eben ernste Charakterstücke. Die sechste Fuge scheint ein zu Gunsten der Praxis vielleicht nicht ganz lösbares Problem zu bieten, weil die darin zur Anwendung gebrachte gemischte Bewegung, auf der Orgel eine klare Darstellbarkeit in Frage stellen dürfte.
Das Clavierconcert op. 54, dessen erster Satz (»Phantasie« benannt) bereits 1841 geschrieben wurde, ist ein Meisterwerk in jeder Hinsicht. Für Schumann's Naturell lag es begreiflicherweise sehr nahe, das »Concert« im Anschluß an Beethoven zu behandeln. Wenn er nun auch hier wiederum, wie in der Symphonie, sich durchaus selbstständig zeigt, und sowohl hinsichtlich der formellen Gestaltung, so wie des eigenthümlichen zur Darstellung gebrachten Gehaltes, seinen[204] besonderen Weg geht, so läßt sich doch nicht verkennen, daß das in seinem A-moll-Concert entschieden in den Vordergrund tretende symphonische Element auf Beethoven zurückdeutet. Insbesondere ist dabei an dessen imposantes Es-dur-Concert zu erinnern, welches trotz wirksamster, ja glänzendster Herausstellung des Soloinstrumentes noch mehr den symphonischen Charakter festhält, wie die übrigen gleichartigen Compositionen des Großmeisters der Instrumentalmusik.
Vorzugsweise macht sich die symphonische Behandlung im ersten Satz von Schumann's Clavierconcert geltend. In demselben sind die leitenden Gedanken zur Hauptsache dem ersten Thema entnommen, welches in den verschiedenartigsten, rhythmisch wie metrisch auf überraschende Weise modificirten Wandlungen zum Vorschein kommt. Alles ist sehr wirksam angeordnet. Die Clavierpartie, ohne gerade in virtuosem Sinne besonders brillant zu sein, behauptet einerseits neben dem reich bedachten Orchester die volle Selbstständigkeit, während sie andererseits sich mit demselben in schönster Weise, auch da wo nur die Figuration vorwaltet, zu einem organischen Ganzen verbindet. Dieses Ganze ist in mancher Beziehung wesentlich abweichend von den seither befolgten Normen der Sonatenform; so insbesondere durch die Einführung eines langsamen Tempo's inmitten des Allegro's. Allein da die Formgebung durchweg übersichtlich und klar gehalten ist, so hat Schumann Recht, von der Tradition einmal abzugehen, um so mehr, als die Neuerung durch den natürlich sich entwickelnden Gedankengang motivirt wird. Im Grunde erweist sich die von Schumann ursprünglich gewählte Bezeichnung für dies erste Stück zutreffend, denn dasselbe hat in der That sehr viel von dem Wesen einer »Phantasie« an sich, und erinnert dadurch an so manche Claviercomposition der ersten schöpferischen Periode des Meisters.
Auch der zweite Satz, als »Intermezzo« bezeichnet, unterscheidet sich insofern vom Herkommen, als man an dessen Stelle ein Stück im langsamen Zeitmaaß gewohnt ist. Allein der Umstand, daß das erste Allegro bereits ein solches enthält, läßt die hier gemachte Ausnahme von der Regel völlig gerechtfertigt erscheinen. Dem großentheils leidenschaftlich erregten, in dem »Andante espressivo« jedoch überaus schwärmerisch gehaltenen ersten Stück, ist hier als Gegensatz ein seingestaltetes Tonspiel von graziösem Charakter gegenübergestellt. Dasselbe beginnt mit einer aus dem Hauptthema des[205] ersten Satzes abgeleiteten kleinen Figur, welche mit Ausnahme des gesanglich schönen Mittelsatzes im Verlaufe der zierlichen Piece auf sinnreiche Art durchgeführt ist. Dieser lediglich aus vier Tönen gebildeten Figur ist auch im letzten Stück eine nicht zu verkennende Bedeutung gegeben: sie erscheint sogleich im zweiten Takt des Final-Thema's, um dann noch öfters wiederzukehren. Dadurch erhalten alle drei Theile der Composition ein gemeinsames und, so zu sagen, inneres Bindeglied. Eine besondere Beziehung zum Thema des ersten Allegro's ist dem Schluß des Intermezzo's beim Uebergange in das Finale durch die den Holzbläsern zuertheilte Tonphrase gegeben.
Der an die Rondoform erinnernde letzte Satz bietet, im Besonderen betrachtet, einen großen Reichthum an interessanten Details, namentlich im Hinblick auf die ziemlich complicirten rhythmischen Verhältnisse. Die originelle Verbindung des 2/4 mit dem 3/4 Takt nach dem Eintritt des zweiten Thema's hat indessen bei aller Pikanterie in einzelnen Momenten etwas für den natürlichen Gedankenfluß Hemmendes. Im Uebrigen ist das prächtige Stück jovial, von heiterster Laune beseelt, und daher auch gleich den vorhergehenden Theilen, von zündender Wirkung. Die entsprechende Darstellung des ganzen Werkes bietet jedoch ungewöhnliche Schwierigkeiten und verlangt vom Spieler nicht allein volle Beherrschung der Claviatur, sondern eben so sehr eine hohe musikalische Intelligenz.
Die C-dur-Symphonie op. 61 endlich, der Entstehung nach die dritte, vollendet im Jahre 184652, ist als eine glücklich gesteigerte Fortsetzung der im Jahre 1841 unternommenen symphonischen Schöpfungen zu betrachten. Nach Schumann's eigener Angabe fällt die Conception dieser Symphonie noch in die Zeit seines krankhaften Zustandes. Er äußerte: »ich skizzirte sie, als ich physisch noch sehr leidend war; ja ich kann wohl sagen, es war gleichsam der Widerstand des Geistes, der hier sichtbar influirt hat, und durch den ich meinen Zustand zu bekämpfen suchte. Der erste Satz ist voll dieses Kampfes und in seinem Charakter sehr launenhaft, widerspenstig.«
Die Richtigkeit der vorstehenden Aeußerung leuchtet ein, wenn man sich gewisse Partien des ersten Allegro's und des Scherzo's[206] dieser Composition vergegenwärtigt. Allein es wird dadurch doch weiter nichts bezeugt, als daß Schumann bei Inangriffnahme dieses Werkes körperlich leidend war. Wichtiger für dasselbe ist die Thatsache, daß unser Meister diesen Zustand durch seine außerordentliche Willenskraft geistig besiegte, und trotz physischer Angegriffenheit ein Werk zu schaffen vermochte, welches als eines der glänzendsten Zeugnisse für seine geniale Begabung dasteht. Unbedenklich darf die C-Dur-Symphonie als die bedeutendste Leistung Schumann's in diesem Fache bezeichnet werden. Ein mannhaft straffer, kräftigst aufstrebender Zug, dem sich hier und da eine gewisse, keineswegs störend wirkende Herbheit beimischt, bildet den Grundcharakter dieser Symphonie, welche überdies reifer in ihrer Totalität und dazu bei weitem orchestraler gehalten ist, wie die schon betrachteten. Was derselben in rein musikalischer Beziehung einen sehr hohen Kunstwerth verleiht, ist die in ihr niedergelegte tief combinatorische Gedankenarbeit, welche vielfach eine wichtige Rolle spielt, ohne doch die kühn gezogenen Contouren des Ideenganges irgendwie zu überwuchern oder zu verdunkeln.
Dies zeigt insbesondere das erste Allegro, dessen Themen nebst deren Entfaltung hauptsächlich aus der ursprünglich zu etwas Anderem bestimmt gewesenen Einleitung »Sostenuto assai« abgeleitet sind. So ist der ganze Anfang des Allegro's aus dem zweiten Gliede des A-moll-Motiv's der Introduction entwickelt. Alsdann kommt weiterhin der 15. und 16. Takt der Einleitung als Zwischensatz zur Verwendung; und kurz vor der Reprise des ersten Theiles begegnen wir der, uns schon von dem Anfangstakt der Symphonie her bekannten Figur in Viertelbewegung. Dies Alles, wie Schumann gethan, in knappster Form so darzustellen, daß es als wohlgegliedertes organisches Ganze erscheint, ist eben die zu bewundernde Kunst des Meisters.
Der zweite Theil des ersten Satzes ist nicht minder anziehend durch die in ihm vollzogene thematische Arbeit. Nachdem die beiden Grundgedanken des ersten Theiles nochmals in neuer Beleuchtung nacheinander aufgetreten sind, erfolgt die Durchführung des schon erwähnten A-moll-Motiv's der Einleitung in geistreicher Verbindung mit der aufstrebenden Sechzehntheilfigur des Streichquartett's, die wir auch bereits im ersten Theil gehört haben. In ziemlich weit ausschweifender Modulation ist diese Durchführung[207] zwar etwas difficil, aber doch äußerst feinsinnig und spirituell gedacht. Die sich daranschließende, zum ersten Thema zurückführende breit ausgeführte Periode, entwickelt sich aus den uns schon bekannten Elementen mit einer, an Beethoven gemahnenden Energie in unausgesetzter Steigerung bis zu dem plötzlich im Piano eintretenden Orgelpunkt auf G, über welchem nun in reicher Harmonisirung das in Vierteln sich bewegende Motiv des ersten Taktes der Einleitung ausgesponnen wird. Die sehr eigenthümliche Wirkung dieser Stelle erhält noch einen besonderen Tonreiz dadurch, daß die Holzbläser jene von Geigen und Bratschen ausgeführten Tonfolgen in leicht nachschlagenden, und wie Thautropfen niederfallenden Achteln begleiten. Alsdann mit kurzer, sehr entschiedener Wendung im schnell anwachsenden Crescendo tritt auf's Neue das erste Thema, diesmal mit Aufbietung aller vorhandenen Instrumentalmittel und in größter, selbstbewußter Kraft ein, worauf sich mit modulatorischen Aenderungen der erste Theil des Allegro's in üblicher Weise wiederholt. Beschleunigten Tempo's führt die, gedanklich auf das Vorhergehende sich beziehende Coda den Satz in ungestüm vorwärts drängender Weise zu Ende. Ein stolz sich erhebender und in sich fest gefügter Tonbau steht vor uns, der mit Benutzung von einigen auf den ersten Blick unscheinbaren Bruchtheilen der stimmungsvollen und spannenden Introduction aufgeführt ist. Die dabei befolgte Methode der Gestaltung könnte man durchaus neu nennen, wenn nicht schon der erste Satz von Beethoven's vierter Symphonie annähernd ein Beispiel dafür darböte. Die demselben vorangestellte Einleitung deutet mehr oder minder auf die Hauptmotive des folgenden Allegro's hin; und wenn es auch noch nicht mit der Prägnanz geschieht, wie in der fraglichen Symphonie Schumann's, so ist von dem älteren Meister doch ein deutlicher Fingerzeig für eine derartige Behandlung gegeben. Schumann's Verdienst kann indessen dadurch nicht im Mindesten beeinträchtigt werden.
Das Scherzo ist als Fortsetzung der, dem ersten Stück eigenen Stimmung zu betrachten: die in scharf zugespitzten und eckigen Bewegungen gezogenen Linien der, von der Primgeige ausgeführten und von andern Instrumenten theilweise unterstützten Figuration, welche ununterbrochen fortläuft, kehrt mit einer Art verbissenem Humor immer wieder auf ein und denselben Punkt zurück, wodurch das Stück[208] den Charakter einer hartnäckigen Eigenwilligkeit erhält. Die Führung des Gedankenganges, welcher bis zu vollständiger Plastik herausgearbeitet ist, darf als eine höchst meisterhafte bezeichnet werden. Das in der Durtonart der Oberdominant von der gewählten Haupttonart stehende, mild versöhnende Trio thut doppelt wohl auf diesen heftigen Gefühlsausbruch, der alsbald wiederkehrt, um dann von dem zweiten noch besänftigender wirkenden Trio abgelöst zu werden. Der Grundgedanke desselben steht in verwandtschaftlicher Beziehung zu dem 11–13. Takt des ersten Trio's, so daß auch hier eine Ideenverbindung erkennbar ist, die für des Meisters Schaffen charakteristisch erscheint. Die Gestaltung im Einzelnen ist übrigens von sorgsamster Durchbildung: es sei nur an die feinsinnigen Uebergänge von beiden Trio's in das Scherzo erinnert, welches nach der dritten Wiederholung den ganzen Satz mit einer im energisch angespanntesten Ausdruck sich ergehenden, schwungvoll auslaufenden Coda abschließt.
Das dadurch stark erregte und in Vibration versetzte Gefühl, bedingt mit Naturnothwendigkeit einen Gegensatz, den uns der Tondichter denn auch in dem folgenden Adagio, einem herrlichen Stücke, giebt. Eine tief empfundene Cantilene, der sich eine leise Wehmuth beimischt, beginnt in den Geigen und geht dann in die Oboe über. Hoffnungbelebende Hornklänge ertönen. Doch die ergriffene Gefühlstonart hält an. Wiederum wird das erste Motiv nacheinander von der Clarinette, Flöte und Fagott, so wie von der Oboe in Verbindung mit den genannten Instrumenten ergriffen und vorgetragen. Da, mit dem Eintritt des As-dur, kommt ein lichter Moment, in welchem das gefesselte Gemüth frei aufathmen will. Die erste Geige, von der zweiten in der tieferen Octave unterstützt, steigt aufwärts, und in hoher Lage angelangt, löst sich die Melodie in eine Trillerkette auf, mit der das Gefühl in den ursprünglichen Ton allmählich zurückfällt. Grüblerisch versenken sich die Gedanken des Tondichters in einen contrapunktisch geführten Pianissimosatz, welcher nach zwölf Takten vom anfänglichen Thema in kunstvoller Weise überbaut wird. Aldann tritt mild ernst im klaren C-dur Beruhigung ein, und wie nun die Geigen abermals emporsteigen, da wird es hell und heller im Gemüth. Und taucht auch danach wie aus der Ferne nochmals ein wehmüthiger Anklang auf, der sich in den tiefliegenden Bässen verliert, so schließt doch das wunderbar schöne Stück in ruhig gefaßter Haltung.[209]
Wenn der lyrisch elegische Ton, in welchem das Adagio großentheils gehalten ist, noch als ein letzter Ausfluß jener Stimmung zu bezeichnen sein dürfte, aus welcher die beiden ersten Sätze hervorgegangen sind, so erhebt der Tondichter sich dagegen im Finale wieder zu voller Lebenslust. Ein frisches Thun und Treiben entfaltet sich da in ungebundener Heiterkeit, und in raschem Wechsel ziehen mannichfache Bilder des Frohsinns an uns vorüber. Selbst der Zwischensatz ernsteren Charakters, dessen melodisches Motiv zuerst von der Clarinette vorgetragen wird, hat durch seine Leidenschaftlichkeit etwas äußerst Lebenskräftiges, so daß wir durch denselben nicht der Grundstimmung des ganzen Satzes entfremdet werden. So geht es fort bis zu jener Stelle, wo der Strom der Empfindung durch eine Fermate plötzlich zum Stehen gebracht wird. Und nun stimmt der Meister in frommen Tönen einen Hymnus zum Dank für die wiedergewonnene Genesung an: es ist eine einfach schlichte Melodie53 von rührendem Ausdruck, die er zuerst gleichsam vor sich hin singt, und die dann in verschiedenartigster Weise, nur einmal durch eine bedeutungsvolle Reminiscenz des ersten Satzes unterbrochen, bis zum stolz und kraftvoll hinausgeführten Schluß intonirt wird. Das Finale dieser Symphonie zeigt übrigens in formeller Hinsicht eine freiere Gestaltung; es hat etwas Phantasieartiges.[210]
Das Jahr 1846 war für Schumann in quantitativer Hinsicht eben nicht ergiebig; sein Compositionsverzeichniß nennt außer der Vollendung des eben betrachteten Werkes nur noch die Chorlieder op. 55 und 59.54 Ohne Zweifel war sein körperliches Befinden einer reicheren Thätigkeit im Wege, und auch wohl mit die Ursache einer, Ende November oder spätestens Anfangs December desselben Jahres angetretenen Reise nach Wien, wohin sich seine Gattin zu Concerten begab. Das Künstlerpaar verweilte dort mehrere Wochen und gab vor der Rückkehr nach Dresden, am 15. Januar 1847, eine Abschiedsgesellschaft, bei welcher eine Elite von Kunstnotabilitäten versammelt war, unter ihnen: Bauernfeld, Deinhartstein, Dessauer, Eichendorf, Grillparzer, Vesque von Püttlingen (Hoven), Jansa, Jenny Lind, Adalbert Stifter etc. – Auf dem Heimwege wurden in Prag zwei glänzende Concerte veranstaltet, in denen Schumann nach Aufführung des Clavierquintetts und seiner zum Vortrag gekommenen Lieder, begeisterte Ovationen zu Theil wurden. An diese Excursion nach Süden knüpfte sich sogleich eine andere gen Norden. Schumann ging nach Berlin, um unter freilich erschwerenden Umständen, eine von der Singakademie veranstaltete Aufführung seines »Paradies und Peri« zu dirigiren. Nachdem noch zwei von seiner Gattin gegebene Concerte und eine in Schumann's Behausung veranstaltete musikalische Matinée stattgefunden, kehrte das Künstlerpaar Ende März nach Dresden zurück. Auch eines dritten Ausfluges, den Schumann mit seiner Gattin nach dreimonatlicher Ruhe, also im Juli 1847 unternahm, ist hier gleich zu gedenken. Er galt seiner Vaterstadt Zwickau. Man hatte dort ein kleines Musikfest veranstaltet, bei welchem es namentlich auf die Aufführung einiger Werke Schumann's abgesehen war. Von diesen enthielt das Programm die zweite Symphonie C-dur op. 61, das Clavierconcert op. 54, gespielt von Clara Schumann, und das Chorlied »zum Abschied« op. 84. Seine Compositionen dirigirte der Tondichter selbst; der andere Theil des Programms stand unter Leitung des städtischen MusikdirektorsDr. Emanuel Klitzsch. Es geschah Alles um die Gäste gebührend zu ehren. Auch an einem Fackelzug und einer Abendmusik fehlte es nicht. Für die letztere hatte [211] Dr. Klitzsch eigens eine Dithyrambe componirt. Die mit diesen Reisen verbundene Abwechselung und Zerstreuung mochte auf Schumann einen wohlthätigen Einfluß ausgeübt haben, denn es findet sich in seinem Compositionsverzeichniß eine ziemlich bedeutende Anzahl dem Jahre 1847 angehöriger Arbeiten vermerkt, deren Reihe wortgetreu folgende ist:
»2 Romanzen von E. Mörike für 1 Singstimme mit Pianoforte op. 64.55 Ouverture für Orchester zu Genoveva. – Der Schlußchor zur Scene aus Faust (Das Ewig-Weibliche zieht). (Dieses Musikstück hat, wie sämmtliche noch folgende Compositionen zum ›Faust‹ seine Stelle in dem nach des Meisters Tode veröffentlichten Cyklus ›Scenen aus Göthe's Faust‹ in 3 Abtheilungen [ohne Opuszahl] gefunden.) – 2tes Trio für Pianoforte, Violine und Violoncello (in D-moll) op. 63. – ›Lied zum Abschied‹ für Chor und Blasinstrumente (op. 84). 3tes Trio für Pianoforte, Violine und Cello (in F-dur) op. 80. – Vierzeilen und Ritornelle von Rückert als Canon's für mehrstimmigen Männergesang (8 Nummern) op. 65.56 ›Zum Anfang‹ von Rückert für 4stimmigen Männerchor. – 3 Gesänge von Eichendorf, Rückert und Klopstock für Männerchor (op. 62). – Solfeggien für Männerchor (noch nicht gedruckt). – Solfeggien für gemischten Chor (noch nicht gedruckt). – 1ster Akt zur, ›Genoveva‹ fertig skizzirt. – Lied von F. Hebbel für 2 Sopran und 2 Tenöre.«
Die beiden in dem vorstehenden Verzeichniß aufgeführten Claviertrio's op. 63 und 80 sind hier als zweites und drittes notirt, weil Schumann die unter der Werkzahl 88. herausgegebenen Phantasiestücke ursprünglich als erstes Trio bezeichnet hatte.57 Nachdem sich dies änderte, wurden die beiden im Jahr 1847 entstandenen Trio's, wie natürlich, der Reihe nach das erste und zweite. Von denselben behauptet das D-moll-Trio in Erfindung und Anlage ganz entschieden den Vorrang: es reiht sich hinsichtlich seines Kunstwerthes den besten Kammermusikstücken des Meisters ebenbürtig an. Der erste, sehr ernst und theilweise sogar finster gehaltene Satz, zeigt sich von einer an's Dämonische streifenden Leidenschaft erfüllt, die im Ganzen zwar beherrscht[212] ist, aber doch bisweilen gewaltsam durchbricht. Bedeutsame Seelenprocesse sind es, die hier mit ungewöhnlicher Energie zum künstlerischen Ausdruck gelangen. Nur spärliche Lichtblicke fallen in dies nächtliche Dunkel, und doch fühlt man sich wie von einem magischen Zauber festgehalten und zum Mitgenusse hingerissen.
Wohlthuend enthebt uns dieser schwülen Athmosphäre das ungemein frische, in fast übermüthiger Laune sich ergehende Scherzo, welches seinen natürlichen Gegensatz in dem dazu gehörenden milden, und anschmiegend zarten Trio findet. Beide Sätze stehen nicht nur in derselben Tonart, es liegt ihnen auch ein und dasselbe Motiv zu Grunde: nur mit dem Unterschied, daß es im Scherzo punktirt und also im springenden Rhythmus auftritt, während es im Trio legato und durch die Umkehr verlängert, in gleichmäßiger Viertelbewegung wieder erscheint, – eine ganz originelle Idee, merkwürdig besonders dadurch, daß sich im Hinblick auf das in zwiefacher Weise benutzte Motiv keinerlei Monotonie bemerkbar macht.
Ein poetisch empfundenes in sanfter Klage sich ergehendes Adagio, dessen Mittelsatz sich zu affektvoller Empfindung erhebt, leitet zum Finale hinüber. Dieses, von schwungvollem melodischen Zuge erfüllt, ist mit Ausnahme des herabgestimmten Seitensatzes von außerordentlich feurigem Charakter und beschließt das Werk in glänzender Weise. Die Form lehnt sich, wie auch in den andern Claviertrio's des Meisters, im Allgemeinen an die Ueberlieferungen an.
Nicht auf gleicher Höhe mit dem eben erwähnten Werk steht als Ganzes das Claviertrio op. 80 in F-dur. Der Schwerpunkt desselben liegt in den beiden mittleren, sehr schönen Sätzen, die einen Anflug von Schwermuth, gleich einem tiefen Abendroth an sich tragen, während der Anfangs- und Schlußsatz, obwohl lebendig und heiter, nicht eben von höherer Bedeutung sind. Immerhin ist auch hier die Hand des verehrten Meisters zu erkennen, und namentlich das erste Stück hat etwas freundlich Anmuthendes, besonders in seinem Mittelsatz, dessen Thema auf angenehme Weise an das reizende Lied: »Dein Bildniß wunderselig« erinnert.
Die größte und bedeutsamste im Jahre 1847 begonnene, jedoch erst Anfang August 1848 völlig beendigte Arbeit, die Oper Genoveva, giebt zu mannichfachen Betrachtungen Anlaß. Wie man gesehen, dachte Schumann schon im Jahre 1840 daran,58 sich auch in der, so[213] zu sagen schwierigsten aller Kunstgattungen, der Oper, zu versuchen. Lebhaft empfand er mit Anderen den vom dramatischen Gesichtspunkte aus unhaltbaren Zustand dieser Kunstgattung in der Neuzeit, und erfüllt von dem rühmlichen Streben, redlich mitzuhelfen an einer Reinigung, Hebung und Regenerirung derselben, wünschte er auch hier seine anderweit so einflußreiche Wirksamkeit zur Geltung zu bringen. In diesem Sinne schrieb er unterm 1. Septbr. 1842 an C. Koßmaly: »Wissen Sie mein Morgen- und Abendliches Künstlergebet? Deutsche Oper heißt es. Da ist zu wirken.« Der Gedanke an eine dramatische Arbeit beschäftigte ihn unausgesetzt, wie auch folgende briefliche Aeußerung gegen Zuccalmaglio vom 23. Januar 1844 zeigt: »Nun möchte ich bald an eine Oper; da wirst sich der nordische Reiseplan dazwischen, und ich muß alle Pläne und Vorarbeiten vor der Hand liegen lassen.«
Wie wenig nun auch Schumann's künstlerisches Naturell der Bühne entsprach, so ist nichts desto weniger bei einem so reich ausgestatteten Geiste der Drang nach einer Leistung für dieselbe erklärlich. Und obwohl der Meister hier nicht jenen glücklichen Erfolg erzielte, der seine sonstige produktive Thätigkeit krönte, so erscheint doch der Versuch, sich in der complicirtesten gegebenen Kunstform zu bethätigen, vollkommen berechtigt und begreiflich. Hieran vermag selbst der Umstand nichts zu ändern, daß Schumann's einzige Oper nur die Geltung eines Versuchs, und zwar, wenn man sich an den rein dramatischen Theil derselben hält, diejenige eines nur theilweise geglückten beanspruchen kann.
Lange war Schumann mit sich über die Wahl des Süjets uneinig. In seinem Projektirbuch hatte er nach und nach folgende Stoffe verzeichnet: »Faust, Till Eulenspiegel, el galan (Calderon), Janko (Beck), Niebelungenlied, Wartburgkrieg, Brücke von Mantible (Calderon), Abälard und Heloise, der falsche Prophet (aus Lalla Rookh), der letzte Stuart, Kunz v. d. Rosen, Atala (Chateaubriand), die hohe Braut (König), der Paria, der Corsar (Byron), Maria Stuart, Sakontala (Uebersetzung von Gerhard), der deutsche Bauernkrieg (Kolhas), Sardanapal (Byron), die Glockendiebe (Mörike), der steinerne Fingerzeig (Immermann), der Schmied von Grethna-Green, und der todte Gast (L. Robert).« Auch anderen Stoffen hatte der Meister seine Aufmerksamkeit zugewendet. So schreibt er an Zuccalmaglio: »Mokanna hab' ich trotz Einwürfe noch keineswegs aufgegeben;[214] aber er ist aus demselben Buche, dem ich die ›Peri‹ entnahm, spielt auch im Orient – darum will ich ihn mir für später aufheben. Am meisten sagt mir Ihr letzt gegebener Text ›Der Einfall der Mauren in Spanien‹ zu. Möchten Sie auch darüber nachdenken!« – In wiefern die vorgenannten Werke sich zur Verwendung für ein dramatisch-musikalisches Kunstwerk eignen, ist hier nicht zu erörtern; es genüge die Bemerkung, daß Schumann keinen einzigen derselben benutzte. Seine Absicht, eine Oper zu componiren, verwirklichte sich auf anderem Wege. Der erste Anstoß dazu ging von Hebbels Drama »Genoveva« aus, welches Schumann Anfangs 1847 kennen lernte. Diese Schöpfung erfüllte und begeisterte ihn so sehr, daß er sie mit gleichzeitiger Berücksichtigung der Tieck'schen »Genoveva« zur Grundlage eines musikalisch dramatischen Kunstwerkes zu machen beschloß.59 Alsbald wandte er sich an den bekannten, 7. Februar 1852 zu Dresden verstorbenen Malerdichter Robert Reinick, um denselben zu einem Textentwurf in gedachtem Sinne zu veranlassen. Dieser zeigte sich dem Wunsche des befreundeten Meisters geneigt, glaubte aber, daß es im Interesse der Sache sei, sich vornehmlich an die Genoveva-Sage selbst zu halten. Sehr richtig hatte er empfunden, daß eine Genoveva ohne Kind und Hirschkuh gar keine sei, und nur mit Widerstreben auf Schumann's dringendes Begehren von diesen Attributen bei der Bearbeitung abgesehen. Dagegen scheint ihm die vielleicht unlösbare Schwierigkeit entgangen zu sein, aus zwei so scharf entgegengesetzten Producten, wie die romantisch zerfließende Dichtung Tiecks und das etwas haarsträubende, ungeheuerliche Drama Hebbels, etwas drittes Lebensfähiges hervorgehen zu lassen.
Reinick hatte zwei verschiedene Entwürfe gemacht; in dem einen derselben war die Verbannung Genoveva's, mit der Absicht eine anderweite Handlung einzuschieben, in ausgedehnterer Weise behandelt. Hiervon sah Schumann indessen ab, und sein Wunsch, Verbannung und Rettung der Genoveva im vierten Akt unmittelbar aufeinander folgen zu lassen, blieb maaßgebend.
Trotzdem sich Reinick den Wünschen Schumann's in jeder Weise zu accomodiren suchte, genügte diesem doch die dichterische Behandlungsweise[215] des Stoffes keineswegs. Schon nach Vollendung der beiden ersten Akte wandte er sich brieflich an Hebbel mit der Bitte, ihm rathend und helfend beizustehen.60 Des Dichters zu gewärtigende Anwesenheit in Dresden, welche Ende Juli 1847 erfolgte, gab Schumann erwünschte Gelegenheit zu einer persönlichen Zusammenkunft mit demselben. Diese war indessen für den angestrebten Zweck erfolglos. So sah sich denn Schumann schließlich in Betreff des Textes, den Reinick inzwischen beendet hatte, auf seine eigene Kraft angewiesen. Er benutzte des Verfassers mehrwöchentliche Abwesenheit von Dresden zu den ihm nöthig scheinenden Abänderungen, und das Buch zur Genoveva erhielt in Folge dessen seine gegenwärtige Gestalt. Dieselbe war so abweichend von der Reinick'schen Fassung, daß dieser, nachdem er die Varianten kennen gelernt, sich veranlaßt fand, auf seine Autorschaft Verzicht zu leisten. Aus diesem Grunde heißt es auf dem Titel des gedruckten Textbuches auch nur einfach »nach Tieck und Hebbel«.
Nun war Schumann zufrieden mit der stofflichen Unterlage zu seiner Oper: die dem Text anhaftenden dramatischen Mängel waren ihm nicht zum Bewußtsein gelangt. »Genoveva! dabei denken Sie aber nicht an die alte sentimentale. Ich glaube, es ist eben ein Stück Lebensgeschichte, wie es jede dramatische Dichtung sein soll: wie denn dem Texte mehr die Hebbel'sche Tragödie zum Grund gelegt ist«, schreibt er an H. Dorn.61
Diese illusorische Aeußerung steht im Widerspruch zur Sache selbst, wie ein Blick auf die Handlung lehrt, welche sich aus folgenden Vorgängen zusammensetzt.
Pfalzgraf Siegfried steht im Begriff, auf das Geheiß Carl Martell's mit seiner Kriegerschaar aufzubrechen, um die von Spanien aus nach Frankreich eingefallenen, das Christenthum bedrohenden Mauren zu vertreiben. Daheim läßt er die jugendliche Gattin Genoveva zurück, deren Obhut er seinem bevorzugten Schützling Golo, dem »Nächsten seines Hauses« anvertraut. Dieser, von einer sträflichen Liebe zu seiner tugendhaften Gebieterin erfaßt und beherrscht, wünscht mit in den Krieg zu ziehen: der Gedanke, für den Gegenstand seiner verbotenen Neigung verantwortlich sein zu sollen, ist ihm unerträglich;[216] lieber möchte er auf dem Felde der Ehre sterben. Doch er muß dem Willen des Gebieters sich fügen und zurückbleiben.
Mit seinen Reisigen zieht Siegfried von dannen; Genoveva vom Schmerz des Abschiedes überwältigt, sinkt ohnmächtig in die Arme Golo's. Alsbald entbrennt in ihm die Begierde der Sinnlichkeit; es verlangt ihn danach, die Bewußtlose zu küssen, und schon im nächsten Augenblick geschieht dies wirklich. Nun wird in ihm die Sprache des Gewissens laut. Er fühlt deutlich die an seinem Herrn und dessen Gattin begangene Ehrlosigkeit und will, um der Erinnerung an dieselbe ledig zu werden, entfliehen. Aber Golo's Amme Margarethe, welche, nachdem sie schimpflich aus dem Schlosse gewiesen, wieder herbeigeschlichen ist, um sich an dem Grafen zu rächen, weiß ihn davon zurückzuhalten. Das bösen Zauberkünsten ergebene Weib belauschte ihn, als er den hilflosen Zustand Genoveva's mißbrauchte, und indem sie es ihm offenbart, gewinnt sie ihn durch die Reizung seiner Leidenschaft, so wie durch die hoffnungerweckende Vorspiegelung die Gebieterin sein nennen zu sollen, für ihre im Innern geplanten teuflischen Absichten.
Im zweiten Akt sehen wir Genoveva in Bekümmerniß des weit entfernten Gatten gedenkend. Da plötzlich ertönt von der Gesindestube herauf lärmender Gesang der zum Zechgelage versammelten Knechte. Unterdessen betritt Golo das Gemach seiner Herrin – es geschieht zu später Abendstunde – unter dem Vorwande, ihr Meldung von einem über Abderrhaman, den Führer der Mauren, erfochtenen Siege machen zu wollen. Angenehm ist er überrascht, dieselbe allein zu finden. Seine Gelüste, dadurch stärker angefacht, treiben ihn vorwärts, und während des von Genoveva begehrten Liedes »Wenn ich ein Vöglein wär«, in welches sie unbefangen und naiv im treuen Gedenken an ihren Gatten miteinstimmt, gelangt die in ihm mit verstärkter Macht auftretende Leidenschaft zum Durchbruch. In rasender Verblendung wirst er sich der Gebieterin zu Füßen, und nachdem er ihr geoffenbart hat, was in ihm vorgeht, sucht er durch ungestümes Auftreten die Wehrlose für sich zu gewinnen. Allein Genoveva, im Innersten empört, schleudert dem Pflichtvergessenen in ihrer Bedrängniß das brandmarkende Wort, »ehrloser Bastard« entgegen. Golo, niedergeschmettert durch diese ihm unerwartete Wendung, und vor innerer Wuth grollend, sendet Genoveva, nachdem dieselbe sich entfernt hat, einen Fluch des Verderbens nach.[217]
In demselben Augenblicke erscheint Drago, welcher vom Grafen bei seinem Abzug der Dienerschaft vorgesetzt wurde. Er führt Klage wegen der von dem Gesinde über die Gebieterin ausgesprochenen Lästerungen. Man habe sich erfrecht zu sagen, die Gräfin sei mit dem Caplan vertrauter, als es Graf Siegfried wissen dürfte, so fügt er hinzu.
Vom bösen Dämon geleitet, sucht Golo diese Mittheilung als wahr zu bestätigen, und noch glaubwürdiger durch die Behauptung zu machen, daß Genoveva den Caplan alsbald in ihrem Schlafgemach empfangen werde, um mit ihm zu beten, »daß Graf Siegfried nie wiederkehren möge«.
Der alte treue Diener des Hauses, überzeugt von Genoveva's Unschuld, will sich nun, um die letztere desto unwiderleglicher bezeugen zu können, im Schlafgemach verbergen, um unbeachtet das angebliche Rendez-vous belauschen zu können. Er thut's auch wirklich, und nun begiebt sich Golo eiligst hinweg, um im Einverständniß mit Margarethen die Dienerschaft zur Ausspäherei abzusenden, in der Voraussetzung, daß Genoveva sich zur Ruhe begeben hat. Einer der ins Wohnzimmer eindringenden Knechte weist auf das Schlafgemach und befiehlt die Thür desselben zu bewachen, damit Niemand entschlüpfen könne. Genoveva, deren Aufmerksamkeit durch diesen Vorgang erregt worden ist, erscheint wieder, um nach dem Grunde desselben zu forschen. Die versammelten Dienstleute antworten, sie suchten Golo, den sie in der Gräfin Schlafgemach wohl finden würden. Indessen kommt dieser selbst unter dem, mit heuchlerischer Verstellung ausgesprochenen Vorwande herbei, die Herrin vor der Zudringlichkeit des Dienertrosses schützen zu wollen. Das Gesinde giebt sich jedoch nicht zufrieden, und dringt in Genoveva's Zimmer ein. Zu gleicher Zeit stürzt Drago aus seinem in demselben innegehabten Versteck hervor, um Erbarmen bittend. Ohne ihn anzuhören, wird er als vermeintlicher Schuldiger von einem der Knechte sofort erstochen, während Genoveva ohne Weiteres des Ehebruchs beschuldigt, und in den Gefängnißthurm des Schlosses abgeführt wird, – ein sehr schwacher Moment der Handlung, welcher jeder wirklichen, inneren Motivirung entbehrt.
Margarethe, die beim Schluß dieser Scene für einen Augenblick auftritt, um die erregte Menge in ihrem Verdacht gegen die Gräfin durch einen Zuruf zu bestärken, eilt nun nach Straßburg, wo[218] Siegfried nach glücklich beendetem Maurenkriege auf dem Heimwege durch eine Verwundung zurückgehalten wird.
Hier erscheint sie mit Beginn des dritten Aktes angeblich als Pflegerin des Grafen, den sie jedoch in Wirklichkeit durch einen Gifttrank bei Seite zu schaffen beabsichtigt. Da der letztere nicht die gewünschte Wirkung thut, sucht sie den von seiner Verwundung Genesenen dadurch zurückzuhalten, daß sie ihm Schonung anempfiehlt und zugleich einlädt, in ihrer Behausung einmal einen Blick in den dort aufgestellten Zauberspiegel zu thun, um von demjenigen Kenntniß zu erlangen, was inzwischen in seinem heimathlichen Schlosse vorgegangen ist.
Den Grafen verlangt es indessen nach Hause. Im Begriff dahin abzugehen, tritt aber Golo verstörten Antlitzes mit einem Schreiben von Siegfried's Hauscaplan ein, in welchem derselbe Anzeige von dem der Gräfin schmählich aufgebürdeten Verbrechen erstattet. Siegfried empfängt gläubig die schlimme Botschaft, und in seiner Verzweiflung giebt er Golo den Auftrag, Genoveva sogleich tödten zu lassen. Im Begriff ihm zum Beweise dessen seinen Ring und das von ihm geführte Schwert zu übergeben, erinnert er sich Margarethen's Zauberspiegel, den er erst, ehe sein Befehl vollstreckt wird, befragen will. Dieser zeigt ihm den erdichteten vertraulichen Verkehr Genoveva's mit Drago in drei verschiedenen Bildern. Empört über das Gesehene, fordert Siegfried den Golo auf, ihn zu rächen, und sein Schwert ziehend, zertrümmert er zugleich den Spiegel, in welchem nun zum Entsetzen Margarethen's der Geist des ermordeten Drago erscheint, und zwar mit der Forderung, dem Grafen den verübten Betrug sofort zu entdecken.
Der vierte und letzte Akt zeigt uns zunächst die einsame Waldesstätte, an welcher Genoveva den Tod erleiden soll. Zwei ihrer Knechte führen sie daher. Sie singen auf- und abgehend ein »Gaunerlied«, während Genoveva im Vordergrunde der Bühne vor einem Marienbilde wehklagend und betend sich auf ihr Ende vorbereitet. Da tritt Golo auf. Noch einen Versuch unternimmt er, um die Gunst Genoveva's zu erlangen. Und nachdem auch dieser sich als fruchtlos erwiesen, ruft er die Knechte herbei, um den Befehl Siegfried's an dessen Gattin vollziehen zu lassen, was jedoch durch die plötzliche Dazwischenkunft eines seiner Herrin treu gebliebenen Dieners, so wie durch die inzwischen von Margarethe abgelegten Geständnisse[219] verhindert wird. Denn sogleich erscheint auch Siegfried auf dem Schauplatz, um seine schwer geprüfte schuldlose Gattin zu versöhnen und sie, vom jubelnden Volk begleitet, im Triumph nach dem Schlosse zurückzugeleiten.
Es ist aus der in gedrängter Kürze vorstehend mitgetheilten Handlung leicht zu erkennen, daß das im Allgemeinen wenig wirksame dramatische Gefüge zur »Genoveva« in Anlage und Ausführung der Hauptmomente von einer unsicheren und in Bühnendingen unerfahrenen Hand herrührt. Die Motivirung im Einzelnen ist mühsam und dabei nicht überzeugend, ja theilweise sogar unwahrscheinlich. So fehlt denn den dargestellten Vorgängen mehrentheils die Signatur der Nothwendigkeit und inneren Wahrheit. Oder muß es nicht sehr befremdlich erscheinen, daß Siegfried einen Mann, den Genoveva mit dem Namen »ehrloser Bastard« an seine zweideutige Herkunft zu erinnern genöthigt ist, zum Beschützer seines Weibes und Hüter seines Hauses bestellt? Und warum die moralisch verkommene Margarethe in dem Augenblick, wo sie den Zweck der Rache erreicht hat, eiligst ihre Unthaten bekennt, ist schwer einzusehen. Die gespenstige Erscheinung des schuldlos umgebrachten Drago kann für ein so entartetes Geschöpf sicher nicht als ein ausreichendes Motiv zur schleunigen Bekehrung gelten. Endlich wirkt es wesentlich beeinträchtigend und illusionsraubend, daß der von Golo bezüglich der fingirten Buhlschaft mit Genoveva vorgeschobene, und ohne Weiteres ermordete Drago ein alter, greiser Mann ist.
Aber auch die Zeichnung der Hauptfiguren darf, mit Ausnahme Genoveva's, welche allerdings dem Autor des Textes keinerlei Schwierigkeiten bereiten konnte, als mehr oder minder verfehlt bezeichnet werden. Graf Siegfried zeigt sich als ein unselbstständiger Charakter, indem er in die bloßen Aussagen Anderer mehr Vertrauen setzt, als in die Treue und Keuschheit seiner Gattin, und zwar, ohne auch nur einen Versuch zu machen, sich von der Wahrheit der vorgebrachten Verläumdungen zu überzeugen.
Golo dagegen schwankt auf bedenkliche Art zwischen einer gewissen Anständigkeit und verletzenden Niedrigkeit der Gesinnung. Seine Leidenschaft für Genoveva ist, so wie sie hier zur Darstellung kommt, eine krankhaft erregte. Dabei zeigt er nicht einmal rechte Thatkraft: wiederholt muß er sich von Margarethe zum Handeln antreiben lassen. Im Ganzen erweist er sich als eine problematische, für Bühnenzwecke wenig geeignete Figur.[220]
Daß auch Margarethe, die das böse Princip darstellen soll, nicht bestimmt gezeichnet und einheitlich durchgeführt ist, wurde schon angedeutet.
Vergegenwärtigt man sich die dem Werke zu Grunde liegende Legende, so erkennt man leicht, daß der schönste Theil derselben auf ein Minimum reducirt worden ist. Das kummervolle, thränenreiche Leben der schuldlosen Gattin in der Einöde; die Wunder welche zur Erhaltung ihrer selbst und ihres Kindes geschehen, ja das Kind selbst, – Alles dies, was so tief im sittlichen Gefühl begründet ist, zur innigen Mitleidenschaft anregt, und mit dem Volksbewußtsein von der »Genoveva« aufs engste, unzertrennbarste verbunden ist, kommt hier in Wegfall. Die Verbannung der Gräfin ist in den letzten Akt verlegt. Kaum hat sie begonnen, so wird sie auch wieder aufgehoben, und Genoveva kehrt ebenso schnell in ihr Schloß zurück, als sie es verlassen.
Man könnte entgegnen, daß es sehr schwierig, vielleicht sogar unmöglich sei, die angedeuteten Momente der Legende dramatisch darzustellen; allein dies wäre blos ein Fingerzeig dafür, daß man einen Stoff für die Bühne nicht wählen soll, dessen Brauchbarkeit zur Dramatisirung zweifelhaft ist.
Soweit der Text; die Musik, ohne Vergleich werthvoller als dieser, offenbart, wie immer bei Schumann, einen seltenen Reichthum schöpferischer Kraft, getragen von wahrhaft künstlerischer Auffassung. Schumann braucht für seine Zwecke die mannichfachen Kunstmittel in edelster Richtung. Nie läßt er sich dazu verleiten, auf den so verlockenden äußeren Bühneneffekt hinzuarbeiten, denn alles Scheinwesen war ihm in tiefster Seele verhaßt. Daher ist denn auch einerseits in der Genoveva Alles vermieden, was an den blos virtuosenhaften Bravourgesang erinnern könnte, und andererseits empfangen wir den Eindruck, daß die Ensemblesätze und insbesondere auch die Chorgesänge in spontaner Weise aus der Handlung selbst hervorgehen. Die Formgebung fußt im Wesentlichen auf den mit meisterlicher Freiheit gehandhabten künstlerischen Ueberlieferungen. Nur das recitativische Element ist hiervon auszunehmen, an dessen Stelle eine gebundene, bald ermüdende Deklamation tritt. Schumann war der Ansicht, daß das Recitativ sich überlebt habe, und daß es unmöglich sei, dasselbe in der herkömmlichen Weise fortzubehandeln. Trotz der Umgehung des Recitativs in der Genoveva hegte er aber die feste Ueberzeugung, daß dieses Werk keinen Takt enthielte, der nicht durch und durch dramatisch sei.[221]
Die Oper beginnt mit einem choralartigen, in seinem Anfange an die Kirchenmelodie: »Ermuntre dich mein schwacher Geist« erinnernden Gesange des, vor der Schloßkapelle knieenden Volkes, in welcher Bischof Hidulfus aus Anlaß der gegen die Mauren zu eröffnenden Fehde eine gottesdienstliche Handlung celebrirt. Die vier Stimmen des Chores sind bis auf zwei Takte durchweg im Unisono gehalten, während das Orchester die feingewählte harmonisch modulatorische Führung übernimmt, wodurch dieser Tonsatz in eindringlicher Weise den von Schumann beabsichtigten populären Charakter erhält. Beim Schluß des Stückes tritt Hidulfus mit großem Gefolge aus der Kirche, um das Volk in einer Ansprache zu dem bevorstehenden Kriegszuge anzufeuern. Hierbei entwickelt sich ein effektreicher Wechselgesang zwischen der Menge und dem Bischof. Derselbe intonirt weiterhin die zu Anfang erklungene choralartige Melodie, in welche das andächtige Volk alsbald begeistert mit einstimmt. Diese Exposition ist glücklich gedacht und musikalisch von eingreifender Wirkung.
Der bischöfliche Zug verläßt die Bühne und ihm folgen alle Anwesenden bis auf Einen. Es ist Golo. Die zwiespältige Empfindung, von der er im Hinblick einerseits auf Genoveva, und andererseits auf den in Aussicht stehenden Krieg erfüllt ist, von welchem er sich gegen seinen Wunsch ausgeschlossen sieht, hat Schumann geistvoll in frei behandelter Arienform zum Ausdruck gebracht. Allein es ist im Grunde doch nur die Tonsprache des sein und minutiös empfindenden Lyrikers, die bei sorgsamster Erwägung und Berücksichtigung aller Einzelmomente sich nicht zu dem hohen Schwunge dramatisch leidenschaftsvollen Affektes zu erheben vermag. Dies macht sich mehr oder minder auch in den übrigen Gesängen Golo's fühlbar, und selbst da, wo das dämonische Element bei ihm zu Tage tritt, wie z.B. in der Scene, wo er den Fluch über Genoveva ausspricht, läßt sich die intensive Energie des musikalischen Ausdrucks vermissen.
Aehnlich verhält es sich mit Margarethe's Charakterisirung. Alles was sie zu singen hat, ist geistreich concipirt, und an sich in tonkünstlerischer Hinsicht vortrefflich, leidet aber an einem etwas bläßlichen Colorit.
Siegfried ist als ein Mann von gutmüthigem aber unkräftigem Wesen hingestellt, und dem entspricht auch die musikalische Behandlung, für die man sich nicht erwärmen kann, so angenehm sie auch erscheint.
Am Gelungensten ist ohne Frage Genoveva gezeichnet. Ihrer[222] mehr passiven Haltung entspricht allerdings am meisten das lyrische Empfinden unseres Meisters. In ihren Gesängen liegt etwas Unschuldvolles und antheilerweckend Rührendes. Und so zeigt sich denn auch hier wiederum, wie in dem Liedercyklus »Frauenliebe und Leben«, und in »Paradies und Peri« Schumann's unvergleichliches Vermögen für die Wiedergabe des echt Weiblichen in der schönsten Weise.
Von vortrefflicher Wirkung, auch in scenischer Beziehung, sind die Chöre des Werkes, insbesondere in den beiden ersten Akten.
Endlich ist auch noch der sehr wirksamen Musik zu gedenken, welche Schumann zu den von Margarethe im Zauberspiegel gezeigten Bildern gesetzt hat. Die Ouvertüre ist ein charaktervolles, herrliches Musikstück, von hohem Kunstwerth, und den besten Instrumentalwerken Schumann's beizugesellen. Sie bringt auf meisterhafte Weise den geistigen Gehalt des poetischen Stoffes in einfach großen Zügen zum Ausdruck, obwohl nicht in theatralisch decorativer Manier, sondern vielmehr in echt musikalischem Sinne; weshalb sie denn auch ohne Frage im Concertsaal weit mehr zur Geltung gelangt, wie vor den Lampen des Prosceniums.
Ziehen wir die Summe, so ist bei aller Ehrerbietung vor dem großen Genius unseres Meisters zu sagen, daß seine Genoveva als Bühnenwerk nicht den gewünschten und gehofften Erfolg erlangen konnte. Als Grund davon ist nächst dem Texte die vorwiegend lyrische Beschaffenheit seiner Begabung anzusehen, welche er eben nicht in dem Maaße zu verläugnen vermochte, um durchaus die Höhe dramatischen Ausdruckes zu gewinnen. Die früheren Vocalcompositionen Schumann's, welche einzelne glückliche Anläufe zum Dramatischen erkennen lassen, konnten vielleicht den Meister hierüber täuschen. Seine erste und letzte dramatische Arbeit zeigt indessen, daß die Bühne nicht das eigentliche Feld seiner schöpferischen Thätigkeit war. Und dennoch ist sehr zu wünschen, daß diese in edelster Richtung gehaltene Oper trotz der Bedenklichkeiten des Textes auf allen größeren deutschen Theatern, namentlich aber auf den Hofbühnen heimisch werde, wäre es auch nur, um die schöne Musik dem größeren Publikum zugänglich zu machen. Ohne Frage dürfte eine geschickte Regie auch im Stande sein, durch zweckmäßige Aenderungen manches der Wirkung entgegenstehende Moment des Textes zu beseitigen.
Möchte denn das gute Beispiel, welches in dieser Hinsicht neuerdings Berlin, Carlsruhe, Dresden, München, Hamburg, Wien, Weimar,[223] und insbesondere Wiesbaden62 gegeben hat, bald weitere Nachfolge finden. Es gilt, das Werk eines dem deutschen Volke theuer gewordenen Meisters lebendig zu erhalten.
Ihre erste scenische Darstellung erlebte die Genoveva am 25. Juni 1850 auf der Leipziger Bühne.63 Ihr folgten am 28. und 30. desselben Monats noch zwei weitere. Die beiden ersten Aufführungen leitete Schumann persönlich.
Wie bereits erwähnt, wurde diese unter der Werkzahl 81 veröffentlichte Schöpfung schon im Jahre 1847 begonnen, jedoch erst 1848 vollendet, und zwar nach Schumann's Compositionsverzeichniß am 5. August.
Außerdem nennt das letzte für das Jahr 1848 noch:
»3 Gesänge von T. Ullrich, F. Freiligrath und J. Fürst für Männerchor mit Begleitung von Harmoniemusik (ad libitum)64 – Chor zu Faust ›Gerettet ist das edle Glied‹ B-dur.
Vom 30. August bis 13. September: Weihnachtsalbum für Kinder, die gern Clavier spielen (42 Stücke) (op. 68).
Im October Ouverture zu Byron's Manfred für Orchester (op. 115). Bis 23. November: die übrige Musik zu Byron's Manfred (op. 115).
Vom 25. November bis 20. December: ›Dein König kömmt in niedern Hüllen‹, von Rückert, Cantate für Chor und Orchester (op. 71)65.
Im December 3 Stücke zu vier Händen für das Clavier. Noch 3 Stücke zu vier Händen (op. 66). 5 zweihändige Stücke für Clavier (Waldscenen).«
Von den vorstehend aufgeführten Compositionen seien zunächst die im December 1848 entstandenen 6 vierhändigen Clavierstücke hervorgehoben, welche Schumann als op. 66 unter dem Titel »Bilder aus Osten« veröffentlichte. Diese ungewöhnliche Bezeichnung machte[224] eine Erklärung Seiten des Componisten erwünscht, und so fügte Schumann diesem Werke folgende »Vorbemerkung« hinzu: »Der Componist der nachfolgenden Stücke glaubt zu ihrem bessern Verständniß nicht verschweigen zu dürfen, daß sie einer besonderen Anregung ihre Entstehung verdanken. Die Stücke sind nämlich während des Lesens der Rückert'schen Makamen (Erzählungen nach dem Arabischen des Hariri) geschrieben; des Buches wunderlicher Held, Abu Seid, – den man unserm deutschen Eulenspiegel vergleichen könnte, nur daß jener bei weitem poetischer, edler gehalten ist, – wie auch die Figur seines ehrenwerthen Freundes Hareth wollten dem Tonsetzer während des Componirens nicht aus dem Sinn kommen, was denn den fremdartigen Charakter einzelner der Musikstücke erklären mag. Bestimmte Situationen haben übrigens dem Componisten bei den fünf ersten Stücken nicht vorgeschwebt, und nur das letzte könnte vielleicht als ein Wiederhall der letzten Makame gelten, in der wir den Helden in Reue und Buße sein lustiges Leben beschließen sehen. Möchte denn dieser Versuch, orientalische Dicht- und Denkweise, wie es in der deutschen Poesie schon geschehen, annähernd auch in unserer Kunst zur Aussprache zu bringen, von Theilnehmenden nicht ungünstig aufgenommen werden.«
Die »Bilder aus Osten« sind als ein für Schumann charakteristischer Nachklang jener romantisch gefärbten Geistesrichtung zu bezeichnen, welche sich in seinen frühesten Claviercompositionen, wie z.B. in den Papillons (op. 2)66, in den Intermezzo's (op. 4), so wie auch in den »Impromptü's« (op. 5) in eigenthümlicher Weise offenbart, nur daß die Gestaltung in diesen Werken noch den unfertigen Standpunkt des feurig und kühn aufstrebenden Kunstjüngers zeigt, während in den »Bildern aus Osten« der, mit Besonnenheit und vollem Bewußtsein waltende Meister zu uns spricht. Trotzdem würde man auch bei diesen Tonsätzen keine Ahnung von Schumann's tondichterischer Intention haben, wenn er in seiner Vorbemerkung nicht den offenbar von ihm selbst für nothwendig erachteten Fingerzeig dafür gegeben hätte. Woraus denn zu schließen ist, daß das Wesen der Tonsprache sich derartigen Aufgaben gegenüber als machtlos erweist. Daß im Uebrigen diese Compositionen auch ohne Beziehung zu Rückert's Makamen an sich musikalisch interessant und geistreich[225] sind, ist entscheidend, und bedingt den künstlerischen Werth derselben.
Das »Weihnachtsalbum,« gedruckt unter dem Titel: »4067 Clavierstücke für die Jugend (op. 68),« ist eine ebenso anspruchslose, als liebenswürdige Gabe, welche in der musikalischen Literatur, trotz der mannichfachen Nachahmungen, die sie im Laufe der Zeit gefunden hat, einzig in ihrer Weise dasteht. Schumann zeigt hier sein reiches, poetisches Verständniß für die Jugend und ihre Lebensarten. Daß dies schöne Werk, von dem man vielfach und mit dem Tone böswilligen Vorwurfes behauptet hat, es sei des materiellen Gewinnes halber geschrieben, ihm ganz besonders lieb und werth war, geht aus folgender brieflichen Aeußerung gegen C. Reinecke68 hervor, die auch zugleich den Sinn, welcher hier zu Grunde liegt, erkennen läßt: »Haben Sie denn vielen Dank für die Mühe und den Fleiß, die Sie diesen meinen älteren Kindern gewidmet; auch meine jüngsten – vorgestern abgegangenen – bitten um Ihre Theilnahme. Freilich liebt man die jüngsten immer am meisten; aber diese sind mir besonders an's Herz gewachsen – und eigentlich recht aus dem Familienleben heraus. Die ersten der Stücke im Album schrieb ich nämlich für unser ältestes Kind zu ihrem Geburtstag und so kam eines nach dem andern hinzu. Es war mir, als fing ich noch einmal von vorn an zu componiren. Und auch vom alten Humor werden Sie hier und da spüren. Von den Kinderscenen unterscheiden sie sich durchaus. Diese sind Rückspiegelungen eines Aeltern und für Aeltere, während das Weihnachtsalbum mehr Vorspiegelungen, Ahnungen, zukünftige Zustände für Jüngere enthält.«
Die Musik zu Byron's »Manfred« scheint eine ganz eigenthümliche Bedeutung in Schumann's Dasein zu beanspruchen; man kann sich kaum des Gedankens erwehren, daß sein eignes Seelenleben, und die Vorahnung von dem, später ihn betreffenden schrecklichen Schicksal sich darin abspiegelt. Denn was ist dieser Byron'sche Manfred anders als ein unstät herumirrender, hirnverwirrter, von schreckhaften Gedanken gequälter Mensch, und der wahnwitzige, seelentödtende Verkehr[226] mit Geistern, – der freilich nur symbolisch zu nehmen ist – war ja auch das charakteristische Moment von Schumann's schließlicher Krankheit. Ohne Frage wäre mindestens alle Berechtigung zu der Annahme vorhanden, daß Schumann sich durch das Gefühl der Wahlverwandtschaft zu diesem Stoffe ganz besonders hingezogen fühlte, denn er äußerte einmal gesprächsweise: »Noch nie habe ich mich mit der Liebe und dem Aufwand von Kraft einer Composition hingegeben, als der zu Manfred.« Ja, als er einmal in Düsseldorf die Dichtung unter vier Augen vorlas, stockte plötzlich die Stimme, Thränen stürzten ihm aus den Augen, und eine solche Ergriffenheit bemächtigte sich seiner, daß er nicht weiter lesen konnte. Alles das zeigt, wie sehr Schumann sich in diesen schauerlichen Stoff vertieft hatte. Hiernach darf es kaum befremdlich erscheinen, daß die Ideen desselben in seinem Innern feste Wurzeln geschlagen hatten, und ihn endlich sogar völlig beherrschten, wie so manche Symptome seiner unheilvollen Erkrankung zu Anfang des Jahres 1854 deutlich beweisen.
Die unverkennbaren Reminiscenzen, durch welche man bei Byron's »Manfred« in gewissen Beziehungen an Goethe's »Faust« erinnert wird, veranlaßten unsern Dichterfürsten zu einer denkwürdigen Kundgebung. In seinen Besprechungen der »Auswärtigen Literatur und Volkspoesie« sagt er: »Eine wunderbare mich nahberührende Erscheinung war mir das Trauerspiel Manfred, von Byron. Dieser seltsame geistreiche Dichter hat meinen Faust in sich aufgenommen, und, hypochondrisch, die seltsamste Nahrung daraus gesogen. Er hat die seinen Zwecken zusagenden Motive auf eigene Weise benutzt, so daß keins mehr dasselbige ist, und gerade deshalb kann ich seinen Geist nicht genugsam bewundern. Diese Umbildung ist so aus dem Ganzen, daß man darüber und über die Aehnlichkeit und Unähnlichkeit mit dem Vorbild höchst interessante Vorlesungen halten könnte; wobei ich freilich nicht läugne, daß uns die düstere Gluth einer gränzenlosen reichen Verzweiflung am Ende lästig wird. Doch ist der Verdruß, den man empfindet, immer mit Bewunderung und Hochachtung verknüpft.«
Gegen diese sehr sachgemäße Auslassung wird schwerlich etwas Gegründetes einzuwenden sein. Goethe erkennt bewundernd die Gestaltungskraft des britischen Dichters an, und behauptet nur, daß der »Faust« auf die Entstehung des »Manfred« einen wesentlichen Einfluß ausgeübt habe, so wie, daß ihm die dabei zum Vorschein[227] kommende krankhaft ausschweifende Richtung bei aller »Bewunderung und Hochachtung« vor Byron's hoher Begabung endlich lästig wird.
Wenn Byron dagegen bemerkt, den Faust niemals gelesen zu haben, weil er kein Deutsch verstehe, so ist dies kein Argument gegen Goethe's Behauptung, daß aus seiner Dichtung Nahrung für den »Manfred« gesogen worden sei. Denn Byron gesteht zugleich offen ein, der »Faust«, welchen er 1816, also ein Jahr vor Entstehung des »Manfred« theilweise durch Monk Lewis kennen lernte, habe ihn sehr ergriffen. Er giebt sogar zu, daß die erste Scene des »Manfred« mit der des »Faust« große Aehnlichkeit habe. Ein beweiskräftigeres Zugeständniß kann man wohl nicht verlangen. Dasselbe wird keinesweges durch Byron's Zusatz geschwächt, daß es der »Steinbach«, die »Jungfrau« und noch »manches Andere« gewesen sei, was ihn den »Manfred« schreiben ließ.
Es kommt gewiß häufig vor, daß ein Poet durch die Gedankenwelt eines fremden, schon vorhandenen Kunstwerkes angeregt, befruchtet und selbst bis zu einem gewissen Grade beim eigenen Schaffen in bestimmter und bestimmender Weise geleitet wird, ohne doch seine Selbstständigkeit im Hinblick auf die zu gestaltenden Charaktere und deren Motivirung, der Wahl des Localtones u.s.w. zu verlieren. Und gerade bei einem bis zum Extremen ausschreitenden, phantastisch auflodernden Naturell, wie dasjenige Byron's, ist dies zutreffend, weil Alles von ihm Auszusprechende zufolge seiner scharf ausgeprägten Subjectivität schon an sich originell erscheinen wird, gleichviel ob es etwas Entlehntes ist oder nicht. Wie sehr sich daher der »Manfred« in vielen Punkten, und vor allem in der dichterischen Sprache vom »Faust« auch unterscheidet, so ist dennoch beiden eine auffallende Aehnlichkeit eigen. Der Anlehnung an die erste Faustscene wurde schon Erwähnung gethan. Es sei hier nur noch des treibenden Motivs einer fluchwürdigen Liebe (bei Faust erst in ihren Folgen), und des schließlich erfolgenden Sühneversuchs in beiden Dichtungen gedacht.
Daß in Goethe's »Faust« Alles bei weitem menschlicher, lebenswahrer und gesunder empfunden ist, wie in Byron's »Manfred«, bedarf wohl keines Beweises, und offenbar hat Goethe an die von seinem hochbegabten Zeitgenossen im »Manfred« eingeschlagene äußerste extreme Richtung gedacht, wenn er der »seltsamen Nahrung« erwähnt, welche derselbe aus dem »Faust« gesogen.[228]
Was dem »Manfred« ein besonders eigenthümliches Gepräge verleiht, ist der düster geheimnißvolle Hintergrund, welchen Byron seiner Schöpfung gegeben hat. Derselbe scheint sich auf ein persönlich erlebtes schauervolles Ereigniß zu beziehen. Goethe berichtet darüber am angegebenen Orte folgendes: »Eigentlich sind es zwei Frauen deren Gespenster ihn (Byron) unablässig verfolgen, welche auch in genanntem Stück große Rollen spielen, die eine unter dem Namen Astarte, die andere, ohne Gestalt und Gegenwart, bloß eine Stimme. Von dem gräßlichen Abenteuer, das er mit der ersten erlebt, erzählt man folgendes: Als ein junger, kühner, höchstanziehender Mann gewinnt er die Neigung einer Florentinischen Dame, der Gemahl entdeckt es und ermordet seine Frau. Aber auch der Mörder wird in derselben Nacht auf der Straße todt gefunden, ohne daß jedoch der Verdacht auf irgend jemand könnte geworfen werden. Lord Byron entfernt sich von Florenz und schleppt solche Gespenster sein ganzes Leben hinter sich drein.«
Was auch bei dieser Erzählung wahr oder erfunden sei, so viel läßt sich erkennen, daß Etwas davon im »Manfred« steckt. Aber Byron läßt es dabei nicht bewenden. Er stellt seinen Helden als ein bejammernswerthes Wesen dar, dessen »unsagbar« schwere Schuld wir weder ihrem Umfange, noch ihrer ganzen Tragweite nach kennen, sondern nur ahnen, – ein Mangel, der keineswegs durch den Gedankenreichthum, noch durch die kühne, schwunghafte Rhetorik des Dichters aufgewogen wird, da es im Grunde an einer überzeugenden Motivirung für die so gewaltsam in Bewegung gesetzten Kräfte fehlt. Uebrigens hat Byron selbst seinem »Manfred« keinen besonderen Werth beigelegt, wie aus einem Briefe an seinen Verleger Murray hervorgeht, in welchem er sagt, daß er »gerade keine große Meinung« davon hege.
Byron hat den Schauplatz der Handlung seiner Dichtung in die Schweiz verlegt. Dort fristet der schuldbeladene und innerlich zerrissene Manfred im Verkehr mit Geistern ein trostlos elendes Dasein. Entledigen möchte er sich des ihn peinigenden Bewußtseins, und so begehrt er von den herbeigerufenen dunkeln Mächten Selbstvergessenheit und Tod. Aber weder das Eine noch das Andere vermögen sie ihm zu gewähren. So enttäuscht, sucht er Beruhigung in der großartigen, ihn umgebenden Natur, versucht in einem Anfall von Verzweiflung sein Leben zu endigen, wendet sich dann wieder hilfebegehrend[229] an die Alpensee und begiebt sich, als auch sie seinem Wunsche nicht willfahren kann, in Ariman's unterirdisches Reich, wo auf sein Verlangen der Geist Astarte's, jenes unglücklichen, durch ihn vernichteten Weibes, aus der Schattenwelt heraufbeschworen wird. Von ihr erfleht er Vergebung, und als er diese erlangt zu haben glaubt, – die Dichtung läßt es eigentlich unausgesprochen – fühlt er sein Bewußtsein erleichtert, sagt sich weiterhin von jeder Gemeinschaft mit den dunkeln Mächten los, und stirbt in dem eben nicht tröstlichen Bewußtsein, sich selbst zerstört zu haben, so daß im Grunde auch der Schluß nicht völlig ohne jene herbe Dissonanz ist welche durch das Ganze geht. Das in richtiger Erkenntniß davon durch Schumann hinzugefügte, »Requiem aeternam« wirkt wohl etwas mildernd, vermag aber doch keine ganz versöhnende Stimmung zu erzeugen.
Schumann hat den »Manfred« nicht in seiner Originalgestalt benutzt, sondern sich die Dichtung für seine Compositionszwecke besonders herrichten lassen69. Sie ist in allen drei Akten, und zwar, wie uns bedünken will, nicht zu ihrem Nachtheil verändert und gekürzt. Auch in Betreff der Geister hat quantitativ eine vortheilhafte Reduktion stattgefunden. In Schumann's Composition sind von den ursprünglich vorhandenen sieben Geistern nur vier übrig geblieben, und es dürfte damit wahrlich genug sein.
Außer der Ouvertüre schrieb der Meister zu Byron's Werk fünfzehn theils melodramatisch, theils in geschlossener musikalischer Form gehaltene größere und kleinere Nummern. Alles ist in diesen Tonsätzen tief durchdacht und im Ganzen, Großen vollendet gestaltet. Sehr anmuthig ist die Zwischenaktsmusik Nr. 5, höchst reizend die »Rufung der Alpensee Nr. 6.« Auch die Melodramen sind von großer Schönheit und ergreifender Wirkung, vor Allem in der »Beschwörungsscene der Astarte« und in »Manfred's Ansprache« an dieselbe. Es sind die Nummern 10 und 11 der Partitur. Richtig deklamirt, erzeugt diese, den Schwerpunkt der Handlung bildende Scene einen tief erschütternden Eindruck. Die Ouvertüre behauptet freilich im künstlerischen Sinne durchaus den Vorrang. Sie ist ein gewaltiges Seelengemälde, voll hoch tragisch-pathetischen Schwunges, und dürfte in ihrer geistigen Größe alle andern Instrumentalwerke Schumann's überstrahlen. Deutlich fühlt man ihr an, daß sie mit seltener Hingebung[230] und ungewöhnlichem Aufwand an seelischen Kräften geschaffen wurde. Ihr Wesen ist, dem Gedichte entsprechend, von tief melancholischer, theilweise aber auch leidenschaftlich dämonischer Färbung. Sie giebt uns das sprechende Bild der wild erregten Seelenkämpfe Manfred's; sie malt uns die düstere Glut seiner Empfindungen bei der Erinnerung an Astarte, deren tiefes Weh' aus dem schmerzlich bewegten Mittelmotiv erklingt; sie eröffnet uns den Blick in die von Manfred herbeigerufene und wieder zurückgewiesene Geisterwelt und läßt uns endlich auch die Zuckungen seines Herzens in der Todesstunde mitempfinden.
Schumann hätte gar zu gern einmal seinen »Manfred« in scenischer Darstellung auf sich wirken lassen. Er sagte: »Ich wünschte das Ganze auf der Bühne mit Musik sehen zu können; es gehören aber Kräfte von der besten Sorte dazu. Ich habe vor, später deshalb einmal beim König von Preußen einen Versuch zu machen, ob vielleicht auf der Berliner Bühne eine Aufführung zu ermöglichen wäre.« Dies geschah nicht. Indessen machte sich Franz Liszt um die Inscenirung des Werkes verdient. Er veranlaßte die theatralische Wiedergabe desselben am 13. und 17. Juni 1852 auf der Weimaraner Hofbühne, welche den Ruhm beanspruchen darf, diese Schöpfung zuerst dargestellt zu haben. Später unternahmen noch einige andere Bühnen Aufführungen des Manfred mit günstigem Erfolg, so namentlich die Münchener. Doch dürfte das Werk, welches Byron eingestandenermaaßen nicht für theatralische Zwecke verfaßt hat, auf diesem Wege wohl kaum eine so weite Verbreitung finden, wie durch Concertaufführungen, bei denen auch die herrliche Musik mehr in den Vordergrund tritt. Für die Bühnendarstellung erscheint der Stoff, obschon in mancher Hinsicht sehr wirksam, so doch im Grunde wenig anmuthend. Man findet darin keine Menschen von Fleisch und Blut, und kann deshalb auch nicht mit voller menschlicher Hingebung mitempfinden. Die zwischen Himmel und Erde schwebende Geisterwelt wird, in der Kunst zur Anwendung gebracht, wohl eine Zeitlang interessiren, niemals aber dauernde Befriedigung gewähren. Dazu kommt hier noch die krankhafte Selbstquälerei des Helden der Dichtung, welche mehr erschreckt als erschüttert, mehr Unbehagen erzeugt als wahres Mitgefühl, mehr abstößt, als wohlthuend erregt. Ungleich feinfühliger und harmonischer in dem Grundtone des Düstern, Melancholischen, erscheint die Schumann'sche Musik, Goethe's Wort bekräftigend, nach[231] welchem die Tonkunst »alles erhöht und veredelt, was sie ausdrückt.« Der Meister hat sich mit diesem Werk eines der hervorragendsten und bedeutungsvollsten Denkmale als Tondichter gesetzt.
Das Adventlied (op. 71), ist im Hinblick auf das vorhergehende Schaffen Schumann's die erste Composition desselben, mit welcher seinerseits eine Annäherung an die »geistliche Musik« erfolgte. Es liegt derselben ein Rückert'sches Gedicht zu Grunde, das in betrachtender Weise über Christi Einzug in Jerusalem sich ergeht, und mit dem Anruf an den Herrn »von großer Huld und Treue« schließt. Bemerkenswerth ist es, das Schumann diesen Weg wählte, um seinen religiösen Gefühlen und Anschauungen Ausdruck zu geben, da ihm doch die Bibel zu Gebote stand. Zufällig kann diese Erscheinung nicht genannt werden. Sie ist vielmehr tief in Schumann's Wesenheit begründet, denn die im folgenden Jahre unternommene Composition des Rückert'schen Gedichtes, »Verzweifle nicht,« für zwei Männerchöre, welche Schumann ausdrücklich »religiöser Gesang« nennt, ist eine Kundgebung ganz im Sinne und Geiste des »Adventliedes.«
An einen, erst in den letzten Lebensjahren erworbenen Freund, Namens Strackerjan,70 schreibt Schumann unter dem 13. Januar 1851:71 »Der geistlichen Musik die Kraft zuzuwenden, bleibt ja wohl das höchste Ziel des Künstlers. Aber in der Jugend wurzeln wir Alle ja noch so fest in der Erde mit ihren Freuden und Leiden; mit dem höhern Alter streben wohl auch die Zweige höher. Und so hoffe ich, wird auch diese Zeit meinem Streben nicht zu fern mehr sein.« Wirklich schrieb Schumann auch im Jahre 1852 noch eine Messe und ein Requiem, Beides auf den lateinischen Text: allein von diesen Werken wäre eine rein kirchliche Bedeutung wohl nur der Messe zuzuschreiben, denn nach Vollendung des Requiems sagte er: »das schreibt man für sich selbst,« er hat mithin dabei weniger an einen Beitrag für geistliche Musik, als an seine eigene Verklärung gedacht. Dieser vereinzelte Fall nun ist um so weniger von Gewicht, als Schumann's geistiges Leben damals in gewissem Sinne bereits eine einseitig beschränkte Richtung angenommen hatte, welche weiterhin deutliche Spuren einer Art von Mysticismus erkennen ließ. Schon im Laufe des Jahres 1851 war davon etwas zu merken. Er hatte[232] die gesammelten Schriften von Elisabeth Kulmann kennen gelernt, und schrieb72 darüber unter dem 11. Juni desselben Jahres nach Dresden: »Außerdem habe ich ein merkwürdiges Buch kennen gelernt: Elisabeth Kulmann's sämmtliche Dichtungen, das mich seit 14 Tagen beschäftigt. Suchen Sie es sich zu verschaffen. Ich kann nicht mehr sagen, als ›es ist ein Wunder, das sich hier uns zeigt.‹ Sehen Sie Bendemann, Hübner, Reinick, Auerbach, so grüßen Sie sie von mir; machen Sie doch einen oder den andern von ihnen, namentlich Auerbach, auf die Kulmann aufmerksam; ich glaube, sie werden es mir danken.« Schumann blieb mit seinem Enthusiasmus allein. Derselbe war keineswegs vorübergehend. Noch im Herbst desselben Jahres entflossen seinem Munde wiederholentlich die begeistertsten Aussprüche über das junge Mädchen, dessen Talent zwar unbezweifelbar ist, aber doch nicht jene von Schumann angenommene Bedeutung hat. Er ging soweit, das Portrait der von ihm Gepriesenen über seinem Schreibtisch mit einem Lorbeer bekränzt, aufzuhängen, und sie wie eine Heilige zu verehren.
Die Sache, von der oben die Rede gewesen, lag vielmehr tiefer, und wird durch Schumann's angeführte briefliche Aeußerung gegen Strackerjan kaum erklärt werden können.
Schumann war im Denken wie im Handeln durchaus das, was man im guten Sinne einen »freisinnigen Geist« nennt. Wohl war seine Lebens- und Weltanschauung, auf wahrhaft religiösem Gefühl basirend, von tiefem sittlichen Ernst durchdrungen. Doch von dem kirchlich dogmatischen Wesen blieb er sein Lebelang fast unberührt, – ein bestimmender Einfluß hatte im elterlichen Hause nach dieser Seite hin nicht stattgefunden. Allein in der Humanitätslehre erkannte er die einzig berechtigte Instanz für das Thun und Lassen. »Wenn man die Bibel, Shakespeare und Goethe kennt und in sich aufgenommen hat, so ist es genug,« äußerte er einmal gesprächsweise. Darf es unter diesen Umständen befremdlich erscheinen, wenn Schumann einerseits seine schöpferische Thätigkeit nicht der sogenannten geistlichen Musik zuwendete, die doch nach herkömmlichen Begriffen eben nur für die Kirche existirt, und wenn er anderseits, um seinen religiösen Sinn zu bethätigen, den Weg wählte, welcher sich in den beiden genannten Rückert'schen Gedichten ihm darbot? Wer aber[233] möchte mit dem Menschen in Schumann hierüber zu rechten wagen? Ist doch dies der Punkt in dem Erdenleben, wo alle Schulweisheit aufhört, wo kein Zwang stattfinden darf, und wo Jeder mit sich selbst in's Reine kommen muß, nach dem weisen Ausspruche eines großen Regenten: »In meinem Staat kann Jeder nach seiner Façon selig werden.«
Uebrigens hatte Schumann, wie sein Projektirbuch zeigt, eine Zeitlang die Absicht, ein biblisches Oratorium »Maria« in Angriff zu nehmen. Dies unterblieb indessen aus begreiflichen Gründen.
Das Adventlied läßt sich keiner der bestehenden Kunstgattungen beigesellen. Schumann war hierüber selbst im Unklaren. In seinem Compositionsverzeichniß nennt er es »Cantate«, in seinen Briefen »Motette«. Genau genommen ist es aber weder das eine noch das andere. Der gedruckten Ausgabe ist ebendeshalb auch keine generelle Bezeichnung hinzugefügt. Ein Bedenken wäre noch hinsichtlich der musikalischen Behandlung des Textes auszusprechen; sie erscheint nämlich zu breit und zu weitschichtig angelegt, wie auch der Begriff des »Liedes« mit der Anwendung so reicher, ausgedehnter Kunstmittel im Widerspruch steht. Die Musik selbst ist von edelem Ausdruck, aber ohne begeisterten und begeisternden Inhalt.
Ein äußeres, für Schumann nicht unwichtiges Ereigniß des Jahres 1848 war die Begründung des Dresdener Chorgesangvereins73, dessen musikalische Leitung ihm zu Theil wurde, nachdem er schon 1847 die Direktion der Liedertafel übernommen hatte, welche durch Ferdinand Hiller's Berufung nach Düsseldorf auf ihn übergangen war. An diesen, ihm befreundeten Kunstgenossen schreibt er unter dem 1. Januar 184874: »Oft gedenken wir Deiner. Auch in der Liedertafel, die mir Freude macht und zu manchem anregt. – – Auch der Chorverein tritt in's Leben – den 5. zum ersten mal. Bis jetzt sind 117 Mitglieder – d.h. 57 wirkliche, die andern zahlende.«[234]
Die Leitung der fraglichen Vereine war für Schumann nicht allein eine willkommene Direktionsübung, sondern auch eine wohlthätige Unterbrechung seines in einseitiger Richtung hinströmenden Geisteslebens. Er war dadurch gezwungen, so weit dies überhaupt bei ihm möglich wurde, mit Menschen und ihm ferner liegenden Dingen zu verkehren. Dies konnte nur von guter Wirkung auf seinen krankhaften Zustand sein. Dem entsprechend schreibt er auch an F. Hiller75: »Der Verlaß auf die Kräfte steigert sich doch mit der Arbeit: ich seh' es recht deutlich – und kann ich mich auch noch nicht recht gesund halten, so steht es doch auch nicht so schlimm, als es Grübelei manchmal vormalt.« Und ein Jahr später76: »Namentlich hat mir doch die Liedertafel das Bewußtsein meiner Direktionskräfte wieder gegeben, die ich in nervöser Hypochondrie ganz gebrochen glaubte.«
Von der Leitung der Liedertafel sah Schumann aber, sich allein auf den Chorgesangverein beschränkend, bald ab. »Viel Freude macht mir mein Chorverein (60–70 Mitglieder), in dem ich mir alle Musik, die ich liebe, nach Lust und Gefallen zurecht machen kann. Den Männergesangverein hab' ich dagegen aufgegeben; ich fand doch da zu wenig eigentlich musikalisches Streben – und fühlte mich nicht hinpassend, so hübsche Leute es waren,« berichtet er wiederum.77
Der Chorgesangverein welcher, wie ersichtlich ist, Schumann ganz besonders an's Herz gewachsen war, gab ohne Zweifel direkte Veranlassung zu manchen Vocalcompositionen, von denen das vorliegende Compositionsverzeichniß für's Jahr 1849 eine große Zahl enthält. Ueberhaupt war dies Jahr in quantitativer Hinsicht das bei weitem ergiebigste in Schumann's Leben. Schon unterm 10. April 1849 schrieb er (allerdings auch mit Bezug auf 1848) an Hiller: »Sehr fleißig war ich in dieser ganzen Zeit – mein fruchtbarstes Jahr war es – als ob die äußeren Stürme den Menschen mehr in sein Inneres trieben, so fand ich nur darin ein Gegengewicht gegen das von Außen so furchtbar hereinbrechende.« Und Ende 1849 desgleichen: »Aeußerst fleißig war ich in diesem Jahre, wie ich Dir wohl schon schrieb; man muß ja schaffen, so lang es Tag ist.«[235]
Mit dem von »Außen so furchtbar hereinbrechenden« meinte Schumann die politische Bewegung von 1848 und insbesondere den Dresdener Maiaufstand des Jahres 1849. Der letztere vertrieb ihn, wie so viele andere friedliebende Menschen für einige Wochen aus der Stadt. Während dieser Zeit nahm er seinen Aufenthalt in Kreischa bei Dresden, nicht aber etwa aus principieller Ueberzeugung gegen die Sache selbst, sondern weil ihm der wüste, haltlose Zustand unbequem war. Diese Gegensätze bildeten bei ihm einen seltsamen Contrast. Schumann gehörte in politischer Hinsicht, gleichwie in religiöser, zu den Freimüthigen. Er nahm jederzeit innerlich lebhaften Antheil an allen Weltbegebenheiten. Aber viel zu fern lag es seinem äußerlich passiven Verhalten, seine Meinung gegen Andere offen und rückhaltlos auszusprechen, geschweige denn gar irgend einen thätigen Antheil an politischen Akten zu nehmen. So war Schumann innerlich ein Liberaler, äußerlich dagegen ein durchaus Conservativer. Nicht etwa in Volksversammlungen hat man ihn sich zu denken, sondern am Schreibtisch, in der Hand die Feder, welcher bei dieser Gelegenheit die »Märsche« op. 76 entflossen. Ihren Entstehungsgrund deutete Schumann selbst durch die auf's Titelblatt gesetzte Jahreszahl 1849 an.
Die in's Jahr 1849 fallenden Arbeiten sind nach dem Compositionsverzeichniß folgende:
»1849 (Dresden). Noch78 4 zweihändige Clavierstücke (Waldscenen) (op. 82.)
(Februar) 3 Soiréestücke für Clarinette und Pianoforte (op. 73). – den 14. Februar: Romanze und Allegro für Horn und Pianoforte (op. 70). – Vom 18.–20.: Concertstück für vier Ventilhörner mit großem Orchester. – (op. 86).79 –
Im März: 14 Balladen und Romanzen (von Göthe, Mörike, Uhland, Eichendorff, J. Kerner) für Chor (Heft I.op. 67. – Heft II. op. 75).80 – 12 Romanzen für Frauenchor (4, 5 und sechsstimmig).[236] – op. 69 Heft 1 – op. 91. Heft 2. – Spanisches Liederspiel für Sopran, Alt, Tenor und Baß (12 Nummern), mit Begleitung des Pianoforte (op. 74)81. –«
Das spanische Liederspiel ist ein Cyklus ein-, zwei- und mehrstimmiger in dichterischem Zusammenhange stehender Gesänge. Ihnen zu Grunde liegt die Vorstellung, daß zwei Liebespaare ihre Gefühle in Luft und Leid aussprechen. Schumann hat dies auf ingeniöse und wirksame Weise in seiner Musik ausgedrückt, und derselben zugleich, ohne seinem individuellen Empfinden Fesseln anzulegen, einen südländischen Farbenton zu geben gewußt, welcher diesem Werke einen eigenthümlichen Reiz verleiht. Treffend sind die verschiedenen Schattirungen der Liebesregungen, wie z.B. der Sehnsucht, der schwärmerischen Schwermuth, des bangen Zweifels, der Befriedigung und Herzensfreude in Tönen wiedergegeben, und auch an dem bei Liebenden vorkommenden neckischen Humor fehlt es nicht ganz. Alle Stimmen sind überdies gut bedacht, so daß dieser Liedercyklus auch in gesanglicher Hinsicht dankbare Aufgaben bietet. Allein der Bassist ist etwas stiefmütterlich behandelt: er hat nur in den beiden Quartetten, so wie in einem Duett mit dem Tenor zu singen, weshalb sich Schumann wohl auch veranlaßt sah, dem Ganzen noch die, für Baryton componirte spanische Romanze »der Contrabandiste« als Anhang hinzuzufügen.
Von ähnlicher Beschaffenheit ist der Cyklus »spanische Liebeslieder«, veröffentlicht als op. 138 und Nr. 3 der nachgelassenen Werke, mit vierhändiger Clavierbegleitung, und in Betreff der äußeren Anordnung auch das »Minnespiel« aus Rückert's »Liebesfrühling« (op. 101). Die beiden letzteren Werke gehören nach Ausweis des Compositionsverzeichnisses, wie op. 74, ebenfalls dem Jahre 1849 an.
Im April: 5 leichte Stücke im Volkston für Violoncell und Pianoforte (op. 103). April und Mai: 35–40 Lieder zu meinem Jugendalbum (op. 79).[237]
Das Jugendalbum enthält, wie es veröffentlicht ist, nur 29 Lieder. Auch wurde der Titel umgeändert in »Liederalbum für die Jugend.« Dies Werk sollte wohl ein Seitenstück zu op. 68 sein. »Sie werden es am besten aussprechen, was ich damit gemeint habe, wie ich namentlich dem Jugendalter angemessene Gedichte, und zwar nur von den besten Dichtern, gewählt, und wie ich vom Leichten und Einfachen zum Schwierigen überzugehen mich bemühte. Mignon schließt, ahnungsvoll den Blick in ein bewegteres Seelenleben richtend,« schreibt Schumann darüber an E. Klitzsch. (Briefe vom Jahre 1833–1854 Nr. 72.) Das ist nun Alles vortrefflich gedacht, aber der Zweck dieses Liederalbums scheint doch insofern nicht ganz erreicht zu sein, als die in demselben befindlichen Lieder, wenige Ausnahmen abgerechnet, für jugendliche Stimmen kaum brauchbar sind. Sie erfordern fast alle aus- und kunstgebildete Sänger, und für diese dürfte wiederum der musikalische Gehalt nicht immer bedeutend genug sein.
In Kreischa bei Dresden: 18.–21. Mai. Fünf Jagdgesänge für Männerstimmen mit Begleitung von 4 Hörnern, op. 137 (Nr. 2 der nachgelassenen Werke). 23.–26. Mai: »Verzweifle nicht« von Rückert, (op. 93) religiöser Gesang für doppelten Männerchor (Orgel ad lib.). 1.–5. Juni: Deutsches Minnespiel aus F. Rückert's Liebesfrühling für Sopran, Alt, Tenor und Baß (8 Nummern) mit Begleitung des Pianoforte (op. 101).
In Dresden: 12.–16. Juni: IV große Märsche für Pianoforte82 (op. 76). – 18.–22. Juni: 4 Lieder der Mignon aus W. Meister von Göthe (das erste ist auch im Jugendalbum). Noch die Ballade des Harfners und das Lied der Philine.
Juli den 2. und 3.: Das Requiem für Mignon skizzirt83 (op. 98b) – den 6. und 7. die drei Lieder des Harfners. – (Sämmtliche Stücke aus W. Meister.) (op. 98) [sind in eine Sammlung zu vereinigen].
Die Lieder und Gesänge aus Göthe's »Wilhelm Meister« – neun an der Zahl – wurden als op. 98a veröffentlicht. Sie sind geistreich gedacht, lassen aber doch jene Einfachheit des Ausdrucks[238] vermissen, welche den betreffenden Gedichten eigen ist. Um so glücklicher erscheint dagegen in der Auffassung das »Requiem für Mignon«. Hier hat Schumann aus dem Geist der Dichtung heraus in engem Rahmen ein ganz eigenartiges Meisterstück zu schaffen vermocht. Der Tondichter giebt uns in diesem »Requiem« keine Trauermusik nach herkömmlichen Begriffen, sondern eine würdig gehaltene Gedächtnißfeier für das halberwachsene heimgegangene Mädchen in dem, von Goethe ausdrücklich angedeuteten poetischen Sinne. Er schildert die Situation folgendermaßen:
»Am Abend fanden die Exequien für Mignon statt. Die Gesellschaft begab sich in den Saal der Vergangenheit und fand denselben auf das sonderbarste erhellt und ausgeschmückt. Mit himmelblauen Teppichen waren die Wände fast von oben bis unten bekleidet so daß nur Sockel und Fries hervorschienen. Auf den vier Candelabern in den Ecken brannten große Wachsfackeln, und so nach Verhältniß auf den vier kleineren, die den Sarkophag umgaben. Neben diesen standen vier Knaben, himmelblau mit Silber gekleidet und schienen einer Figur, die auf dem Sarkophag ruhte, mit breiten Fächern von Straußenfedern Luft zuzuweh'n. Die Gesellschaft setzte sich und zwei Chöre singen mit holdem Gesang an zu fragen: Wen bringt ihr uns zur stillen Gesellschaft?«
Goethe setzt einen »holden Gesang« für das Andenken Mignon's, seines Lieblingsgebildes voraus, und einen solchen giebt uns Schumann wirklich in der fraglichen Schöpfung. In kindlich-naivem Ausdruck, für den unser Tonmeister eine ganz specifische Begabung besaß, beginnt das Stück, welches allmählig ganz in Uebereinstimmung mit dem Gedankengange der Worte zu größerer Bedeutung anwächst. So entwickelt sich die Composition in angenehmer Steigerung und Belebung bis zum Schluß, der angemessen dem zu Grunde liegenden symbolischen Spruch zu lebensfrischer und warmer Empfindung sich aufschwingt.
Von der Entfaltung besonderer contrapunktischer Künste hat Schumann in diesem Werk mit richtigem Gefühl abgesehen: es mußte im Hinblick auf den gewählten Gegenstand einfach und plan gehalten werden, und das ist dem Meister in hohem Grade gelungen. Die Anmuth und Frische der Empfindung aber, welche diese Musik offenbart, wird immer von erfreulicher Wirkung begleitet sein.
Juli den 13. und 14. Scene im Dom aus Göthe's Faust. –[239] Den 15.: Scene im Garten desgl. – Den 18.: »Ach neige«. Den 24.–26.: Scene des Ariel mit Faust's Erwachen.
August: Die Scenen aus Faust instrumentirt. Ende August: 4 Lieder für Sopran und Tenor (Tanzlied, Er und Sie, Ich denke dein, Wiegenlied) op. 78.
10.–15. September: 2 Hefte Kinderstücke für Pianoforte zu vier Händen. (Sechs Nummern.) 18.–26. September: Introduktion und Allegro für Pianoforte und Orchester (in G, op. 92). Vom 27. September bis 1. October: Noch zwei Hefte vierhändige Kinderstücke für das Pianoforte (sechs Nummern) op. 85.
Die im September 1849 entstandenen zwölf vierhändigen Clavierstücke (op. 85) »Für kleine und große Kinder«, welche als eine glückliche Fortsetzung der »Kinderscenen« und des »Jugendalbums« betrachtet werden können, gehören zu den verbreitetsten und beliebtesten Pianofortecompositionen Schumanns. Sie enthalten eine Reihe anmuthiger Tonsätze im kleineren Genre, unter denen insbesondere der charakteristische »Kroatenmarsch«, das träumerische »Abendlied«, so wie das »Am Springbrunnen« überschriebene, sehr malerisch wirkende Stück als außerordentlich schön hervorzuheben sind.
Vom 11.–16. October: 3 doppelchörige Gesänge für größere Gesangvereine (»An die Sterne« von Rückert, »Ungewisses Licht«, »Zuversicht« von Zedlitz). – Ende October: »Gottes ist der Orient« – für Doppelchor. (Nebst den 3 vorhergehenden Gesängen als op. 141, Nr. 6 der nachgelassenen Werke erschienen).
Den 4. November: »Nachtlied« von Hebbel für Chor und Orchester skizzirt; den 8.–11. dasselbe instrumentirt84 (op. 108). Bis letzten November das 2te spanische Liederspiel mit vierhändiger Begleitung des Pianoforte fertig gemacht (10 Nummern). (Als »Spanische Liebeslieder« op. 138, Nr. 3 der nachgelassenen Werke veröffentlicht.)
4.–5. December 1849: 3 aus den hebräischen Gesängen von Lord Byron mit Begleitung der Harfe (ad lib. auch Pianoforte) op. 95. Mitte December 1849: 3 Romanzen für Hoboe mit Pianoforte (op. 94); den 22. December: »Schön Hedwig« von Hebbel für Declamation mit Pianofortebegleitung (op. 106); den 27. December bis 3. Januar 1850:[240] »Neujahrslied« von Rückert85 für Chor und Orchester skizzirt (op. 144). (Als Nro. 9 der nachgelassenen Werke veröffentlicht.)
Die hiermit abschließende Compositionsübersicht des Jahres 1849 zeigt unsern Meister in vielseitiger Productivität. Außer den vorstehend schon näher betrachteten Compositionen dieser langen Reihe wären zunächst noch zu erwähnen: Das »Concertstück für vier Ventilhörner mit großer Orchesterbegleitung« (op. 86), und der Concertsatz »Introduction und Allegro« für Pianoforte und Orchester (op. 92). Beide Werke enthalten hervorragende Züge, das letztere namentlich in der schön gedachten Einleitung; sie vermögen aber in ihrer Totalität eine durchgreifende, nachhaltige Wirkung nicht auszuüben. Bei dem dreisätzigen Concert (op. 86) erklärt sich dies mit dadurch, daß die sich gleichbleibende Klangfarbe der Hörner allmählig ihren Reiz verliert, und daß in Folge dessen der Antheil des Hörers nach und nach ermüdet, um so mehr, als es der Phantasie des Tonsetzers durch die beschränkte Natur der in den Vordergrund gestellten Blechinstrumente erschwert ist, sich freier und reicher zu entfalten. Es mag damit im Zusammenhange stehen, daß dieses Concert mehr den Eindruck einer geistreichen Studie, als einer glücklich inspirirten Tonschöpfung hinterläßt.
Anziehender erscheinen die kleineren Kammermusikstücke op. 70 73, 94 und 102 für Pianoforte und verschiedene Instrumente, welche als eine liebliche Nachblüthe der gleichartigen Claviercompositionen des Meisters aus dessen erster schöpferischer Periode zu bezeichnen sind. Insbesondere heben sich unter denselben die drei Phantasiestücke für Pianoforte und Clarinette oder Violine, so wie die fünf Sätze im Volkston für Pianoforte und Violoncello durch melodische Schönheit so wie überhaupt durch sehr anmuthende Stimmungen hervor. Als weitere Compositionen in dieser Richtung entstanden in den Jahren 1851 und 1853 noch die »Märchenbilder« (op. 113) und die »Märchenerzählungen« (op. 132).
Endlich ist auch noch als ein eigenthümlich phantastisches, seingestaltetes Tonstück das »Nachtlied« (op. 108 für Chor und Orchester) auszuzeichnen: Schumann selbst stellte es hoch, wie sich aus einer seiner brieflichen Aeußerungen ersehen läßt86. Der Meister schreibt mit[241] Bezug auf diese Composition: »Dem Stücke habe ich immer mit besonderer Liebe angehangen.« Mit dichterischer Versenkung giebt Schumann uns hier ein farbenreiches Tonbild jener Empfindungen, von denen das Gemüth beim Uebergange vom Tag zur Nacht und zum Schlummer umfangen und bewegt wird. Dieses poetisch empfundene Stück thut bei der Wiedergabe nicht so viel für sich wie andere Werke des Meisters. Es muß, so zu sagen, nachgedichtet, und dem entsprechend gestaltet werden. Die volle Wirkung läßt sich nur dadurch erzielen, daß der poetische Faden ununterbrochen festgehalten und fortgesponnen wird, was insbesondere für den Chor da seine Schwierigkeiten hat, wo er absatzweise und in einzelnen Stimmen auftritt.
Der stark potenzirten schöpferischen Thätigkeit Schumann's während des Jahres 1849 folgte unmittelbar, wie leicht begreiflich, eine in produktiver Hinsicht ruhigere Periode. Jedenfalls trug hierzu aber auch die zweimalige Abwesenheit Schumann's von Dresden in der ersten Hälfte des Jahres 1850 mit bei.
Zuerst unternahm Schumann mit seiner Gattin einen Ausflug nach Leipzig, Bremen und Hamburg. Ueber denselben schreibt Clara Schumann an Ferdinand Hiller unterm 7. Mai 1850: »Wir machten Februar und März eine schöne Reise: erst waren wir 4 Wochen in Leipzig, dann in Hamburg und wurden auf Händen getragen; den Beschluß der Reise in Hamburg machten wir mit Jenny Lind, die in meinen beiden letzten Concerten sang.« – Die zweite Veranlassung zu einer mehrwöchentlichen Abwesenheit von Dresden erhielt Schumann durch die Aufführung seiner Oper Genoveva in Leipzig, von der bereits berichtet wurde87.
Doppelt erklärlich also ist es, wenn während der acht ersten Monate des Jahres 1850 verhältnißmäßig nur wenig an Compositionen entstand. Als solche nennt das Compositionsverzeichniß:
»1850. April. ›Resignation‹, ›Ergebung‹, ›Der Einsiedler‹. Drei Gesänge für die Singstimme mit Pianoforte (op. 83). desgl. ›Nicht so schnell‹ von G. L'Egrü88.
[242] Vom 25.–28. April. Die Scenen aus Faust: ›Die vier grauen Weiber‹, und ›Faust's Tod‹, skizzirt, bis zum 10. Mai fertig instrumentirt.
Der 10. Mai ›Abendhimmel‹ von Wilfried v. d. Neun. Den 11. Mai ›Herbstlieder‹ desgl. – desgl. bis 18. Mai noch vier Gedichte von W. v. d. Neun (op. 89).
Juli. ›Wandrers Nachtlied‹, ›Schneeglöckchen‹, ›Frühlingslust‹, ›Ihre Stimme‹, ›Geisternähe‹, ›Frühlingslied‹, ›Husarenabzug‹, ›Gesungen‹, ›Himmel und Erde‹, ›Mein Garten‹, ›Mein altes Roß‹89. Lieder für eine Singstimme mit Pianoforte.
August: 6 Lieder von N. Lenau für eine Singstimme mit Begleitung des Pianoforte op. 90. Requiem nach einem altlateinischen Text für eine Singstimme mit Pianoforte op. 90.«
Unter den vorstehend verzeichneten Compositionen nehmen die beiden Scenen aus dem zweiten Theil des »Faust« schon deshalb ein hervorragendes Interesse in Anspruch, weil mit ihnen die von Schumann für die musikalische Behandlung ausgewählten Partien der genannten Dichtung zum Abschluß gelangten. Der vollständige Cyklus jener von dem Meister aus Goethe's Faust componirten Scenen umfaßt der Reihe nach Folgendes:
1) Scene im Garten, componirt am 15. Juli 1849.
2) Gretchen vor dem Bilde der Mater dolorosa, componirt am 18. Juli 1849.
3) Scene im Dom, componirt am 13. und 14. Juli 1849.
4) Scene des Ariel mit Faust's Erwachen, componirt vom 24.–26. Juli 1849. (Im August desselben Jahres wurden diese vier Nummern instrumentirt.)
5) Scene der vier grauen Weiber.
6) Faust's Tod.[243] (Diese beiden Nummern wurden vom 25.–28. April 1850 componirt und »bis zum 10. Mai fertig instrumentirt«).
7) Composition der Schlußscene zu »Faust« (Faust's Verklärung) in sieben Nummern, geschrieben während des Sommers 1844.
Schumann hat diese Compositionen in drei der äußeren Form des Gedichtes entsprechende Abtheilungen gebracht, von denen die erste die drei ersten Nummern, die zweite die drei folgenden Nummern, und die dritte den Epilog in sich schließt. Das Ganze, welches einen Concertabend ausfüllt, wird durch eine später, und zwar in den Tagen des 13.–15. April 1853 aufgezeichnete Ouvertüre eingeleitet. Diese letztere hatte den Meister Jahre hindurch lebhaft beschäftigt, ohne daß es zu einem Resultate gekommen wäre. Ungemein erfreut war er daher, als am Vorabend des Schlusses seiner Künstlerlaufbahn, deren nahes Ende er nicht ahnte, seine Absicht noch verwirklicht wurde, die geraume Zeit vorher schon vollendeten Faustscenen zum Abschluß zu bringen.
Sehr bezeichnend für die Geistesrichtung unseres Meisters ist es, daß die Schlußscene von allen vorgenannten Theilen der Faustmusik zunächst und zuerst seine productive Thätigkeit in Anspruch nahm. Sein zu mysteriösem Fühlen und Denken geneigtes Naturell mußte sich durch die symbolisch allegorische Einkleidung dieses dichterischen Gebildes ungemein angezogen fühlen, wenn auch wohl ohne Frage die denselben zu Grunde liegende poetische Idee den entscheidenden Anstoß zur musikalischen Behandlung gegeben haben wird. Zudem bot Faust's Verklärung ihm den Vortheil eines in sich abgeschlossenen Ganzen, während dasjenige, was ihn vom ersten und zweiten Theil der Dichtung zur Composition anregte, doch immer nur etwas Bruchstückartiges ergeben konnte.
Die kühne Idee, den Schluß des »Faust« in Musik zu setzen, konnte nur ein Tondichter fassen, der durch hohe Geistesbildung und eigenthümliche poetische Gestaltungskraft dazu befähigt war, den Stoff in seiner ganzen Größe zu begreifen und völlig zu durchdringen. Schumann hat durch die That gezeigt, daß er ganz der Mann dazu war. Man betrachte die Dichtung näher. Die Schwierigkeiten für eine tonkünstlerische Bearbeitung derselben sind enorm, ganz abgesehen davon, daß der nicht selten überfüllte, seltsam spröde Wortlaut dem musikalischen Wesen sehr fremdartig gegenüber steht. Aber Schumanns Dichterauge hat der Sache bis auf den Grund geschaut und[244] durch Inspiration eine Leistung hinzustellen vermocht, an deren Möglichkeit vorher wohl kaum schon Jemand gedacht hat.
Interessant ist es, zu beobachten, welches Princip Schumann bei der Composition des Faust-Epilog leitete. Jener enge Anschluß an den Text, wie in zahlreichen Liedern des Meisters, war hier mit Ausnahme einzelner Stellen, nicht anwendbar. Wie sollte sich auch beispielsweise ein adäquater musikalischer Ausdruck für Worte wie die folgenden, finden lassen?
»Mein Inn'res mög' es auch entzünden,
Wo sich der Geist, verworren, kalt,
Verquält in stumpfer Sinne Schranken,
Scharfangeschloss'nem Kettenschmerz.«
oder
»Uns bleibt ein Erdenrest
Zu tragen peinlich,
Und wär er von Asbest
Er ist nicht reinlich.« – u. A. m.
Derartige abstracte Reflexionen musikalisch entsprechend illustriren zu wollen, gehört offenbar zu den Unmöglichkeiten. Bei der Composition des Epilogs zu Faust war mithin von dem Wortausdruck im Einzelnen abzusehen und zur Hauptsache der zu Grunde liegende poetische Gedanke zu berücksichtigen. In diesem Sinne hat Schumann sich mit feinstem künstlerischen Takt und Verständniß seines Gegenstandes bemächtigt und es ist ihm die Lösung der höchst problematischen Aufgabe in einer Weise gelungen, die man als ein Wunder der Genialität bezeichnen darf, wie denn auch diese seine Leistung ganz einzig und unvergleichlich im Bereiche der musikalischen Literatur dasteht. Seine Composition commentirt thatsächlich den poetischen Gehalt der Dichtung in der sublimsten Weise. Dazu erreicht Schumann gerade in dieser Arbeit eine Klarheit und Durchsichtigkeit der Darstellung, die an Mozart's Objectivität erinnert. Nur hie und da wird die entzückende Tonsprache durch leise Wolkenschatten auf Augenblicke verdunkelt.
Durch den chorischen Gesang der heiligen Anachoreten werden wir entsprechend in das mystische Helldunkel der Dichtung eingeführt. Hier zeigt sich gleich die oben angedeutete Schwierigkeit der Behandlung für den Componisten. Schumann wählt das einzig Richtige, und giebt uns die Grundstimmung in Tönen wieder, so eigenartig schön, wie es eben Worte nicht auszudrücken vermögen. Es ist etwas[245] geheimnißvoll Berückendes in diesen Klängen, was wie ein Reflex der Naturseele auf unser Gemüth einwirkt.
Eine kurze, nur aus zwölf Takten bestehende Instrumentaleinleitung genügt, um uns in die Stimmung dieses so phantastisch und dabei in sich doch so ruhig maaßvoll gehaltenen Chorstücks zu versetzen, dessen ganz eigenartige Wirkung mit den einfachsten Mitteln erreicht wird. Nicht unwesentlichen Antheil an dieser letzteren hat einerseits die ungewöhnlich tiefe Lage der Stimmen, und andererseits die schwungvoll aufstrebende Führung der inmitten des Tonsatzes imitatorisch behandelten melodischen Phrase. Auch daß das Orchester ganz im Hintergrunde nur einfach begleitend steht, wie es bei Schumann höchst selten der Fall ist, giebt diesem Musikstück einen besonderen Charakter.
Nun tritt der Pater Ecstaticus mit seinem Sologesange ein. Er ist auf und abschwebend zu denken, was durch die entsprechend gebildete und bis zum Schluß des Satzes fortgeführte Achtelfigur des Solo-Violoncello's so wie der ersten Geige und Bratsche versinnlicht ist. Dieses Stück gehört zu dem Wenigen der ganzen Composition, was gegen die genußspendende und erhebende Wirkung derselben einigermaßen zurücksteht. Die dichterische Unterlage bewegt sich allerdings hier in so scharf contrastirenden und jäh wechselnden Bildern, daß der musikalische Ausdruck nicht gleichen Schritt mit ihr zu halten vermag. Schumann hat die leidenschaftvolle Verzückung, welche sich in den heftig erregten Exclamationen dieses Paters ausspricht, sowohl in dessen Gesange wie auch andeutungsweise in der Instrumentalbegleitung wiederzugeben versucht: allein der gewünschte Effekt tritt nicht vollständig in die Erscheinung, und so kann auch der Hörer keinen bestimmten, packenden Eindruck empfangen.
Um so wohlthuender wirken die gehaltvollen, dem Pater Profundus in den Mund gelegten Weisen. Auch hier spricht sich wie bei dem Pater Ecstaticus das sehnsüchtige Verlangen nach beglückender Seelenläuterung durch der Liebe Allgewalt aus; allein die damit verbundene Empfindung gewinnt schon ein ruhigeres, geklärteres Wesen. Schumann hat dies meisterhaft in Töne zu kleiden gewußt. Das feierlich gehobene Pathos, mit dem der Pater der »tiefen Region« seine Betrachtungen anhebt, wird bei den Worten: »Ist um mich her ein wildes Brausen«, von einem lebhaften Tempo unterbrochen, in dessen Verlauf, dem Sinn des Textes ganz entsprechend, wohlthuende[246] Wärme in einfach schöner Weise zu wirkungsvollem Ausdruck gelangt. Besonders glücklich sind auch die bittenden Schlußworte: »O Gott! beschwichtige die Gedanken, erleuchte mein bedürftig Herz!« durch die innig vordrängende chromatische Tonfolge, welche schon in dem einleitenden Recitativ auftritt, zur musikalischen Darstellung gebracht.
Von dem Dichter in die, »mittlere Region« der zum Schauplatz gewählten Sphäre emporgehoben, vernehmen wir jetzt den, einer heranziehenden Schaar »seeliger Knaben« zugewendeten Pater Seraphicus. Zwei liebliche Stimmen aus dem Chor derselben fragen ihn: »Sag' uns Vater wo wir wallen, sag' uns Guter wo wir sind?« Da entspinnt sich ein reizend anmuthvoller Zwiegesang zwischen dem Empfangenden und den zarten Ankömmlingen, dessen zweiter Theil einen freudig erregten, hymnenartigen Charakter annimmt, zum Schluß aber wie sich entfernend verklingt, während die Begleitung das Anfangs vom Pater Seraphicus intonirte melodische Motiv nochmals ertönen läßt.
Der lichtvoll verklärte Charakter dieses Satzes wird mitbestimmt durch die für den dreistimmigen Knabenchor ausschließlich in Anspruch genommenen weiblichen Stimmen, deren Wirkung noch schärfer durch das gleichzeitige Baßsolo hervorgehoben wird.
Alles bisher Vernommene ist als allmähliche Ueberleitung der Empfindung in eine höhere, übersinnliche Region anzusehen, um den nunmehr erfolgenden Eintritt des Verklärungsactes Faust's in geeigneter Weise vorzubereiten.
Eine Engelschaar »schwebend in der höh'ren Sphäre« und Faustens Unsterbliches tragend, erscheint mit dem bedeutungsvollen »Gerettet ist das edle Glied.« Schumann hat zu diesen Worten und den sich daran schließenden Versen einen ganz schlichten kurzen gemischten Chor gesetzt, der durch seinen feierlich würdevollen Ernst durchaus dem Sinn des Textes entsprechend gehalten ist. Unmittelbar anschließend verkünden uns »die jüngeren Engel«, wie Faust's Seele den bösen Mächten entrungen worden. Eine Solostimme hebt an, und nach einer Periode von sechzehn Takten kommen alle Sopranstimmen des Chors wiederholend und bestätigend hinzu, bis dann der volle Chor sein triumphirendes »Jauchzet auf, es ist gelungen« in den Himmelsraum hinausschallen läßt. Unterbrochen wird dieser Freudenruf durch eine Betrachtung der »vollendeteren Engel« über[247] den ihnen noch anheftenden Rest irdischen Wesens, die dem Tondichter zu einer der schwungvollsten und tiefsinnigsten chorischen Partien des ganzen Werkes Veranlassung gegeben hat. Nachdem hierauf das dieses Stück einleitende melodische Motiv des Sopranes in As-dur nochmals erklungen, folgt in knappster Wendung plötzlich ein Cis-moll-Satz für Chor und Solostimmen, in welchem die »jüngeren Engel« wiederum das Wort ergreifen. Sie erblicken die schon seelig gesprochene Knabenschaar, und schildern deren Erscheinung in einem höchst merkwürdig gegliederten Satzbau, dem ein elastisch bewegter Tripeltakt in Verbindung mit dem vorher schon unausgesetzt angewandten 2/4, Takt zu Grunde liegt, wodurch eine wundersame, so zu sagen geisterhaft schwebende Wirkung erreicht wird.
Das ganze Stück vom Eintritt des Allegretto (2/4,As-dur) ab bis hierhin ist von meisterhafter Conception und Ausführung im Detail, und zwar so sehr, daß sein musikalischer Gehalt, unseres Bedünkens, die stellenweise stark reflective Dichtung weit überstrahlend, Göthe's Intention erst zum vollen Ausdruck bringt. Die Entwickelung des durchsichtig klaren Tonbaues in melodischer und harmonisch modulatorischer Hinsicht erweist sich hier durchweg von der reizvollsten, feinsinnigsten Beschaffenheit. Und so zieht eine Reihe anmuthvoller, formell schön geeinter Stimmungen, sowohl nach Seite des duftig Zarten, wie des kraftvoll Erhabenen, an unserm Ohr vorüber, wirksamer noch gemacht durch eine sein abgewogene wechselreiche Verwendung der aufgebotenen vocalen und orchestralen Mittel. Es ist eine farbenreiche Gedankenfülle, wie sie selbst der begabteste Genius nur in weihevoller Stunde zeugen und ausführen kann.
Ein kleiner, von je zwei Sopran- und Altstimmen vorzutragender Satz ätherischen Charakters, in welchem die »seeligen Knaben« ihre Freude über den Empfang von Fausts Unsterblichem aussprechen, leitet zu einem breiter ausgeführten Chor von geistvoller contrapunktischer Arbeit auf den Ruf: »Gerettet ist das edle Glied«, doch durchaus abweichend von der vorher schon vernommenen Composition dieser Worte. Mit richtigem künstlerischen Gefühl ist er des Gegensatzes zum Vorhergehenden und Folgenden halber kräftig und, man möchte sagen, in mehr realistischem Tone gehalten. Schon in dem Thema spricht sich ein äußerst energischer Charakter aus. Es ist, als hätte man sich die, in den himmlischen Jubel miteinstimmende Menschheit dabei zu denken. Nur bei den wiederholt eintretenden[248] vier Solostimmen erhält der Ausdruck ein leichteres, spirituelleres Gepräge. Dieser Chor ist, wie hier gleich angemerkt sei, als eine zweite Bearbeitung des ursprünglich an derselben Stelle vorhanden gewesenen Tonsatzes im Jahre 1848 dem Werke einverleibt worden.
Nach Ablauf der Pause, welche am Schlusse desselben vom Componisten ausdrücklich vorgeschrieben ist, um dem Hörer einen momentanen, glücklich gewählten Ruhepunkt zu gewähren, ohne doch die Aufführung gerade zu unterbrechen, werden wir in die »höchste« Region des ideellen Schauplatzes der Handlung eingeführt, womit auch zugleich der Eintritt des Culminationspunktes der Dichtung erfolgt.
Doctor Marianus, »in der höchsten reinlichen Zelle« weilend, blickt in den Himmelsraum und ihm enthüllt sich das Mysterium der »Jungfrau rein im schönsten Sinn.« Im Sternenkranze erschaut er Maria, die »gnadenreiche Himmelskönigin«, welche von Goethe in katholisirender Richtung als Mittlerin für die Erlösung durch Gottes allumfassend versöhnende Liebe gedacht ist. In Entzücken versunken, entströmt seinen Lippen ein andachtvoll verherrlichender Gesang, erfüllt von jener inbrünstigen, tiefen Gefühlsschwärmerei, die einen eigenthümlichen, schon frühzeitig in Schumann's innerstem Wesen entwickelten Zug bildet.
Die Mittel, welche der Meister hier zur Darstellung braucht, sind ebenso einfach wie sein Gedankengang, und dennoch diese wunderbare Wirkung! Einige zum Theil gedämpfte Streichinstrumente in Verbindung mit wenigen Blasinstrumenten, von denen sich zunächst die Oboe in obligater Weise geltend macht, und eine in gebrochenen Akkorden begleitende Harfe: die kunstvolle Anwendung dieser Tonwerkzeuge erzeugt ein dem demuthvoll betrachtenden und hoch so überschwänglichen Gesange des Dr. Marianus entsprechendes, wahrhaft verklärendes Colorit.
Der hier sich offenbarenden weihevollen Stimmung ist weiterer beredter Ausdruck in dem nun folgenden gehaltvollen Tonsatz »Dir, der Unberührbaren« gegeben, an welchem außer dem Dr. Marianus der Chor auf wirkungsreiche Art betheiligt ist.
Nahend schwebt die »Mater gloriosa« einher, umgeben von gnadeerflehenden Büßerinnen, was der Componist in einem bewegteren Tempo von fünf weiblichen, dringlich bittenden Stimmen unter Anwendung des tremolirenden Streichquartett's auszudrücken versucht,[249] während die Holzblasinstrumente den Singstimmen zur Unterstützung und Leitung dienen. Die Auffassung und Darstellungsweise hat hier etwas unruhig Phantastisches, was gegen die von Schumann vor- und nachher, auch im bewegteren Tempo beobachtete würdevolle Ruhe einigermaßen fremdartig absticht. Wie uns bedünken will, bleibt auch der Gesammteindruck an dieser Stelle hinter der beabsichtigten Wirkung zurück.
Bei weitem glücklicher für die Situation erscheint der Ton getroffen, in welchem drei schon begnadete Büßerinnen: die »Magna peccatrix«, die »Mulier samaritana« und die »Maria aegyptica« ihr Anliegen um Vergebung für »Gretchen« bei der Jungfrau Maria vorbringen. Es ist dies ein ganz apartes Musikstück von demüthig verlangendem und herzbewegendem Charakter. Die Wirkung desselben beruht ebensosehr in den, auf ruhig getragenen Baßtönen in nahezu gleichmäßigem Rhythmus sich entwickelnden harmonisch modulatorischen Combinationen, wie in der mild ernsten, durch sechzehn Takte ununterbrochen sich fortsetzenden Melodik der Oberstimme, welche Anfangs durch die dritte Stimme in der tieferen Octave verdoppelt ist. Bei der Wiederholung dieser ganzen Periode tritt noch der weibliche Chor (Sopran und Alt), die Bitte der drei Büßerinnen steigernd, hinzu, womit zugleich eine geistreiche Beziehung zum Schlußchor gegeben ist. Der Chor hat nämlich auf die Worte: »Vernimm unser Fleh'n« gleichzeitig mit dem Gesange der Büßerinnen wiederholt das im Quintintervall sich bewegende Motiv zu intoniren, mit welchem eben auch der Schlußchor des Ganzen beginnt. Dieses Motiv
hat unsern Meister, wie es scheint, bei Abfassung der Musik zum Faust-Epilog sehr beschäftigt: es tritt auch schon im Chor Nr. 4 bei der dritten Wiederholung der Stelle »Jauchzet auf«, sowie weiterhin namentlich bei den Worten »an sich herangerafft« im Tenor, und unmittelbar darauf im Instrumentalbaß auf90. Und selbst in dem [250] Cis-moll-Satz »Nebelnd um Felsenhöh'« klingt es zu Anfang des contrapunktisch durchgeführten Motiv's im Tripeltakt an.
In Betreff des Gesanges der drei Büßerinnen sei noch bemerkt, daß dieselben zuerst gleichzeitig beschäftigt sind, während doch die Textesworte in allen drei Partien ganz verschieden lauten. Indessen dürfte dies nur im ersten Augenblick auffallend erscheinen, da ja die Grundempfindung der Büßerinnen trotz der abweichenden Worte durchaus übereinstimmt, wie das denn in der musikalischen Behandlung treffend wiedergegeben ist. Die drei Stimmen haben eben auch Verschiedenes gleichzeitig zu singen, was sich im Ensemble sehr schön zu einer Empfindung eint.
Nach erfolgter Fürsprache läßt Gretchen sich endlich auch selbst mit einer an die »Himmelskönigin« gerichteten Bitte vernehmen. Die, »seeligen Knaben, in Kreisbewegung sich nähernd« betheiligen sich alsbald mit daran, so daß ein dreistimmiger von weiblichen Stimmen auszuführender Chor mit ihr zusammen wirkt. Dies ist auch in dem sich anschließenden bewegteren Tempo noch der Fall. Dann aber am Schluß desselben wendet sich Gretchen wiederum allein an die »gnadenreiche Jungfrau,« diesmal aber mit dem Anliegen, den »früh Geliebten,« welchen noch »der neue Tag blendet,« belehren und weiter geleiten zu dürfen, worauf die »Mater gloriosa« in einfachster Deklamation antwortet:[251]
»Komm! Hebe dich zu höhern Sphären!
Wenn er dich ahnet folgt er nach.«
Es folgt noch eine in apotheosirendem Sinne schließende Danksagung des »auf dem Angesicht anbetenden« Dr. Marianus an die Jungfrau Maria, und hierauf der achtstimmige Schlußchor. Seiner Einleitung liegt, wie schon erwähnt, das Quintenmotiv mit seinen leeren, gleichsam elementar wirkenden Intervallen zu Grunde, welches nach und nach in allen Stimmen erklingend, höchst bedeutsam durchgeführt wird. Die als Gegensatz zu diesem Thema gebildeten, auf- und abwärts steigenden chromatischen Gänge ergeben in Verbindung mit der vervollständigenden Orchesterbegleitung nach und nach einen wunderbaren Tonbau von feierlich erhabenem und geheimnißvollem Gepräge. Die Gesammtwirkung dieser im Pianissimo beginnenden und allmählig zum Forte anschwellenden Gedankenreihe zeigt Schumanns Divinationsgabe im glänzendsten Lichte. Denn die von ihm hier geschaffene Musik gewährt uns, ganz im Geiste der vom Dichter ausgesprochenen mystisch sententiösen Schlußworte, den Eindruck tiefsinniger Offenbarungen eines poetisch geschauten Uebernatürlichen. Schumann hielt dieses kleine Stück mit Recht selbst sehr hoch, und sogar für die »höchste Spitze« der ganzen Composition.91
Bemerkenswerth an diesem Einleitungssätze ist es, daß eine bestimmte Tonart darin nicht vorwaltet. Erst am Ende desselben stellt sich der Dominantseptakkord von F-dur fest, auf welchem der Chor von vier in einer Cadenz zum letzten Tempo überleitenden Solostimmen abgelöst wird.
Das Schlußallegro ist in zwei verschiedenen Bearbeitungen vorhanden. Die erste derselben, gleichzeitig mit dem Uebrigen im Jahre 1844 entstanden, genügte dem Meister nicht. Er spricht dies in einem Brief vom 18. September 1849 offen aus. Dort heißt es: »Mit dem Schlußchor, wie Sie ihn gehört haben,92 war ich nie zufrieden; die zweite Bearbeitung ist der, die Sie kennen, gewiß bei weitem vorzuziehen. Ich wählte aber jene, da die Stimmen der zweiten Arbeit noch nicht ausgeschrieben waren.« In der That ist die erste Fassung des Schlußallegro's, obwohl sie entschieden chormäßiger[252] wirkt wie die zweite, der Bedeutung des Ganzen wenig entsprechend: sie hat etwas heiter Weltliches, was der bis dahin sich ausprägenden Stimmung entgegensteht. Zwar erreicht auch die zweite aus dem Jahre 1847 herrührende Bearbeitung des Schlußchors dem geistigen Gehalt nach nicht ganz die Höhe des Werks, allein sie schmiegt sich durch die zum Ausdruck gebrachte edle und mild ernste Empfindung doch besser dem Vorhergegangenen an.
Als anziehendster Theil der zweiten Bearbeitung dürfte die zwischen den Buchstaben B und D befindliche Durchführung des, von den Vocalbässen im 9. und 10. Takt bereits intonirten melodischen Motivs zu bezeichnen sein, welches überdies durch die Hinzufügung des Quintintervalles auch in bedeutsame Beziehung zu dem langsamen im 4/2 Takt stehenden Einleitungssatz gebracht ist. Diese Bearbeitung zeigt den in allen contrapunktischen Künsten wohlerfahrenen Meister, der mit Leichtigkeit seine Materie beherrscht.
In anderer Weise führt Schumann vom BuchstabenE ab jenes Motiv im Chor durch, welches beim Buchstaben A zuerst vom Solosopran vorgetragen wird. Doch fehlt es trotzdem bei beiden, wie auch andern Stellen desselben Stückes an dem eigentlich polyphonen, mit der Macht des Vollklanges sich geltend machenden Chorstyl. Die Stimmen treten vielfach zu vereinzelt auf, so daß es zu wuchtigen Choreffekten nicht kommen kann. Dieser Umstand wird namentlich auch bei dem Tonsatz »Nebelnd um Felsenhöh« fühlbar, insoweit der Chor bei demselben betheiligt ist. Freilich scheint es, daß überall da, wo man die Massenwirkung des Chores in der Faustmusik vermißt, eine solche von Schumann nicht allein nicht beabsichtigt, sondern auch geradezu vermieden worden ist, um dem Tongemälde beziehentlich ein möglichst lichtes, gleichsam erdentrücktes Colorit zu verleihen. Dies vorausgesetzt, kann man selbstverständlich hier weder Händel'sche und Bach'sche noch auch Haydn'sche oder Mozart'sche Chorwirkungen erwarten.
Einen eigenthümlichen Reiz bildet der sein abgewogene Wechsel zwischen den Chor- und Solostimmen, welche sich miteinander zu gemeinsamer Thätigkeit bei der vorwärts strebenden, schließlich sanft verklingenden und gleichsam im Aether sich auflösenden Coda vereinigen.
Werfen wir noch einen Gesammtblick auf die Musik zum Faust-Epilog, so müssen wir freudig bekennen, daß sie im Ganzen und[253] Großen nicht nur zu den vorzüglichsten Gaben des Meisters gehört, sondern daß sie im Bereich der Conzertmusik überhaupt eine exceptionelle Stellung behauptet. Auch in Betreff des seltenen Reichthums der geläutertsten, zu Herzen gehenden Melodik, so wie der meisterlichen Handhabung des gesammten Darstellungsmaterials, insbesondere aber der meist glücklichen Stimmenbehandlung und der farbenreichen, immer das Richtige treffenden Instrumentirung, zeichnet sich diese Composition unter den größeren Schöpfungen Schumanns merklich aus. Endlich ist dem Werke noch das Verdienst zuzuerkennen, die stellenweise durch einen absonderlich schwülstigen Wortausdruck, man möchte sagen, verdunkelte poetische Idee der Dichtung in der glücklichsten Weise musikalisch interpretirt, und dadurch weiteren Kreisen in dankenswerthester Weise zugänglich gemacht zu haben. Dies stellte sich sogleich nach der ersten Aufführung des Werkes in Dresden (1848) heraus, und Schumann konnte mit Beziehung darauf an Fr. Brendel nach Leipzig berichten: »Am liebsten war mir von Vielen zu hören, daß ihnen die Musik die Dichtung erst recht klar gemacht.« Die ein Jahr später in Leipzig zu Goethe's Säcularfeier veranstaltete Aufführung hatte nicht gleich günstigen Erfolg, was Schumann keineswegs entgangen war. In seiner wohlmeinenden Gesinnung glaubte er dies auf die Neuheit des Eindrucks schieben zu müssen, indem er sich brieflich äußert, daß »einmaliges Hören« nie zur vollständigen Würdigung ausreiche. Wenn hieran auch etwas Wahres sein mag, so dürfte wohl die kühlere Aufnahme des Werkes bei seiner ersten Darstellung in Leipzig, wo man damals mit Schumanns Musik schon weit vertrauter war als an anderen Orten, auf momentane lokale Umstände zurückzuführen sein. Die großen Schönheiten gerade dieser Tondichtung liegen so offen, selbst für weniger Musikverständige zu Tage, daß eine unmittelbare, entschieden günstige Wirkung derselben auf ein gebildetes deutsches Publikum gar nicht ausbleiben kann.
Nach Vollendung der Composition des Schlusses von Goethe's Faust, zu welcher Schumann durch einen unverkennbaren wahlverwandtschaftlichen Zug getrieben worden, und die er »ein mit Liebe und Fleiß gehegtes Werk« nannte, kam ihm der naheliegende Gedanke, auch noch Einiges aus dem ersten und zweiten Theil dieser herrlichen Dichtung in Musik zu setzen. In Betreff dieser während der Jahre 1849–50 nachträglich noch geschriebenen Partien äußerte[254] Schumann gesprächsweise in Düsseldorf: »Als ich die Sachen componirte, habe ich hauptsächlich daran gedacht, daß sie vielleicht zur Complettirung von Conzertprogrammen dienen könnten, da man derartige Compositionen für Solo- und Chorgesang in kleinerem Umfange fast gar nicht hat.«
Schumann supponirte dabei keinesweges, wie wohl vielfach angenommen worden ist, den Gedanken, daß die drei Abtheilungen, in welche er die gesammten, von ihm componirten Faustscenen schließlich brachte, nothwendig als zusammengehörende Theile eines Ganzen in einem und demselben Conzert gegeben werden müßten. Im Gegentheil bemerkte er einmal ausdrücklich, wie man seine Faustmusik »nicht gut an einem Abend hintereinander werde aufführen können, weil darin zu viel Großes und Kolossales nebeneinandergestellt sei; höchstens mal als Curiosität möchte es geschehen dürfen.«
Diesem Ausspruch liegt sicher eine sehr richtige Empfindung zu Grunde, wie nicht zu verkennen ist.
Die schon namhaft gemachten Scenen des ersten und zweiten Theils der Faustmusik stehen, so viel Schönes und Bedeutendes dieselben auch im Einzelnen enthalten, nicht ganz auf dem Niveau der eben besprochenen Musik zum Epilog. Und zwar schon deshalb nicht, weil es nur bruchstückartige Compositionen sind, in denen keine einheitlich durchgehende Idee vorhanden ist. Aber auch hinsichtlich des künstlerischen Gehaltes erscheinen dieselben von ungleichem Werth. Wie dem immer sei, – man muß dem Meister auch für diese Schöpfungen dankbar sein, denn sie enthalten so Manches, was wohl geeignet ist, unsere Kenntniß von Schumanns eigenartigem Naturell in gewissen Beziehungen zu erweitern.
Bemerkenswerth erscheint zunächst der Umstand, daß unser Meister unbekümmert um Goethe's ausdrückliche Vorschriften für die Anwendung der Musik nur das zur Composition auswählt, was ihm gerade dazu geeignet scheint. So gleich bei der auf die Ouvertüre folgenden Gartenscene. Sowohl Entwickelung wie Zusammenhang der Dichtung sind hier außer Acht gelassen. Schumann entnimmt derselben einzelne Theile und benutzt dieselben in der Hauptsache zu einem Duett zwischen Faust und Gretchen, an welchem schließlich ebenso unerwartet wie störend für die musikalische Empfindung auch noch Mephistopheles und Martha sich betheiligen. Man könnte nun freilich mit Recht bemerken, daß die ganze Scene, wie sie von Goethe[255] geschrieben ist, für die musikalische Behandlung nicht geeignet sei. Allein dieser Einwand dürfte auch zum Theil noch von den Partien gelten, welche Schumann für seinen Zweck heraushebt. Was der Dichter z.B. in dem wunderbar naiven Dialog zwischen Faust und Gretchen während des Spieles mit der Sternblume ausgesprochen hat, wird sich schwerlich durch ein anderes Medium in so sicher treffender Weise wiedergeben lassen, als es durch das Wort geschehen ist. Unserm Meister wenigstens ist es nicht gelungen. Hiervon abgesehen, hat Schumann mit Hilfe des orchestralen Apparats ein sein empfundenes, in einzelnen Momenten zu hinreißendem Ausdruck sich steigerndes Tongemälde hingestellt, bei dem nur zu bedauern bleibt, daß es gesanglich theilweise nicht zu plastischer Wirkung gebracht werden kann, weil die allzu reiche Instrumentation überwuchernd und erdrückend auf den Stimmen lastet. Der Meister ging hierbei mit voller Absichtlichkeit zu Werke. Gelegentlich äußerte er darüber: »ich habe die Scene im Garten vollstimmig instrumentirt, weil die ganze Stimmung eine so reiche, volle ist. Auch darf man so etwas nicht gewöhnlich behandeln.« Gewiß ist hieran etwas Wahres. Allein der wirkliche Grund liegt wohl darin, daß Schumann sich dazu verleiten ließ, möglichst Alles, was in der Dichtung zwischen den Zeilen zu lesen ist, durch die Begleitung wiedergeben zu wollen, ohne dabei der menschlichen Stimme und deren unerschöpflichem Ausdrucksvermögen gerecht zu werden. Was einerseits durch die bevorzugte und entschieden dominirende Stellung des Orchesters gewonnen wird, geht andererseits durch die Beeinträchtigung der Singstimmen verloren. Und so kann denn der Gesammteindruck die erwünschte Wirkung nicht erreichen.
Ähnlich verhält es sich mit der Zwingerscene: Gretchen vor dem Bild der »Mater dolorosa«. Es fehlt diesem in Betreff der Singstimmen überwiegend deklamatorisch gehaltenen Tonsatz keineswegs an seinen, vorzugsweise der reich und eigenthümlich gefaßten Instrumentalbegleitung einverleibten Zügen und Accenten. Doch vermag auch hier Schumann nicht der, Alles sagenden Dichtung noch irgend eine Steigerung zu verleihen. Was bei diesem Stück überdies dem Genuß hemmend im Wege steht, ist die ungebundene, phantasieartige Behandlung, welche keinen Ersatz für den Mangel einer breiteren, in geschlossener Form zum Ausdruck kommenden Melodik gewährt,[256] und für das Verständniß der tondichterischen Intention nicht sehr fördernd ist.
Mehr, obwohl auch nur theilweise ist dem Meister in formeller Hinsicht die den ersten Theil des Faustcyklus abschließende »Scene im Dom« gelungen. Doch macht sich hier wiederum ein anderes Bedenken geltend. Es bezieht sich auf die Art und Weise, wie Schumann den bösen Geist und Gretchen miteinander musikalisch sprechen läßt. Die Unzulänglichkeit dieser deklamatorisch spröden und ziemlich farblosen Wechselrede macht sich um so fühlbarer, als die zermalmenden Worte, mit denen die in Gretchen qualvoll sich steigernden Gewissensbisse und die daraus hervorgehende Seelenangst so lebenswahr geschildert sind, in dieser Fassung merklich an Energie verlieren.
Ob hier die melodramatische Gestaltung nicht den Vorzug verdient hätte, möge dahingestellt bleiben. Jedenfalls wäre durch dieselbe die Gewalt des dichterischen Wortes mehr zur Geltung gekommen, wie in der vorliegenden Composition. Und noch ein wesentlicher Vortheil war sonder Mühe damit zu erreichen: die angemessene Hervorhebung des Gegensatzes zwischen dem »Bösen Geist« und Gretchen, oder was ganz dasselbe ist, zwischen der vorwurfsvollen Sprache des in Gretchen erwachten Gewissens und der bitteren Seelenpein, von welcher sie infolge dessen ergriffen wird. Goethe hat mit eben so seinem psychologischen Verständniß als richtigem ästethischen Gefühl diese in ein und demselben Individuum sich vollziehenden Vorgänge auseinandergelegt, indem er den »Bösen Geist« die furchtbaren Mahnungen des Schuldbewußtseins aussprechen läßt, während Gretchen selbst in durchaus mädchenhaft naiver Weise den Gefühlen der Herzensangst und Verzweiflung Ausdruck giebt. Diese Contraste mußten, um dem Gemälde das richtige Colorit zu verleihen, in der musikalischen Behandlung Berücksichtigung finden. Ob dies überhaupt möglich sein würde, ist eine Frage, von deren Erörterung hier abgesehen sei, weil dadurch an der vorliegenden Composition nichts mehr zu ändern ist.
Im Verlaufe dieses Tonsatzes, in welchem beiläufig gesagt, mit Vortheil das ominöse »Nachbarin! Euer Filischchen« zu unterdrücken gewesen wäre, tritt zu den Solostimmen noch der volle Chor mit dem »Dies irae« hinzu, ohne daß dadurch indessen eine besonders günstige Wendung für die Wirkung gewonnen wird. Der Meister[257] bewegt sich hier auf einem seinem Gefühlsleben fremden Gebiet: die Schrecken. des jüngsten Gerichts zu malen, war ihm nicht gegeben; er hatte eine andere Kunstmission zu erfüllen.
Dies wird doppelt fühlbar, wenn wir die Anfangsscene der zweiten Abtheilung betrachten, welche mit dem Gesange Ariel's beginnt. Schumann betritt damit wieder eine Region, in der er mit souveräner Macht herrscht.
Es ist jedenfalls sehr bemerkenswerth, daß vor Schumann Niemand auch nur den Versuch gemacht hat, vom zweiten Theil des Faust, geschweige denn von dem dazu gehörenden Schluß, irgend Etwas in Musik zu setzen, während der erste Theil dieser, in ihren Hauptzügen so großartig angelegten und durchgeführten Dichtung schon mehrfach, wenn auch, mit Ausnahme von Schubert's dahingehörigen genialen Compositionen, nur unzureichende tonkünstlerische Arbeiten hervorgerufen hatte. Sicher waltet hier kein Zufall ob. Es fehlte eben an einer künstlerischen Persönlichkeit, die, mit dem erforderlichen tondichterischen Vermögen ausgestattet, auch die specifische Begabung und Hinneigung für die Aufgabe in sich trug. Alle diese Bedingungen trafen eben bei Schumann in seltener Vereinigung zusammen, wie sich schon bei der Betrachtung seiner Musik zur letzten Scene des Faust ergab. Verfolgen wir dies nun auch im Besonderen an seinen dem zweiten Theil des Faust gewidmeten Compositionen.
Durch den tragischen Untergang Gretchens im Bewußtsein verübter Schuld erschüttert, betäubt, sucht Faust, sich in die Arme der Natur werfend, Heilung des kranken Gemüths. Er findet sie. Gute Geister, geführt von Ariel, nahen sich ihm »des Herzens grimmen Strauß besänftigend« und »des Vorwurfs glühend bittre Pfeile entfernend.«
Eine Instrumentaleinleitung mit Harfenbegleitung, dazu bestimmt, die vom Componisten weggelassene Anfangsstrophe Ariel's illustrirend zu ersetzen, führt uns in die entsprechende Stimmung ein. Diese süß berauschenden Weisen mit ihren friedvoll besänftigenden Klängen, sie sind wie lindernder Balsam für eine verwundete, schmerzlich bewegte Seele.
Lieblich reizvoller Solo- und Chorgesang des »Geister-Kreises« wiegt Fausten in sanften Schlaf. »Fühl' es vor! Du wirst gesunden; traue neuem Tagesblick,« rufen die Elfen dem Ruhenden hoffnungbeseelend zu.[258]
Die von Schumann hier kunstvoll aneinandergereihten, so schönen Tonsätze voll Innigkeit, Zartheit und poetischem Schwung, werden durch Ariel's glanzvoll instrumentirte Verkündigung des herannahenden Tageslichts unterbrochen. Gestärkt und neu belebt durch erquickenden Schlummer erwacht Faust, dessen nunmehr folgender, sehr ausgedehnter Monolog »des Lebens Pulse schlagen frisch lebendig«, von Schumann mit offenbarem Gewinn für die, ohnehin dem Vorhergegangenen nicht mehr ganz ebenbürtige Composition gekürzt ist. Die überwiegend deklamatorische Behandlung wirkt auch an dieser Stelle einigermaßen ermüdend. Zu übersehen ist dabei freilich nicht, daß die Aufgabe, welche Schumann sich gestellt, gerade hier ungemein große, kaum befriedigend zu lösende Schwierigkeiten darbot. Wenn man sich dies vergegenwärtigt, so wird man dem Genius des Meisters im Hinblick auf den so herrlich sich steigernden Schluß dieses Faustgesanges um so lieber rückhaltlose Bewunderung zollen.
Von den drei Scenen der zweiten Abtheilung bietet die eben betrachtete jedenfalls das Anmuthendste, wenn nicht geradezu das Schönste. Den schroffsten Gegensatz des Colorits bildet dazu die folgende Scene der vier grauen Weiber. Während dort Alles licht- und glanzvoll ist, empfangen wir hier den Eindruck des mitternächtlich Gespenstigen. Faust ist dem Ende der irdischen Laufbahn nahe gerückt; das Alter macht seine Rechte geltend. Mangel, Schuld, Sorge und Noth, diese vier leidigen Gefährten des Menschendaseins, sie nahen sich in den Gestalten grauer Weiber dem unablässig strebenden Greise, um ihre Künste an ihm zu versuchen, Ihr Erscheinen auf dem Schauplatz der Handlung hat Schumann in meisterhaft bezeichnender Tonmalerei geschildert. Diese im Pianissimo hingehauchten Sechzehntheilfiguren der Geigen und Bratschen mit ihrer sprunghaft flatternden und harmonisch modulatorisch schnell wechselnden Bewegung geben ein frappantes Bild der schemenhaft herbeihuschenden Gestalten. Und nun noch deren monoton abgerissener Gesang, – es ist ein vom salben Scheine beleuchtetes Nachtstück, wie es nur dem geisterkundigen Schumann gelingen konnte.
Nur eine von den vier elendbringenden Schwestern findet den Eingang zu Faust's Gemach: es ist die Sorge. Sie hat auf die Forderung des, am Ziele seines Lebensweges stehenden Greises, sich zu entfernen, nur die Antwort: »ich bin am rechten Ort«. Da entspinnt sich ein ausgedehnterer Wechselgesang zwischen Beiden, in allen[259] seinen Theilen charakteristisch gedacht und wirkungsvoll dargestellt. Besonders glücklich empfunden erscheint namentlich der Satz: »Ich bin nur durch die Welt gerannt«, wie auch der auf Faust's Erblindung folgende Schlußmonolog »die Nacht scheint tiefer tief herein zu dringen« mit seinem energischen Aufschwung bei den Worten »Laßt glücklich schauen was ich kühn ersann«.
Jetzt aber soll sich die schrille Mahnung der grauen Schwestern erfüllen:
»Dahinten, dahinten! von ferne von ferne,
Da kommt er, der Bruder, da kommt er der – –
– – Tod.«
Der Componist führt uns zu dem tiefernsten Abschluß seiner ergreifenden Tondichtung hinüber. Mephistopheles das nahe Ende Faust's voraussehend, ertheilt den eiligst herbeigerufenen Lemuren die Anweisung, dem Herrn im Vorhofe seines Palastes die letzte Ruhestätte zu bereiten. Grabend singen sie in zweistimmigem Chor herb melancholische Weisen von eintönigem, rhythmisch scharf ausgeprägtem Charakter, – eine unheimliche, den Ton der Dichtung sicher treffende Musik, angemessen eingeleitet und vorbereitet durch die Beschwörungsworte Mephisto's. Auch das Orchester hat hier wiederum durch entsprechende Tonmalerei, – es sei nur an die fortlaufende, das Spatengeklirr versinnlichende Achtelbewegung der Bässe erinnert – wesentlichen Antheil an der Wirkung dieses klar gegliederten und formenfest gestalteten Tonsatzes.
Faust ins Freie hinaustretend, giebt sein inneres Behagen über die in Angriff genommene Arbeit zu erkennen, indem er wähnt, daß es sich um die Ausführung eines von ihm geplanten Werkes handelt, worauf Mephistopheles vor sich hin halb mitleidig, halb spöttisch und wie im Stillen triumphirend, die Antwort murmelt. Sodann ergreift Faust zum letzten Mal das Wort, um in einem breiter sich ergehenden Gesange von edelm gehaltvollem Gepräge, seinen auf das geträumte große Unternehmen bezüglichen Gedanken Ausdruck zu verleihen.
»Es kann die Spur von meinen Erdetagen
Nicht in Aconen untergehn. –
Im Vorgefühl von solchem hohen Glück
Genieß' ich jetzt den höchsten Augenblick.«
So ruft er mit stolzem Selbstgefühl aus, und kaum ist es geschehen, so sinkt er auch schon entseelt zu Boden.
Diesen bedeutungsvollen Moment, den der Meister mit Hilfe des[260] Orchesters auf charakteristische Weise ausmalt, folgt nach einer kurzen Betrachtung Mephisto's zu den Worten »die Uhr steht still! – – – es ist vollbracht«, der feierlich getragene Schluß, in choralartig getragenen Akkorden auslaufend. Die bei Goethe noch gegebene, maaßlos ausgedehnte und für tonkünstlerische Zwecke kaum ergiebige Schilderung des Kampfes mit den Engeln um Faust's Seele, konnte Schumann um so eher unberücksichtigt lassen, als das eigentliche Ende der fraglichen Scene mit dem Tod des Helden der Dichtung eintritt.
Mit dem zweiten Theil der Faustmusik war ein seiner geistigen Bedeutung nach staunenswürdiges Werk in mehrjähriger hingebender Thätigkeit so weit gefördert, daß zur Vollendung desselben nur noch eine die Grundstimmung des Ganzen vorbereitende Instrumentaleinleitung erforderlich war. Lange Zeit verging indessen, ehe es dem Meister möglich wurde eine solche zu schaffen. In Düsseldorf äußerte Schumann zu Anfang des Jahres 1851: »Ich bin oft mit dem Gedanken umgegangen, eine Ouvertüre zu den Faustscenen zu schreiben, habe aber die Ueberzeugung gewonnen, daß diese Aufgabe, die ich mit für die schwierigste halte, kaum befriedigend zu lösen sein wird; es sind da zu viele und zu gigantische Elemente zu bewältigen. Doch aber wird es nöthig sein, daß ich der Musik zum Faust eine Instrumentaleinleitung voranschicke, sonst rundet sich das Ganze nicht ab, und die verschiedenen Stimmungen müssen auch vorbereitet sein. Indeß kann man so was nicht auf der Stelle machen; ich muß den Moment der Eingebung abwarten, dann geht es schnell. Ich habe mich, wie gesagt, häufig mit der Idee einer Faustouvertüre beschäftigt, aber es geht noch nicht.«
Wie richtig Schumann's Bedenken in diesem Falle waren, zeigt der nach mehrjährigem Meditiren endlich noch für den erörterten Zweck im August 1853 niedergeschriebene Instrumentalsatz, welcher in seiner Totalität trotz einzelner hervorragender und begeistigter Momente volle Befriedigung nicht gewährt. Man hat das Gefühl, als ob dieser Composition die letzte Ueberarbeitung, mit einem Wort, die Durchbildung bis zu plastischer Klarheit fehlte, und als ob man sich vor einem Gemälde von großen Intentionen befindet, welches von der Skizze auf die Leinwand übertragen, eben erst nur theilweise untermalt ist. Allerdings darf man bei Beurtheilung dieses Musikstückes nicht vergessen, daß es jener späten Zeit der Wirksamkeit des verehrten Meisters angehört, in welcher sein productives Vermögen bereits[261] Spuren geistiger Ermattung erkennen läßt. In seinen guten Tagen wäre dem Schöpfer der Manfredmusik, so wie mancher andern ebenbürtigen Werke, auch die Faustouvertüre in schönster Weise gelungen. Wie dem immer sei, – nehmen wir diejenige, welche Schumann uns hinterlassen hat, als ein werthvolles Symbol seines bis zum letzten Augenblick unermüdlichen, edlen Strebens hin.
Der Spätsommer des Jahres 1850 brachte für Schumann ein höchst wichtiges und folgenreiches Ereigniß mit sich: die Uebernahme der städtischen Musikdirektorstelle in Düsseldorf nämlich, welche damals durch die Berufung Ferd. Hiller's als Capellmeister nach Cöln erledigt worden war. Der letztere vermittelte diese Angelegenheit zwischen Schumann und der Direktion des »allgemeinen Musikvereins«, wie aus den drei folgenden Briefen hervorgeht:
Lieber Hiller,
Vielen Dank für Deine Mittheilung. Dein Vorschlag hat viel Anziehendes, doch tauchten auch einige Bedenken dagegen auf. In beiden Beziehungen, glaub ich, möchten meine Gedanken mit Deinen eigenen zusammenstimmen, ehe Du Dich zur Annahme der Stelle entschlossest. Namentlich ist mir aber noch Mendelssohn's Ausspruch über die dortigen Musiker in Erinnerung und klang schlimm genug.93 Auch Rietz sprach mir davon zur Zeit als Du von hier nach D. zogest, und »wie er nicht begreifen könne, daß Du die Stelle angenommen«. Ich sagte Dir damals nichts davon, um Dich nicht zu verstimmen.
Darüber, lieber Hiller, schenke mir nun reinen Wein ein. Viel Bildung trifft man freilich überall nur selten in Orchestern und ich verstehe es wohl auch, mit gemeinen Musikern zu verkehren, aber nur nicht mit rohen oder gar malitiösen.
Sodann bitte ich Dich noch über dies und jenes mir Auskunft zu geben. Am Besten ich frage eines nach dem andern:
1) Ist die Stelle eine städtische? Wer gehört zunächst zu dem Vorstand?
2) Der Gehalt ist 750 Thaler (nicht Gulden)?
3) Wie stark ist der Chor? Wie stark das Orchester?
[262] 4) Ist das dortige Leben eben so theuer, als z.B. hier? Was zahlst Du für Dein Logis?
5) Kann man meublirte Logis haben?
6) Wäre für den Umzug, die theuere Reise hin nicht eine billige Entschädigung zu erlangen?
7) Wäre der Contract nicht so zu stellen, daß ich, wo sich mir eine andere Stellung böte, aufkündigen könnte?
8) Dauern die Vereinsübungen auch den Sommer über?
9) Bliebe im Winter Zeit zu kleinen Ausflügen von 8–14 Tagen.
10) Würde sich für meine Frau irgend ein Wirkungskreis finden lassen? Du kennst sie; sie kann nicht unthätig sein.
Und nun noch ein Hauptpunkt. Vor Ostern 1850 könnte ich nicht abkommen. Meine Oper wird im Februar ganz bestimmt in Leipzig, und bald darauf in Frankfurt vermuthlich in Angriff genommen. Da muß ich natürlich dabei sein. Ueber all dieses bitte ich Dich nun mir Auskunft zu geben und dann wollen wir das Weitere besprechen. Sehr schwer wird uns die Trennung von unserm Sachsenland werden – und doch ist's auch heilsam, aus dem gewohnten Kreislauf der Verhältnisse einmal wieder zu neuen überzugehen. Sonst sind wir hier sehr thätig. Klara giebt mit Schubert94 sehr besuchte Soiréen; ich habe eine Aufführung der Peri vor und bin mit einer großen Anzahl Arbeiten unausgesetzt beschäftigt. Darüber in meinem nächsten Briefe mehr. Habe nochmals herzlichen Dank, daß Du meiner gedacht in der Sache; möge die weiteren Entschlüsse ein guter Genius leiten. Tausend Grüße von meiner Frau an die Deinige, wie an Dich.
Dresden, den 19. November 1849.
R. Schumann.
Diesem Brief folgte sehr bald ein zweiter, als Antwort auf einen inmittelst von Hiller eingegangenen:
Dresden, d. 3. December 1849.
Lieber Hiller,
Die ganze Zeit her litt ich an Kopfschmerz, der mich an allem Arbeiten und Denken hinderte. Daher die etwas verspätete Antwort.
Dein Brief, alles was Du mir schreibst, macht mir immermehr Lust zu Düsseldorf. Sei nun so gut, mir zu schreiben, bis wann Du glaubst, daß die Herren Vorstände einen bestimmten Entschluß wegen[263] Annahme der Stelle von mir wünschen. Brauchte ich mich nicht vor Ostern zu entscheiden, so wäre mir das am liebsten. Ich werde Dir später sagen, warum? – Noch eines: ich suchte neulich in einer alten Geographie nach Notizen über Düsseldorf und fand da unter den Merkwürdigkeiten angeführt: 3 Nonnenklöster und eine Irrenanstalt. Die ersteren lasse ich mir gefallen allenfalls; aber das letztere war mir ganz unangenehm zu lesen. Ich will Dir sagen, wie dies zusammenhängt. Vor einigen Jahren, wie Du Dich erinnerst, wohnten wir in Maxen95. Da entdeckte ich denn, daß die Hauptansicht aus meinem Fenster nach dem Sonnenstein96 zu ging. Dieser Anblick wurde mir zuletzt ganz fatal; ja, er verleidete mir den ganzen Aufenthalt. So dachte ich denn, könne es auch in Düsseldorf sein. Vielleicht ist aber die ganze Notiz unrichtig, und die Anstalt dann nur ein Krankenhaus, wie sie in jeder Stadt sind.
Ich muß mich sehr vor allen melancholischen Eindrücken der Art in Acht nehmen. Und leben wir Musiker, Du weißest es ja, so oft auf sonnigen Höhen, so schneidet das Unglück der Wirklichkeit um so tiefer ein, wenn es sich so nackt vor die Augen stellt. Mir wenigstens geht es so mit meiner lebhaften Phantasie. Erinnere ich mich doch auch etwas ähnliches von Göthe gelesen zu haben. (Sans comparaison.) –
Dein Gedicht zur Erinnerung an Chopin97 hab' ich gelesen und Dein allgewandtes Talent darin bewundert. Auch ich hatte hier eine Feier vor. Die Behörde schlug mir aber die Frauenkirche ab. Wir waren sehr ärgerlich darüber.
Da fällt mir ein, Dich zu fragen, wird im nächsten Jahre ein Rheinisches Musikfest zu Stande kommen? Und in welcher Stadt? Es sollte mir Freude machen, dabei mitwirken zu können, und schiene mir eine gute Gelegenheit, mich in den Rheinlanden einzuführen. Schreibe mir, was Du darüber denkst.
Aeußerst fleißig war ich in diesem Jahre, wie ich Dir wohl schon schrieb; man muß ja schaffen, so lang es Tag ist. Auch sehe ich mit Freuden, wie die Theilnahme der Welt an meinen Bestrebungen mehr[264] und mehr wächst. Auch dies spornt an. Kämest Du nicht vor Deiner gänzlichen Uebersiedelung nach Köln noch einmal hieher? Es war immer die Rede davon.
Mit herzlichem Gruß
Dein
R. Schumann.
Nachdem Schumann über die, in vorstehendem Briefe geäußerten Besorgnisse beruhigt worden, war nur noch ein Bedenken wegen definitiver Annahme der Düsseldorfer Musikdirektorstelle vorhanden.
Doch Schumann spreche selbst:
Lieber Hiller,
Wir haben hier in den letzten acht Tagen zweimal die Peri herausgebracht – Du weißest, was das heißen will, und wirst mich entschuldigen, daß ich Dir noch nicht geantwortet.
So freundlich und annehmlich nun die Vorschläge sind, die Du mir im Namen des Musikvereins stellst, so kann ich als ehrlicher Mann doch nicht anders schreiben, als was ich Deinem Vorstande auch direkt schon gemeldet, daß sie wegen der definitiven Antwort sich bis Anfang April noch gedulden möchten. Im Vertrauen, lieber Hiller! Es sind hier für mich von einigen einflußreichen Leuten Schritte gethan worden98 – und obgleich ich nicht recht daran glaube, so ist mir doch gerathen worden, mit der bestimmten Annahme einer anderen Stellung noch zu warten. Desgleichen habe ich aber auch erklärt, daß dies nur bis zum 1. April der Fall sein würde.
Das kannst Du mir aber sicher nicht verdenken, daß ich, im Fall ich die hiesige Capellmeisterstelle erhielte, oder auch nur bestimmte Aussicht dazu, es binnen Jahr und Tag zu werden, den großen Umzug nach D. ersparen möchte, in wie vieler Beziehung auch die dortige Stellung mir lieber wäre.
Du weißest nun, was Du Dir vielleicht schon gedacht hast; im Uebrigen bitte ich Dich, gegen Niemanden, als die Nächstbetheiligten, der Sache zu erwähnen.
Die erste Aufführung der Peri war mir sehr gelungen, die zweite (des 3ten Theils) durch den brillanten Gesang der Schwarzbach99 zur Geltung gelangt, was mich sehr freute.
[265] Sonst ist jetzt alles in Spannung auf den Propheten – und ich habe viel deshalb auszustehen. Mir kommt die Musik sehr armselig vor; ich habe keine Worte dafür, wie sie mich anwidert.
Gehab Dich wohl, lieber Hiller! Grüße Deine Frau herzlich und gedenke freundlich
Dresden, d. 15. Januar 1850.
Deines ergebenen
R. Sch.
Die Hoffnung, in Dresden einen öffentlichen Wirkungskreis als Dirigent zu finden, schwand, und Schumann wandte sich daher nach Düsseldorf, wo er sammt seiner Gattin mit offenen Armen empfangen wurde. Des Umstandes eingedenk, daß in Schumann ein Meister von außerordentlicher Bedeutung zu bewillkommnen sei, hatte man eine Empfangsfeierlichkeit vorbereitet, welche beim Eintreffen des Künstlerpaares in Düsseldorf am 2. September 1850 stattfand. Sie bestand in einem Festessen, dem eine musikalische Produktion des Gesang- und Musikvereines voraus ging. Unter den dabei zu Gehör gebrachten Stücken befand sich der zweite Theil aus »Paradies und Peri«. Auch sonst ließ man es nicht an den zartesten Aufmerksamkeiten gegen den neuen Dirigenten fehlen, die indeß zugleich seiner Gattin galten, und Alles deutete darauf hin, daß man die Gewinnung eines so bedeutenden Künstlerpaares als ein hoch erfreuliches Ereigniß betrachtete.
Schumann's erste Leistung als städtischer Musikdirektor erfolgte am 24. October in dem ersten Abonnementsconcerte der Saison 1850–51. Das Programm desselben war: »Große Ouvertüre (C-dur op. 124) von Beethoven. Concert (G-moll) für Pianoforte und Orchester von F. Mendelssohn-Bartholdy, vorgetragen von Frau Clara Schumann. Adventlied von Rückert, Motette für Chor und Orchester, componirt von R. Schumann. Präludium und Fuge (A-moll) von J. S. Bach, vorgetragen von Frau C. Schumann. Comala von N. W. Gade.«
Die amtlichen Funktionen Schumann's waren, außer der Leitung dieser Concerte, mit den wöchentlichen Uebungen des Gesangvereines und einigen, bei dem Gottesdienst der katholischen Kirche üblichen alljährlich regelmäßig wiederkehrenden Musik-Aufführungen verknüpft. Wie behaglich er sich in seinem Wirkungskreise, wenigstens während[266] der beiden ersten Jahre fühlte, geht aus einem Briefe an E. Klitzsch100 hervor, in welchem er schreibt: »Ich bin sehr zufrieden in meiner hiesigen Stellung, und wüßte, da sie meine physischen Kräfte auch nicht zu sehr in Anspruch nimmt (dirigiren strengt doch sehr an), kaum eine, die ich mehr wünschte.«
Schumann hatte ebensowenig entschiedenes Talent zur Direktion, wie zur musikalischen Pädagogik101. Zu beidem fehlten ihm die wesentlichsten Eigenschaften, zunächst aber das Vermögen, sich mit Anderen in engen Rapport zu versetzen, ihnen seine Intentionen klar und anschaulich zu machen; dies deshalb, weil er entweder gar nicht, oder doch so leise sprach, daß er nur selten dem Wortlaute nach verstanden wurde. Dann auch mangelte ihm die physische Ausdauer und Energie zu einem Direktorialposten; er war immer sehr bald erschöpft, und mußte von Zeit zu Zeit ausruhen im Verlaufe einer Probe. Endlich entbehrte er Massen gegenüber der erforderlichen Um- und Uebersicht. Dagegen hatte er wiederum für sich: eine hochbedeutende, verehrungswürdige künstlerische Persönlichkeit, der eine ernste, würdevolle und ehrfurchtgebietende Haltung eigen war. Letzterer, so wie dem Umstande, daß er Chor und Orchester in einem wohlgeordneten Zustande vorfand, ist es zuzuschreiben, wenn etwa die erste Hälfte seiner Düsseldorfer Wirksamkeit von guten, erfreulichen Erfolgen begleitet war. Die meisten Aufführungen derselben erwiesen sich im Allgemeinen als genußbringend102.
So blieb das Unzureichende seiner Direktorialbefähigung zunächst den Uneingeweihten verhüllt. Fühlbar machte es sich erst, als sein mehr und mehr sich entwickelnder krankhafter Zustand, so wie das gleichzeitig allmälige Hervortreten einer gewissen Indolenz ihm die Möglichkeit raubte, ferner das noch zu leisten, was er früher wirklich zu leisten im Stande gewesen war; wodurch sich denn nach und nach eine gewisse Verstimmung in den musikalischen Kreisen, welchen Schumann leitend vorstand, verbreitete und festsetzte. Daß dadurch auch die etwa Böswilligen, deren es bei jeder Gelegenheit giebt, eine erwünschte Handhabe gegen Schumann erhielten, bedarf[267] keiner Frage oder Verwunderung. Nichts desto weniger wurde sein Engagement von Jahr zu Jahr auf Grund einer sehr wohlangebrachten Pietät verlängert. Dies konnte indessen nicht verhindern, daß sich das Verhältniß, soweit es Schumann's Direktionsthätigkeit betraf, im Herbst 1853 nach Ablauf des ersten der üblichen Winterconcerte, welches am 27. October stattfand103, plötzlich in überraschender Weise auflöste. Die Veranlassung zu diesem Resultate war folgende104: Der »Verwaltungsausschuß des allgemeinen Musikvereins« glaubte im Hinblick auf Schumann's immer mehr schwindende Leistungsfähigkeit als Dirigent sowohl in des Meisters Interesse, sowie in dem der Sache zu handeln, wenn er ihn zur Schonung seiner Gesundheit veranlaßte, das Dirigiren (ausgenommen etwa seine eigenen Compositionen) für einige Zeit einzustellen. Julius Tausch, dem Schumann selbst bereits die Leitung des Gesangvereins interimistisch übertragen hatte, war erbötig, den Meister provisorisch auch bei den Concerten zu vertreten. In diesem Sinne wurde nun versucht, die Sache durch Schumann's Gattin zu vermitteln. Der Meister nahm den Vorschlag übel auf. Bei der nächsten Probe wartete man vergeblich eine halbe Stunde auf ihn. Als er dann nicht erschien, nahm man an, daß er nicht dirigiren wolle, und der Verwaltungsausschuß ersuchte J. Tausch ohne Weiteres, die Leitung zu übernehmen, da das Concert bereits annoncirt war, und angeblich nicht mehr abbestellt werden konnte. Hiermit hörte Schumann's Thätigkeit als Dirigent auf.
Nachdem vorstehend im Wesentlichen, und so weit es für die gegenwärtige Darstellung nothwendig erscheint, mit wenigen Worten Schumann's praktische Wirksamkeit während seines Düsseldorfer Lebens anticipirend berührt worden ist, sind noch die erforderlichen Mittheilungen über seine, in diese Periode fallende schöpferische Thätigkeit und über andere äußere Erlebnisse nachzuholen.
Kaum war Schumann in den neuen Verhältnissen ein wenig heimisch geworden, als er neben den amtlichen Arbeiten auch sogleich wieder anfing, seinem Schaffensdrange Genüge zu thun. Für das Jahr 1850 nennt das Compositionsverzeichniß als in Düsseldorf entstanden:
[268] »Ende September. Instrumentation des Neujahrsliedes von Rückert105 (op. 144, Nr. 9 der nachgelassenen Werke).
Vom 10.–16. October, Concertstück für Violoncello mit Begleitung des Orchesters skizzirt, bis zum 24. instrumentirt (op. 129).
Vom 2. November bis 9. December. Symphonie inEs-dur (in 5 Sätzen) skizzirt und instrumentirt (op. 97)106.
1850. December. Vom 29.–31., skizzirt: Ouvertüre zu Schiller's Braut von Messina (op. 100).«107.
Die Symphonie in Es-dur, der Entstehung nach die vierte, könnte man im eigentlichen Sinne des Wortes »die Rheinische« nennen, denn Schumann erhielt seinen Aeußerungen zufolge den ersten Anstoß zu derselben durch den Anblick des Cölner Domes. Während der Composition wurde der Meister dann noch durch die, in jene Zeit fallenden, zur Cardinalserhebung des Cölner Erzbischofs v. Geissel stattfindenden Feierlichkeiten beeinflußt. Diesem Umstande verdankt die Symphonie wohl geradezu den fünften, in formeller Hinsicht ungewöhnlichen Satz (den vierten der Reihenfolge nach), ursprünglich überschrieben: »Im Charakter der Begleitung einer feierlichen Ceremonie.« Bei Veröffentlichung des Werkes strich Schumann diese, des leichteren Verständnisses halber hinzugefügte Aufschrift. Er sagte: »Man muß den Leuten nicht das Herz zeigen, ein allgemeiner Eindruck des Kunstwerkes thut ihnen besser; sie stellen dann wenigstens keine verkehrten Vergleiche an.« In Betreff des Charakters der andern Sätze fügte er hinzu: »es mußten volksthümliche Elemente vorwalten, und ich glaube es ist mir gelungen«, was auch auf zwei Stücke (nämlich das zweite und fünfte), in ihrer planen, fast populären Haltung, Anwendung finden dürfte.
Dieses Werk läßt deutlich die wohlthätigen Anregungen erkennen, welche Schumann durch den Wechsel der Verhältnisse, durch die neue Umgebung so wie durch den veränderten Wirkungskreis empfing. Dasselbe offenbart eine anmuthende Frische der Empfindung, die sich sogleich in den ersten Takten fühlbar macht. Bedeutsam tritt das[269] Hauptmotiv auf, dessen elastisch-schwungvoller Ausdruck durch Synkopirungen verstärkt wird. Es ist, als ob dem Meister bei Erfindung desselben die schlank sich erhebenden Pfeiler und kühn gespannten Bogen des großartigen Baudenkmales vorgeschwebt hätten, welches die erste Anregung zu der in Rede stehenden Tonschöpfung gab. Der kräftig und stolz aufstrebende Charakter dieses breit angelegten Thema's dominirt auch mehrentheils im Verlaufe des ganzen Stückes. Einen entschiedenen Gegensatz findet er in dem Seitenmotiv, welches von sanft anschmiegendem und zartem Ausdruck ist. Beide scharf auseinandergehaltenen Themen sind in der Durchführung weiter entwickelt und in wechselreicher Verbindung mit einem dritten, gleichfalls dem ersten Theil entlehnten kurzen Achtelmotiv in kunstvoller und sehr wirksamer Weise zu einem organischen Ganzen verwoben.
Während der Niederschrift dieses Durchführungssatzes wurde der Meister durch eine Fahrt nach Cöln in der Arbeit unterbrochen, so daß es ihm seinen Aeußerungen zufolge Mühe machte, den Faden des Ideenganges befriedigend weiterzuspinnen. Er konnte sich auch mit der betreffenden Stelle, welche unmittelbar auf den Eintritt des Thema's in H-dur folgt, nicht recht befreunden. Allerdings hat man bei derselben die Empfindung, als ob die Gedankenentwickelung hier nicht im vollen Fluß gewesen sei. Da indessen kein Nachtheil für die Gesammtwirkung daraus entsteht, so ist um so weniger Gewicht darauf zu legen, als auch in den Werken anderer großer Meister Fälle vorkommen, welche Bedenken erregen. Es sei nur, um ein Beispiel anzuführen, an die auf S. 77 der neuen Partiturausgabe von Beethoven's. A-dur-Symphonie befindliche Periode hingewiesen, welche sich wie ein modulatorischer Nothbehelf ausnimmt. Die fragliche Stelle in Schumann's Symphonie erscheint dagegen noch immer interessant.
Das zweite als »Scherzo« bezeichnete Stück erinnert Anfangs durch seine gemessene Bewegung an das alte Menuett. Der erste Theil desselben besteht aus der ebenmäßigen Fortsetzung einer melodischen, wechselweise auf- und absteigenden Figur. Diese wird auch im zweiten Theil in verschiedenartiger Wendung festgehalten. Sie ist wuchtig und giebt dem Stück ein kräftig realistisches Gepräge.
Die beiden folgenden Theile dieses Satzes erscheinen im ersten Moment als ein von dem vorhergehenden völlig abweichendes Tonbild.[270] Im Grunde sind sie aber nur eine Variirung des schon Gehörten mit veränderter Modulation. Der in ihnen imitatorisch durchgeführten Figur einigt sich, theilweise wenigstens, sehr wohl das zu Anfang des Scherzo's erklingende melodische Motiv, wie dasselbe denn auch schließlich wieder mit eintritt.
Hierauf folgt das zweitheilige Trio in A-moll – das Scherzo steht in C-dur – mit seinem ganz originellen, auf der Terz lagernden Orgelpunkt. Während der Hauptgedanke den Bläsern zuertheilt ist, wird von den Geigen und Bratschen das unmittelbar vorher contrapunktisch bearbeitete Sechzehntel-Motiv absatzweise fortgeführt. Diese geheimnißvoll wirkenden Tonfolgen haben ein wie im Helldunkel gehaltenes, vielfarbig schillerndes Colorit, und sind gleichmäßig anregend für Phantasie und Gefühl. Einen prächtigen Contrast bildet dazu der plötzlich im glänzendenA-dur eintretende Anfang des Scherzo's mit veränderter Instrumentation, worauf nach acht Takten ein aus den Elementen des Vorhergehenden gebildeter Zwischensatz in überraschender Weise wieder zum ursprünglichen C-dur-Satz zurückführt. Aus diesem ist auch die noch sich anschließende, ziemlich ausgedehnte Coda entwickelt. Das prächtige Stück schließt Diminuendo wie in weiter Ferne verhallend.
Der dritte Satz ergeht sich in gemüthvertiefter Beschaulichkeit. Er ist warm empfunden und bietet in seiner harmonischen, völlig ungetrübten Durchbildung den wohlthuenden Eindruck einer voll befriedigten Gemüthsstimmung. Die meisterhafte Verwendung der hier in engeren Grenzen gehaltenen Orchestermittel, – außer dem Streichquartett und den Holzblasinstrumenten sind nur noch zwei Hörner in Thätigkeit – verleiht dieser träumerisch unsere Sinne umfangenden Musik einen duftig zarten Ton, der wie mild verklärender Mondesglanz auf dem Ganzen ruht.
Mit mystischen Klängen und in hochgehobenem Pathos beginnt das nächste Stück langsamen Tempo's. Es ist jener Satz, welchen Schumann mit besonderer Beziehung auf die zur Cardinalserhebung des Erzbischofs v. Geissel im Cölner Dom veranstaltete Feier schrieb. Die complicirte Anwendung der hier auf mannichfache Art verwertheten contrapunktischen Kunst in Verbindung mit der ergriffenen und durchweg festgehaltenen Stimmung hat etwas dem Kirchenstyl Verwandtes, und trägt wesentlich zu der Erhöhung der feierlich ascetischen Wirkung bei, welche dieses kunstvoll gefügte Tonstück auf den Hörer ausübt.[271]
Auf diese gravitätische, zu ernster Sammlung anregende Musik konnte kaum etwas Anderes folgen, wie das vom Meister gegebene Finale. Das Werk sollte nach Schumann's Intention in froh und fröhlich gestimmter Weise schließen, um der Empfindung eine angemessene Auslösung zu gewähren. Dies ist mit dem letzten Satz vollkommen erreicht, wenn er gedanklich auch vielleicht nicht ganz auf der Höhe der andern Stücke steht. Uebrigens hat er etwas ausgesprochen Festliches und enthält auch, namentlich in der Durchführung, mit Zurückbeziehung auf das vorhergehende Adagio, sehr bemerkenswerthe Details.
In durchaus abweichendem Charakter von den drei ersten Symphonien Schumann's behauptet diese Schöpfung eine ebenso selbstständige als hervorragende Stellung unter des Meisters größeren Werken. Und wenn auch die einzelnen Theile derselben keine so enge Beziehung zu einander erkennen lassen, wie es bei den anderen gleichartigen Gebilden des Meisters der Fall ist, so zeichnet sich doch jedes Stück der Es-dur-Symphonie ebenso sehr durch ungewöhnlichen geistigen Gehalt bei schön beherrschter Form, wie durch sichere, sachgemäße Handhabung des orchestralen Apparates aus.
Mit seinem Concert für Violoncello betrat Schumann ein sehr schwieriges Terrain. Der Wunsch, dieses edle Instrument für Solocompositionen zu verwerthen, ist naheliegend. Denn die ausschließlich für virtuose Zwecke gedachten und bestimmten Arbeiten Romberg's und anderer älterer Fachmänner genügen nicht mehr dem heutigen Kunstgeschmack. Es haben auch schon einzelne begabte Tonsetzer der Neuzeit anerkennenswerthe Versuche gemacht, die ohnehin nicht umfängliche Literatur dieses Instrumentes zu bereichern. Um so begreiflicher erscheint es daher, daß ein so genialer Meister wie Schumann den Drang empfand, gerade hier seine Kraft zu bethätigen. Allein er vermochte ebensowenig wie seine Vorgänger, das Problem eines Violoncelloconcertes vollständig zu lösen.
Die Natur dieses Tonwerkzeuges setzt einer derartigen Aufgabe außerordentliche, wohl kaum jemals ganz zu bewältigende Schwierigkeiten entgegen. Zwar in der Cantilene ist das Violoncello sehr wirksam; allein für das in einem Concertstück gar nicht zu vermeidende Figuren- und Passagenspiel erweist sich die Tonlage desselben zu tief, so daß das Instrument bei einigermaßen symphonischer Behandlung[272] des begleitenden Orchesters nur zu leicht verdeckt wird. Und wo es hinreichend durchdringt, fehlt das für den Concertsaal nicht zu entbehrende Glänzende der Tongebung. Dazu kommt im besonderen Hinblick auf die in Rede stehende Schöpfung Schumann's noch der erschwerende Umstand, daß der Meister nicht so hinreichend mit der Technik des Violoncello's vertraut war, um sachgemäß für dasselbe zu schreiben. So ist es denn erklärlich, wenn die Allegrosätze in diesem Concertstück nicht zu rechter Geltung gelangen können, während das langsame getragene, leider aber nur kurze mittlere Stück eine sehr schöne Wirkung ergiebt. Daß das Werk in rein musikalischer Hinsicht seine anziehenden Seiten hat, ist bei Schumann ganz selbstverständlich.
Die Ouvertüre zur »Braut von Messina« ist als Charakterstück intendirt. Schumann verfolgte dabei vornehmlich den Zweck, den von Schiller in der Tragödie geschilderten Kampf der Parteien musikalisch zu versinnlichen, was auch in dem Anfang und Schluß des Allegro's, sowie in der Durchführung merkbar zum Ausdruck gelangt. Die als zweites Motiv des Gegensatzes halber hingestellte ausdrucksvolle Melodie bezieht sich auf Beatrice.
Dieses Musikstück, welches im Hinblick auf den Gegenstand welchem dasselbe gewidmet ist, natürlich nur in einem sehr ernsten Ton gehalten werden konnte, wurde in kurzer Zeit niedergeschrieben, wie es meist geschah, wenn Schumann einmal mit dem Entwurf einer Composition im Reinen war. Nur die Durchführung bis zum Wiedereintritt des ersten Thema's, machte ihm gerade bei diesem Werk viel Arbeit. Seiner Mittheilung zufolge mußte er sie einigemal umändern, ehe sie ihm befriedigend erschien. Das war etwas Ungewöhnliches bei unserm Meister. Er hatte die Ueberzeugung, daß die ursprünglich gewählte Ausdrucksweise als unmittelbare, Emanation des Geistes auch die beste sei, und kehrte deshalb in manchen Fällen, nachdem er eine Stelle zu verbessern geglaubt hatte, wieder zur ersten Lesart zurück.
Erwähnenswerth dürfte noch sein, daß Schumann bei Niederschrift der Ouvertüre zur »Braut von Messina« beabsichtigte seiner Phantasie freiesten Spielraum zu gönnen, ohne die herkömmliche Form zu berücksichtigen. Er meinte, es habe ihn gereizt einmal den Versuch zu machen, in einem Zuge und unbekümmert um die Tradition fortzuschreiben; bald sei er indessen zu der Ueberzeugung gelangt,[273] daß man doch nichts Rechtes auf diesem Wege zu Stande bringen könne. Dies Beispiel aus den letzten Lebensjahren des Meisters zeigt wiederum, wie tief in seinem Naturell die Neigung zu Neuerungen, auch bezüglich rein formeller Fragen begründet war.
Die Ouvertüre zu Schiller's Drama darf im Uebrigen als ein bemerkenswerthes Beispiel für die Art und Weise gelten, wie Schumann dem von ihm gewählten Stoff tondichterisch beizukommen suchte. Vermag sie sich auch hinsichtlich ihres Kunstwerthes nicht mit den Ouvertüren zu »Manfred« und »Genoveva« zu messen, so ist ihr doch ohne Frage eine höhere Bedeutung zuzuerkennen, wie den weiterhin noch entstandenen gleichartigen Compositionen zu »Julius Caesar« und »Hermann und Dorothea.«
Die dem Jahr 1851 angehörenden Arbeiten sind:
(Januar.) Vom 1.–12. Jan.: Ouvertüre zur Braut von Messina instrumentirt (op. 100). Fünf Lieder für den Mezzosopran von Ullrich, Mörike und Kinkel: (Herzeleid, Fensterscheibe, Gärtner, Volkers Lied, Abendlied)op. 107.108 Januar, vom 23. bis 2. Februar fertig skizzirt und instrumentirt, Ouvertüre zu Shakespeare's »Julius Cäsar« (op. 128).109
März: »Märchenbilder«, vier Stücke für Bratsche und Pianoforte op. 113. – Vier Husarenlieder von Lenau für Bariton und Pianoforte op. 117. ».Frühlingsgrüße« von Lenau. – Noch eines von Lenau.
April bis 11. Mai: »Der Rose Pilgerfahrt« für Soli, Chor mit Begleitung des Pianoforte (24 Nummern)op. 112.110 Vom 12. Mai–1. Juni: Der Königsohn, Ballade von Uhland, für Chor und Orchester (6 Nummern, – die letzte fehlt), op. 116.111 Mädchenlieder für 2 Stimmen, von Elisabeth Kulmann (1.–4) op. 103. – 7 Gedichte von[274] E. Kulmann für eine Stimme op. 104. Brautgesang von Uhland, der Sänger von demselben, für Chor.
Juni 1851. Noch fünf 4händige Stücke zum Kinderball (op. 109). Die Ballade »Königsohn« fertig componirt und instrumentirt.112
August 1851. – Lied von W. Müller.113 – 3 Stücke für Pianoforte allein (Romanzen oder Phantasiestücke)op. 111.
September 1851. – Sonate in A-moll, für Violine und Pianoforte. – op. 105.
»Die Hütte« und »Warnung«, zwei Lieder aus den Waldliedern von Pfarrius op. 119.114
October, vom 2.–9., Trio in G-moll für Pianoforte, Violine und Violoncelle – op. 110.
October, vom 26.–2. November: 2. Sonate (D-moll) für Pianoforte und Violine. – op. 121.
November, vom 7.–27.: »Die Pilgerfahrt der Rose«, für Orchester instrumentirt.
December, 1. und 2.: »Das Scherzo der Symphonie« von N. Burgmüller instrumentirt.115
December, vom 3.–19.: Clavierauszug und neue Instrumentation der älteren Symphonie in D-moll.
December, vom 19.–23.: Ouvertüre zu Goethe's »Hermann und Dorothea« fertig gemacht. (»Diese Ouvertüre schrieb ich mit großer Lust in wenigen [5] Stunden.«) Erschien als op. 136 und Nr. 1. der nachgelassenen Werke in Druck, und wurde zum ersten Mal am 26. Februar 1857 im Leipziger Gewandhause aufgeführt.
Von den vorstehend verzeichneten Compositionen ist zunächst Einiges in Betreff des op. 109 zu bemerken. Das demselben in Schumann's Verzeichniß hinzugefügte Wörtchen »noch« (s. oben) bezieht sich auf vier andere vierhändige bereits vorher componirte[275] Clavierstücke, die von dem Meister für op. 109 bestimmt, jedenfalls aber vergessen worden waren, im Compositionsverzeichniß anzumerken. Ursprünglich wollte Schumann den Cyclus dieser in op. 109 enthaltenen Tonstücke »Kinderball« betiteln. Als er sie nach Vollendung einmal mit seiner Gattin durchspielte, interpretirte er bei der »Préambüle« in scherzhaft-launigem Tone: »Hier fahren noch die Bedienten mit den Schüsseln durch die Gesellschaft.« Weiterhin im Verlaufe der Stücke meinte er dann: »Nach und nach mischen sich die Großen hinein und die Sache wird ernsthafter.« Schließlich mag ihm aber das Ganze für einen »Kinderball« zu ernsthaft gewesen sein, und er wählte den Titel: »Ballscenen.« Uebrigens zeigt sich Schumann's schöpferischer Geist hier im liebenswürdigsten Lichte. Die Idee des »Kinderballes« wurde aber nicht aufgegeben, und nachträglich im Jahre 1853 noch ausgeführt.
Die Composition des von Moritz Horn116 verfaßten Gedichtes »der Rose Pilgerfahrt« war für eine, in kleinerem Rahmen zu fassende und mit bescheideneren Mitteln ausgestattete Tonschöpfung gedacht. Demgemäß wurde ursprünglich nur Clavierbegleitung dazu geschrieben. In dieser Gestalt führte Schumann das Werk kurz nach seiner Entstehung im Privatkreise auf. Er schreibt darüber unterm 9. August 1851 an E. Klitzsch117: Auch eine kleine musikalische Aufführung hatten wir im vorigen Monat. Es ist ein Märchen »der Rose Pilgerfahrt« eines jungen Chemnitzer Poeten, Namens Horn, das ich für Solostimmen, Chor und Pianoforte componirt, in Form und Ausdruck etwas der Peri verwandt, das Ganze nur mehr in's Dörfliche, deutsche gezogen.
Nachdem Schumann das Werk gehört, fand er, um dasselbe größeren Kreisen zugänglich zu machen, es nicht unangemessen, eine Orchesterbegleitung hinzuzufügen, was im November des Entstehungsjahres geschah; die seine, geistreiche Instrumentation ist nur geeignet, den Reiz des Colorits, von dem ein Clavier keine Ahnung geben kann, bedeutend zu erhöhen. Die formelle Beschaffenheit der »Pilgerfahrt der Rose« ist genau so, wie in »Paradies und Peri,« weshalb dasjenige, was bei Gelegenheit des letztgenannten Werkes in dieser[276] Beziehung gesagt wurde, nicht wiederholt werden darf. Im Uebrigen bietet »der Rose Pilgerfahrt« reizende, anmuthige Tonbilder. Man könnte das Werk vielleicht geradezu ein »musikalisches Idyll« nennen, doch ist dabei zu bemerken, daß es im Hinblick auf sein theilweise unkräftiges und empfindsames Wesen an jenes Genre streift, welches man in der Poesie und Novellistik neuerdings als die Lovely-Richtung bezeichnet.
Mit dem »Königsohn« versuchte Schumann seit seiner ersten schöpferischen Periode wiederum, der musikalischen Productivität ein neues Feld zu eröffnen. Er fühlte sich in den überkommenen, »für alle Zeiten gültigen Formen«118 zu Hause, und glaubte nun um so sicherer und mit um so besserem Erfolge sich durchaus auf die eigenen Kräfte stützen zu können. Die Vorläufer zu der von Schumann schließlich aufgenommenen Balladencomposition im Frakturstyl, welche er mit dem »Königsohn« begann, dem auch bald mehrere gleichartige Produkte folgten, könnte man allenfalls in dem »Adventlied« und in dem »Neujahrslied« erblicken, insofern hier wie dort ein in engeren Grenzen gehaltenes dichterisches Genre musikalisch in großem Maaßstabe mit Aufgebot bedeutender Kunstmittel zur Darstellung gebracht ist.
Im »Königsohn« manifestirt sich klar und deutlich von Anfang bis Ende das Streben, neue formelle Gestaltungen im Großen in's Dasein zu rufen. Das Resultat entsprach aber keineswegs der damit verbundenen Idee. Schumann war nicht ganz klar über seine Absicht, ja, die feste Ueberzeugung von der Vortrefflichkeit seines Unternehmens ließ ihn sogar die Einwürfe Anderer zuerst ganz überhören. So konnte es denn nicht fehlen, daß die von Schumann mit dem »Königsohn« eröffneten, ausschließlich für die Concertmusik bestimmten Produktionen, nach formeller Seite hin etwas Unzulängliches haben mußten. In der That fehlt ihnen das einheitlich geschlossene, organisch gegliederte der Form, und zwar nicht irgend einer gegebenen Form, sondern überhaupt einer solchen, die kunstgemäßen Bedingungen entspricht. Dieser Mangel ist in der willkürlichen Vermischung lyrischer und dramatischer Elemente begründet, welche vielleicht hätte umgangen werden können. Im »Königsohn« schließt Schumann sich, bis auf eine Strophe, eng an die Dichtung an, während Alles, was[277] die Einheit eines musikalischen Kunstwerkes in größer organisirter Form aufhebt, zuvor aus derselben hätte entfernt werden müssen. Lediglich die letzte Strophe des Schlußgesanges ist, weil Schumann der Ansicht war, daß sie für den Abschluß eines größeren Musikstückes sich nicht eigne, weggeblieben, und durch eine andere ersetzt.119 Und hier darf man wohl fragen, warum nicht Alles, wie es ursprünglich war, stehen blieb, wenn der Componist im Uebrigen die Dichtung unverändert ließ, – und andererseits wiederum, warum das Ganze nicht durchweg eine passende formelle Umgestaltung erfuhr, wenn überhaupt an der Dichtung gerüttelt, und dieselbe dadurch in ihrem Bestande verletzt wurde. Endlich ist noch die Frage zu berücksichtigen, ob es ästhetisch gerechtfertigt sei, ein dichterisches Genre, wie die Ballade, in größere breitere musikalische Formen auszuspannen, und die umfangreichsten Kunstmittel in Anwendung zu bringen, da es scheint, daß dieses Aufgebot massenhafter Kunstmittel außer allem Verhältniß zu dem knapp und gedrängt gehaltenen Wesen der Ballade steht. In einzelnen Fällen ist auch dieses knappe, gedrängte Wesen musikalisch nachgebildet, während an anderen diesem ganz entgegengesetzt, ein Vers in's Breiteste ausgedehnt und vielfach wiederholt wird, wie z.B. in Nr. 4 und namentlich in Nr. 5 des Königsohnes. Hierin liegen Widersprüche, die selbst bei aller Freude an vielem Schönen und Bedeutenden, weder zu übersehen, noch zu lösen sein dürften. Aehnlich wie mit dem Königsohn, verhält es sich mit den weiterhin noch von Schumann für Chor, Solostimmen und Orchester gesetzten Balladen. Ob in denselben etwa der Keim zu einer neuen fruchtbringenden Richtung enthalten ist, kann nur die Zukunft lehren. Für jetzt hat sich der Versuch Schumann's als nicht durchgreifend erwiesen.
Dem emsigen Schaffen Schumann's sind außer den vorstehend betrachteten Schöpfungen an weiteren bemerkenswerthen Compositionen des Jahres 1851 noch drei Kammermusikwerke, nämlich die beiden Violinsonaten op. 105 und 121, so wie das Claviertrio op. 110 zu verdanken. Dieselben tragen, wie sich nicht verkennen läßt, viel von jenen geistigen Vorzügen an und in sich, durch welche Schumann's Muse den hohen Rang einnimmt. Sie offenbaren reiche Phantasie, Energie der Empfindung und Gedankentiefe. Allein zugleich[278] damit kommt auch eine verdüsterte Stimmung zum Ausdruck, die überwiegend vorherrscht, und nur noch vorübergehend, wie in den beiden langsamen Sätzen der Violinsonaten unterbrochen wird. Auch eine gewisse Gereiztheit blickt ab und zu durch, so stellenweise im ersten, namentlich aber im letzten Satz der A-moll-Sonate. Es ist freilich dabei zu berücksichtigen, daß Schumann während der Composition dieser Sonate mancherlei Verdrießlichkeiten hatte, die ihn um so mehr verstimmten, je empfänglicher er infolge seiner schon mehr oder weniger hervortretenden körperlichen Indisposition für dergleichen Eindrücke geworden war. Daß davon etwas in seine damaligen Compositionen übergegangen ist, darf kaum befremden.
Wenige Wochen nach Entstehung der A-moll-Sonate äußerte Schumann lächelnd in seiner gutherzigen Weise: »die erste Violinsonate hat mir nicht gefallen; da habe ich denn noch eine zweite gemacht, die hoffentlich besser gerathen ist,« und mit diesen Worten brachte er seine D-moll-Sonate (op. 121) zum Vorschein, – ein in gewisser Hinsicht ohne Frage sehr bedeutendes Musikstück. Mancher dürfte auch dieses Werk allzu düster finden, aber sicher ist doch, daß jeder Takt den geistigen Adel und die Hoheit des Sinnes seines Urhebers verkündet. Das liebliche und unschuldvoll reizende, wie ein Rückblick in die Jugendzeit sich ausnehmende Andante bildet einen wohlthuenden Lichtblick in der Reihe der vier Sätze.
Auch das G-moll-Trio für Pianoforte, Violine und Violoncello hat ein bedeutendes Gepräge, obwohl es den Gedankenschwung des D-moll-Trio's nicht wieder erreicht, ausgenommen vielleicht das Scherzo, welches die Empfindung des Hörers mit sich fortreißt. Sonsthin ist nicht zu verkennen, daß dieser Schöpfung ein etwas grüblerisch, melancholischer Zug innewohnt, von dem der Meister sich im letzten Satz auf eine, an seine guten Tage erinnernde humoristische Weise zu befreien sucht.
Als Arbeiten des Jahres 1852 nennt das Compositionsverzeichniß:
Januar vom 1.–6. Die Ballade: »des Sängers Fluch für Soli, Chor und Orchester skizzirt.« (Erschienen als op. 130 und Nr. 4 der nachgelassenen Werke). Zum 1. Mal beim Aachner Musikfest 1857 aufgeführt.
»Januar vom 10.–19. Die Ballade von Uhland instrumentirt.«
»Februar, vom 13.–22.: lateinische Messe (in C) skizzirt« (op. 147 Nr. 10 der nachgelassenen Werke). Vom 24. Februar bis 5. März,[279] dann vom 24.–30. März die Messe instrumentirt und den Clavierauszug gemacht.
April. Vom 26. April bis 8. Mai ein lateinisches Requiem skizzirt (op. 148, Nr. 11. der nachgelassenen Werke).
Mai. Vom 9. bis 15. Instrumentation der doppelchörigen Motette »Verzweifle nicht« für Orchester (comp. 1849). Vom 16. bis 23. Instrumentation des ganzen Requiems.
Juni. Vom 18.–22. Die vier Balladen »vom Pagen und der Königstochter« skizzirt (op. 140, Nr. 5 der nachgelassenen Werke)120.
»Die Flüchtlinge« von Shelley, für Deklamation mit Begleitung des Pianoforte121.
Juli. Vom 28. bis zum 12. September. Instrumentation und Clavierauszug der Ballade, »Page und Königstochter«. (Das Arrangement der ersten Ballade ist von Clara.)
October und November: Clavierauszüge von »Sängers Fluch«, Requiem, und zweite Abtheilung der Faust-Scenen.
December. Vom 9.–16. 5 Lieder »der Königin Maria Stuart« für Mezzosopran mit Pianoforte op. 135. Clavierauszug der Symphonie in D-moll.
Für das Jahr 1853 ist in Schumann's Notizbuch verzeichnet:
1853 Januar: Harmonisirung der 6 Sonaten für Violine von J. S. Bach.
Februar, vom 27.–12. März: Skizzirung und Instrumentation der Ballade »das Glück von Edenhall« für Männerchor, Solostimmen mit Orchester (op. 143, Nr. 8 der nachgelassenen Werke)122.
März. Vom 15.–19. April: Clavierauszug von »Edenhall« und Harmonisirung der 6 Sonaten für Violoncell von J. S. Bach. (Noch nicht veröffentlicht.)
April, 15.–19. Festouvertüre mit Gesang über das Rheinweinlied für Orchester op. 123123 (den Anfang schon im Sommer 1852 entworfen). Den 20.–24., 2händiges Clavierarrangement der Ouvertüre, Scherzo und Finale (op. 52).
[280] Mai. Vom 28.–9. Juni: 7 Fughetten für Pianoforte,op. 126.
Juni. Vom 11.–24. Kinderscenen für Pianoforte inG-dur – 2 leichte Sonaten für die Jugend für Pianoforte (in D-dur und C-dur) op. 118.
August: vom 4.–11. 2händiges Arrangement der Streichquartette Nr. 1 und 2 (op. 41). Vom 13 – 15. Ouvertüre zu Faust skizzirt; den 16. und 17. instrumentirt. – Den 20.: Geburtstagslied für Clara für 4 Stimmen. (Unveröffentlicht.) – Vom 24.–30.: Concertallegro mit Einleitung für Pianoforte, mit Orchester op. 134.
September, den 2.–5.: Phantasie für Violine mit Orchester skizzirt, (op. 131). Den 6. und 7. instrumentirt124. – Den 15: Ballade vom Haideknaben von Hebbel für Deklamation mit Begleitung des Pianoforte. (Ist mit inop. 122 enthalten.) Vom 18.–20.: »Kinderball«, 6 vierhändige Clavierstücke (die Menuett schon 1850). –op. 130125.
Außer diesen Compositionen entstanden, so viel bekannt geworden, noch weiter: »Mährchenerzählun gen,« 4 Stücke für Clavier, Clarinette und Bratsche,op. 132; ein Conzert für Violine mit Orchesterbegleitung, welches noch nicht veröffentlicht ist; ein Heft Romanzen für Violoncello und Pianoforte, ebenfalls noch nicht veröffentlicht, und die »Gesänge der Frühe« op. 133. Ein Heft dreistimmiger Lieder für Frauenstimmen (op. 114), welches Anfangs 1853 entstand, ist in Schumann's Compositionsverzeichniß nicht aufgeführt.
So lebhaft in der ersten Hälfte des Jahres 1852, in die eine Reise nach Leipzig (vom 6.–23. März) fällt, der Anlauf zum Produciren war, so matt sieht die zweite Hälfte desselben in dieser Hinsicht aus; fast nur Arrangements sind es, mit denen Schumann sich da beschäftigte. Dieser Umstand war begründet in schärfer hervortretenden körperlichen Leiden, die als Fortsetzung der Dresdner Krankheitszufälle und als unmittelbare Vorläufer der zu Anfang 1854 sich ereignenden traurigen Katastrophe zu betrachten sind. Denn auch die noch ins Jahr 1853 fallenden Arbeiten lassen erkennnen, daß Schumann's übles Befinden sich im Wesentlichen nicht wieder verbessert hatte. Im Hinblick hierauf bleibt es zu bewundern, daß[281] Schumann noch immer einige Werke von bedeutenderem Umfang, wie die Messe, das Requiem, die Balladen »Vom Pagen und der Königstochter«, und »das Glück von Edenhall«, sowie die Ouvertüren zum »Rheinweinlied« und zum »Faust« zu schaffen vermochte. Freilich zeigen dieselben neben manchem hervorragenden Zug und trotz so mancher einzelnen Schönheiten schon ein Schwinden der Gestaltungskraft, überhaupt eine geistige Ermattung. Die Pietät vor dem hohen Genius des Meisters gebietet, von einer näheren Prüfung aller damaligen, schon in die Zeit des stärker entwickelten krankhaften Zustandes fallenden Compositionen abzusehen. Warum sollten wir auch das hehre Bild, welches wir von dem verklärten Meister in uns tragen, durch eine kritisch eingehende Betrachtung dieser nicht mehr auf der Höhe seiner früheren Produktivität stehenden Schöpfungen trüben? Halten wir uns lieber in Dankbarkeit alle die schönen, edeln und erhebenden Genüsse gegenwärtig, die er gespendet, und stehen wir in freudig hingebender Einmüthigkeit für das reiche künstlerische Erbe ein, welches er uns hinterlassen hat.
Ueberschauen wir Schumann's Werke in ihrer Gesammtheit, so ergiebt sich, daß er durch einen Theil derselben die Tonkunst nach verschiedenen Seiten hin in selbstständiger und durchaus eigenthümlicher Weise bereichert und gefördert hat. Vermöge seines originellen Denkens und Empfindens war es ihm gegeben, das reiche ihn erfüllende Gemüthsleben in schärfster individueller Ausprägung musikalisch zum Ausdruck zu bringen, wenn es auch nicht immer in einfachster und unmittelbar verständlicher Weise geschah.
Wir haben gesehen, wie unser Meister sich schon frühzeitig von dem unwiderstehlichen Trieb beseelt zeigte, Neues zu gestalten, ohne den Stoff formell schon zu beherrschen, und wie er dann auch literarisch für das von ihm tonkünstlerisch Erstrebte eintrat. Wenn dieses praktisch und theoretisch gleichzeitig bethätigte Wirken sich auch bis zu einem gewissen Grade gegenseitig ergänzte, so war dasselbe doch unverkennbar auch wiederum hemmend für ein unbefangenes und ungestörtes freies Kunstschaffen. Schumann empfand dies im Laufe der Zeit immer deutlicher, und beseitigte endlich das angedeutete Dilemma durch den Rücktritt von der langjährigen Leitung seiner Musikzeitung, um sich ausschließlich seinem eigentlichen Berufe, der Composition, hingeben zu können.
Durch sein rastloses Streben hatte Schumann sich inzwischen[282] musikalisch so weit gefördert, daß er mit künstlerischer Einsicht und Beherrschung zu schaffen vermochte. Von diesem Augenblicke an gewannen seine Geisteserzeugnisse einen rellen Werth und eine positive Bedeutung. Die rühmlich erstrebte und allmählig, wenn auch unter großen Mühen erlangte Meisterschaft zeigt sich zuerst in dem, Schumann eigenthümlich angehörenden Phantasiestück, so wie in den liedformartigen Instrumentalsätzen, wie sie uns z.B. in den Kinderscenen entgegentreten. Die eigenthümlichen, für unsern Meister so charakteristischen harmonisch modulatorischen und rhythmischen Gestaltungen stehen hier nicht mehr, wie noch vielfach in seinen ersten Arbeiten, so zu sagen, um ihrer selbst willen da, sondern einigen sich mit den oft eigenartig reizvollen Melodiebildungen der tondichterischen Idee des Ganzen schon so vollkommen, daß Inhalt und Form einander decken. In der Mehrzahl der Liedercompositionen des Jahres 1840 wiederholt sich diese Erscheinung.
Mit allen diesen, dem kleineren Genre angehörenden Schöpfungen gab unser Meister bedeutsame künstlerische Impulse, deren Tragweite gegenwärtig noch nicht völlig zu ermessen sein dürfte.
Nachdem Schumann in den kleineren Formen Herrschaft, und damit die Fähigkeit erlangt hatte, sein Inneres mit der im künstlerischen Gesetze wurzelnden Freiheit austönen zu lassen, war der Zeitpunkt gekommen, sich auch der größeren, complicirteren, auf dem Sonatensatz basirenden Instrumentalformen zu bemächtigen. Mit welch' günstigem Erfolg es geschah, und wie er diese Formen mit neuem Gehalt zu erfüllen wußte, ist in der vorhergehenden Darstellung näher erläutert. Schumann hat hier Leistungen von bleibendem Kunstwerth hingestellt, durch die er zugleich den Beweis lieferte, daß die historisch überkommenen Kunstformen sich keineswegs schon überlebt haben, so wie, daß man bei ihrer Benutzung durchaus originell sein kann, wenn man nur etwas Wirkliches, Tüchtiges und Besonderes auszusprechen hat.
Daß Schumann durch die vorstehend erwähnten Werke anregend und einflußreich für die neuere Entwickelung der Tonkunst geworden ist, steht fest, ebenso wie auch kein Zweifel darüber obwaltet, daß die, den beiden letzten Jahren der Thätigkeit des Meisters angehörenden Schöpfungen nicht eine gleiche Geltung beanspruchen können. Der Grund hiervon ist, ganz abgesehen von den erfolglosen Versuchen, neugestaltend auch in größeren Formen zu wirken,[283] in dem schärferen Hervortreten seiner körperlichen Leiden zu suchen, wie schon bemerkt wurde.
Besorgnißerregende Anzeichen der schrecklichen Krankheit, welcher Schumann schließlich in beklagenswerther Weise zum Opfer fiel, zeigten sich schon im Jahr 1851. Damals schrieb der Meister126: »Sonst sind mir alle leidlich wohl, ich nur manchmal von nervösen Leiden afficirt, die mich manchmal besorgt machen; so neulich nach Radecke's127 Orgelspiel, daß ich beinahe ohnmächtig wurde.« Diese »nervösen Leiden« traten im Jahre 1852 verstärkt auf, und waren von eigenthümlichen Erscheinungen begleitet. Zu denselben gehörte vor Allem seine schon vorher, aber doch nicht in so hohem Grade bemerkbar gewesene, schwerfällige Sprache. Dann auch war es höchst auffallend, daß Schumann beim Hören von Musik alle Tempi zu schnell erschienen und daß er häufig geradezu langsamere verlangte und danach auch bei seinen Musikaufführungen verfuhr, offenbar, weil er nicht mehr im Stande war, einer lebhaften Bewegung zu folgen. Seine körperliche Haltung hatte etwas gedrücktes, und im Verkehr mit Anderen war trotz aller kundgegebenen Freundlichkeit eine gewisse Apathie herauszufühlen. Bei dem an den vier ersten Tagen des August 1852 stattgehabten großen Männergesangfest zu Düsseldorf betheiligte er sich, obgleich er zum Mitdirigenten gewählt worden war, nur mäßig, und die Erschöpfung der geistigen und physischen Kräfte, namentlich bei den wenigen von ihm geleiteten Piecen war unverkennbar.
Um seinen krankhaften Zustand zu mildern, brauchte Schumann damals ärztlicher Verordnung zufolge kalte Rheinbäder: auch ging er auf Anrathen seines Arztes nach Scheveningen zur Badekur, von der er Ende September heimkehrte. Sein Befinden erlaubte ihm aber nicht, sogleich den amtlichen Funktionen sich zu unterziehen, weshalb die Leitung der ersten beiden Winterconcerte auf seinen Wunsch von Julius Tausch übernommen wurde. Endlich erholte er sich wieder so weit, und zwar zum letzten Mal in seinem Leben, daß er sich auf's Neue, freilich mit immer mehr schwindenden Kräften, seinem Berufe zu widmen vermochte. So dirigirte er, wie gewöhnlich, die Abonnementsconcerte[284] vom dritten ab, und ließ es, wie wir schon gesehen haben, auch während des Jahres 1853 an einer Menge schriftlicher Arbeiten nicht fehlen.
Die bedenklichen, im Jahre 1852 mehrfach hervorgetretenen Symptome zeigten sich nicht allein wiederum im Jahre 1853, sondern es kamen auch neue hinzu. Zunächst war es das sogenannte »Tischrücken«, welches Schumann in vollständige Ekstase versetzte und seine Sinne gefangen nahm. Das Tischrücken hat zu jener Zeit, wo es die Runde durch die Boudoir's und Theegesellschaften nervöser Damen, ja, durch die Studirzimmer sonsthin ernster Männer machte, allerdings auch manchen besonnenen Kopf irritirt; doch unterscheiden sich diese Vorkommnisse durchaus von der krankhaften Exaltation, welche Schumann damals ergriffen hatte. Als ich im Mai 1853 mich besuchsweise in Düsseldorf aufhielt und eines Nachmittags in Schumann's Zimmer eintrat, lag er auf dem Sopha und las in einem Buche. Auf mein Befragen, was der Inhalt des letzteren sei, erwiderte er mit gehobener, feierlicher Stimme: »Oh! wissen Sie noch nichts vom Tischrücken?« Wohl! sagte ich in scherzendem Tone. Hierauf öffneten sich weit seine für gewöhnlich halb geschlossenen in sich hineinblickenden Augen, die Pupille dehnte sich krampfhaft auseinander und mit eigenthümlich geisterhaftem Ausdrucke sagte er unheimlich und langsam: »Die Tische wissen Alles.« Als ich diesen drohenden Ernst sah, ging ich, um ihn nicht zu reizen, auf seine Meinung ein, in Folge dessen er sich wieder beruhigte. Dann rief er seine zweite Tochter herbei und fing an mit ihr und einem kleinen Tische zu experimentiren, wobei er den letzteren auch den Anfang der C-moll-Symphonie von Beethoven markiren ließ. Die ganze Scene hatte mich aber auf's Aeußerste erschreckt, und ich erinnere mich genau, daß ich meine Besorgnisse damals sogleich gegen Bekannte äußerte. An Ferd. Hiller schrieb er über seine Experimente 25. April 1853128: »Wir haben gestern zum ersten Mal Tisch gerückt. Eine wunderbare Kraft! Denke Dir, ich fragte ihn, wie der Rhythmus der 2 ersten Takte der C-moll-Symphonie wäre! Er zauderte mit der Antwort länger als gewöhnlich – endlich fing er an:  – aber erst etwas langsam. Wie ich ihm aber sagte: ›aber das Tempo ist schneller, lieber Tisch«, beeilte er sich, das richtige Tempo anzuschlagen.[285] Auch frug ich ihn, ob er mir die Zahl angeben könne, die ich mir dächte; er gab richtig drei an. Wir waren alle wie von Wundern umgeben.‹ Und desgleichen unter dem 29. April129: »Unsere magnetischen Experimente haben wir wiederholt. Es ist als wäre man von Wundern umgeben.«
– aber erst etwas langsam. Wie ich ihm aber sagte: ›aber das Tempo ist schneller, lieber Tisch«, beeilte er sich, das richtige Tempo anzuschlagen.[285] Auch frug ich ihn, ob er mir die Zahl angeben könne, die ich mir dächte; er gab richtig drei an. Wir waren alle wie von Wundern umgeben.‹ Und desgleichen unter dem 29. April129: »Unsere magnetischen Experimente haben wir wiederholt. Es ist als wäre man von Wundern umgeben.«
Dann auch stellten sich zeitweilig Gehörstäuschungen ein, derart, daß Schumann einen Ton unausgesetzt zu hören glaubte, und auch in nervöser Erregung wirklich hörte, obschon in der ganzen Umgebung nichts, was einem Tone hätte ähnlich sein können, wahrzunehmen war. Der Violinist Ruppert Becker in Frankfurt a/M., welcher damals in Düsseldorf lebte, berichtete mir, daß er eines Abends mit Schumann zusammen in einem Bierlocale gewesen sei. Plötzlich habe Schumann die Zeitung weggelegt und gesagt: »ich kann nicht mehr lesen: ich höre fortwährend A.«
Nichtsdestoweniger gab man sich der Hoffnung hin, daß es sich hier um vorübergehende Erscheinungen handele. Daß Schumann sich fortwährend in leidendem Zustand befand, ist aus einem im Juli 1853 geschriebenen Briefe130 ersichtlich, in welchem es heißt: »Auch ich fühle mich noch nicht in meiner vollen Kraft und muß noch alle anstrengende größere Arbeiten meiden.« Bei dem 1853 in Düsseldorf stattgehabten Musikfeste vermochte er sich auch nur insofern zu betheiligen, als er die Direction des ersten Festconcertes (in welchem er noch einen entschiedenen Triumph mit seiner D-moll-Symphonie feierte), und die Leitung zweier Nummern am dritten Festtage übernahm, was aber unter großer Anstrengung geschah. Daß dieses Arrangement von ihm selbst ausging, bestätigen zwei Briefe an F. Hiller131, in denen er den letzteren um Uebernahme der anderweitigen Direction des Festes bittet.
Als Schumann Ende Juli 1853 besuchsweise in Bonn anwesend war, überfiel ihn eines Morgens nach dem Aufstehen plötzlich ein Zustand, der ihn glauben machte, daß er von einem Nervenschlag befallen sei. Er legte sich wieder zu Bett, und nur mit der größten Mühe konnte ihn der schnell hinzugerufene Arzt, Dr. Kalt, dazu bewegen, aufzustehen, und jenen Glauben fahren zu lassen. Der genannte[286] Arzt sprach damals sehr entschiedene Befürchtungen über Schumann's Zukunft aus.
Der Schluß des Jahres 1853 brachte für Schumann noch zwei freudige Ereignisse, – die letzten, welche er überhaupt erlebte. Das eine derselben fällt in den Monat October, und betrifft die Begegnung mit Johannes Brahms, den er selbst noch durch ein enthusiastisches Bekenntniß in den Spalten seiner ehemaligen Zeitung132 der musikalischen Welt als jenen Meister zuführte, welcher »den höchsten Ausdruck der Zeit in idealer Weise auszusprechen berufen sei«; das andere war eine im November mit seiner Gattin nach Holland unternommene Kunstreise, die einem Triumphzuge glich. »Wir hatten eine Musikfahrt nach den Niederlanden unternommen, die vom Anfang bis zum Schluß von guten Glücksgenien begleitet war. In allen Städten wurden wir mit Freuden, ja mit vielen Ehren bewillkommnet. Ich habe zu meiner Verwunderung gesehen, wie meine Musik in Holland beinahe heimischer ist, als im Vaterland. Ueberall waren große Aufführungen der Symphonieen, gerade der schwierigsten, der 2. und 3., im Haag auch mir die Rose vorbereitet«, schreibt er an Strackerjan133.
Die »Signale für die musikalische Welt« berichten über diese Reise in Nr. 51 des elften Jahrganges: »Robert Schumann und seine Gattin feiern große Triumphe in Holland, in Utrecht wurde er wiederholt nach Aufführung einiger seiner Compositionen gerufen und mit Kränzen überschüttet.« Und in Nr. 52: »Robert Schumann und seine geniale Gattin sind hier (in Amsterdam) wie in anderen Hauptstädten Hollands mit Enthusiasmus aufgenommen worden, noch niemals habe ich Clara Schumann so schön spielen hören, als hier in Holland. Schumann fand überall die Concerte vorbereitet und brauchte sich nur an das Pult zu stellen, um zu dirigiren. In Rotterdam und Utrecht kam seine dritte Symphonie zur Aufführung, in Amsterdam und im Haag die zweite, auch ›der Rose Pilgerfahrt‹ im Haag. Das holländische Publikum, dessen Bildung im Ganzen dem Besten zugewendet ist, und das neben den alten Meistern auch die neuen kennt und ehrt, hat das Künstlerpaar überall mit Freude bewillkommnet und mit Ehren überhäuft.«[287]
Am 22. December traf Schumann von der holländischen Reise wieder in Düsseldorf ein. Bald sollte sich in beklagenswerther Weise jenes schreckliche Ereigniß erfüllen, welches ihn der Kunst und der Welt für immer entriß. Mit Ausnahme eines kleinen Ausfluges nach Hannover lebte Schumann während der Monate Januar und Februar 1854 im Kreise seiner Familie durchaus zurückgezogen. Neben der Redaction seiner »gesammelten Schriften,« welche er eben zum Druck vorbereitete, beschäftigte ihn hauptsächlich eine literarische Arbeit, welche er »Dichtergarten« benannte. Die Idee dazu, nach welcher es galt, möglichst Alles, was von der ältesten bis auf die neueste Zeit in den Werken namhafter Dichter gelegentlich über Musik sich findet, zusammenzustellen, hatte Schumann bereits in früheren Jahren gefaßt, und zu dem Zweck die Shakespeare'schen und Jean Paulschen Schriften excerpirt. Jetzt stand er im Begriff, dasselbe noch in Bezug auf die Bibel, so wie der griechischen und lateinischen Classiker zu thun. Dies mochte insofern für ihn um so anstrengender gewesen sein, als er seit seiner Schul- und Studienzeit die todten Sprachen gänzlich vernachlässigt hatte. Aber er sollte die Arbeit nicht mehr vollenden, denn mitten in derselben traten die, in den vorhergehenden Jahren schon bemerkbar gewordenen krankhaften Erscheinungen nicht nur mit erneuerter Heftigkeit auf, sondern steigerten sich auch schnell bis zu einem solchem Grade, daß jener unheilvolle, geistesumnachtete Zustand, von dem Schumann nicht wieder genaß, alsbald die Oberhand gewann.
Zunächst zeigten sich die Gehörstäuschungen wieder. Schumann glaubte einen Ton zu hören, der ihn unablässig verfolgte, und aus dem sich allmählig Harmonien, ja ganze Tonstücke entwickelten. Endlich traten auch Geisterstimmen hinzu, die bald in versöhnendem, bald in verfolgendem, vorwurfsvollem Tone ihm Zuflüsterungen machten und ihm während der letzten vierzehn Tage seiner leidensvollen Düsseldorfer Existenz selbst die Nachtruhe raubten. Eines Nachts verließ er plötzlich seine Ruhestätte und forderte Licht, indem er äußerte, daß Fr. Schubert und Mendelssohn ihm ein Thema gesandt hätten, welches er sogleich aufschreiben müsse, was denn auch trotz aller Gegenvorstellungen seiner Gattin geschah. Ueber dieses Thema componirte er noch während des Ausbruchs seiner Krankheit fünf Variationen für Pianoforte. Es war seine letzte Arbeit.
Unter den Gedanken, die ihn beschäftigten, war auch der, in[288] eine Heilanstalt zu gehen, um sich der Pflege eines Arztes gänzlich zu übergeben, denn »zu Hause könne er nicht wieder genesen,« wie er mit Ueberzeugung aussprach. In einem solchen Augenblicke verlangte er einen Wagen, ordnete seine Papiere, seine Compositionen, und machte sich zum Abschied fertig. Er fühlte seinen Zustand klar, und namentlich, wenn heftig aufgeregte Momente herankamen, bat er, ihm fern zu bleiben. Seine Gattin bot Alles auf, durch Zureden die Trug- und Wahnbilder, welche in Schumann's erhitzter Phantasie unaufhörlich sich kreuzten, zu verscheuchen. Kaum war dies aber gelungen, so stellte sich im nächsten Augenblick ein neues Phantom seinen wirren Sinnen dar. Zu wiederholten Malen äußerte er auch, daß er ein Sünder sei, und die Liebe der Menschen nicht verdiene. In dieser Weise häuften sich die Leiden des unglücklichen Meisters, bis nach vierzehn Tagen der geistige Widerstand, welchen Schumann momentan noch seinem Zustande entgegenzusetzen gewußt hatte, endlich unterlag, und die innere Angst ihn zu einem Schritt der Verzweiflung trieb.
Es war am Fastnachtsmontag, den 27. Februar 1854, als Schumann in der Mittagsstunde den Besuch seines Arztes, des Sanitätsraths Dr. Hasenclever, so wie des Kunstgenossen Albert Dietrich empfing. Man setzte sich gemeinschaftlich. Während des Gespräches, das aufgenommen worden, verließ Schumann, ohne ein Wort zu sagen, das Zimmer. Man glaubte, er werde zurückkehren, und als dies nach einem gewissen Zeitraume nicht geschehen war, entfernte seine Gattin sich, um nach ihm zu sehen. Er war im Hause nicht zu finden. Die anwesenden Freunde eilten sofort auf die Straße, um den Vermißten zu suchen, – vergeblich! Er war im Negligée und ohne Kopfbedeckung in aller Stille aus dem Hause nach der Rheinbrücke gegangen, und hatte durch einen Sturz von derselben in den Strom seinem qualvollen Zustande ein Ende zu machen versucht. Die anwesenden, in einem Kahne ihm sogleich nacheilenden Schifferknechte zogen ihn wieder aus den Fluthen. Sein Leben war gerettet, aber welch ein trostloses?! Vorübergehende erkannten den unglücklichen Meister, so daß er nach seiner Behausung getragen werden konnte. Seine Gattin, die der größten Schonung bedurfte, ließ sich durch Zureden verhindern, ihn in seinem traurigen, beklagenswerthen Zustande zu sehen. Ein zweiter Arzt wurde zu Hilfe gerufen, denn inzwischen trat ein Paroxismus ein, der mit herabgestimmten[289] Zuständen wechselte, Schumann mußte fortwährend bewacht werden.
Die Aerzte erkannten die dringliche Nothwendigkeit, den Kranken in andere Umgebungen zu bringen, überhaupt ihm unausgesetzte Beaufsichtigung und Pflege angedeihen zu lassen, und so wurde im Einverständniß mit seiner Gattin beschlossen, ihn der Privatheilanstalt des Dr. Richarz in Endenich bei Bonn zu übergeben. Dr. Hasenclever übernahm es in treuer, freundschaftlicher Hingebung, diesen Beschluß auszuführen, und geleitete unter Hinzuziehung zweier Wärter den Patienten in einem Wagen am Morgen des 4. März nach seinem Bestimmungsorte, den man am Abend desselben Tages erreichte. Hier war Schumann's Bleiben bis Ende Juli 1856.
Es scheint nicht angemessen, das traurige Bild von Schumann's Krankheit durch Anführung von Specialitäten zu vervollständigen. Nur eine dahin gehörige Mittheilung will ich mir an dieser Stelle noch erlauben. Ehe ich im Sommer 1855 Bonn verließ, ging ich in Begleitung meines gerade besuchsweise anwesenden Freundes Otto v. Königslöw noch einmal nach Endenich, um mich nach dem Befinden des verehrten Meisters zu erkundigen, wie ich es vorher schon häufig gethan hatte. Schumann saß gerade am Clavier, welches man ihm auf seinen Wunsch hatte hinstellen lassen, und phantasirte. Wir konnten ihn lange und ungestört durch eine Oeffnung in der Thür beobachten. Da war es denn herzzerschneidend, den edlen, großen Mann in voller Gebrochenheit seiner geistigen und physischen Kräfte sehen zu müssen, jenen Meister, dem die Kunst so vieles Schöne verdankt, der in unablässigem Eifer dem Höchsten sein stilles, aber thatenreiches Leben gewidmet hatte. Das Spiel war ungenießbar. Es machte den Eindruck, als ob die Kraft, von welcher es ausging, vollständig gelähmt war, gleich einer Maschine, deren Mechanismus zerstört, nur noch in unwillkürlichen Zuckungen fortzuarbeiten versucht.
Während seines Aufenthaltes in der Endenicher Heilanstalt empfing Schumann mit der Zustimmung des Arztes die Besuche von Bettina Arnim, Joachim und Brahm's, welche aber, da jedesmal ein Zustand großer Aufgeregtheit folgte, weiterhin vermieden werden mußten. Mit seiner Gattin pflog er eine Zeitlang einen Briefwechsel, – sie sah ihn nicht eher wieder, als im Momente des Scheidens[290] von dieser Erde, welches am 29. Juli 1856, Nachmittags 4 Uhr, erfolgte, da dann der Todesengel sein müdes Haupt berührte.
Die sterbliche Hülle des verewigten Meisters wurde am 31. Juli nach Bonn gebracht, von dort aus durch die Stadt unter dem Zuströmen des Volkes, welches fühlen mochte, daß es einem ungewöhnlichen Todten gelte, nach dem vor'm Sternenthor befindlichen Friedhof geleitet, und hier unter priesterlicher Einsegnung in's Grab gesenkt.
Bald darauf regte ein Bonner Verehrer des großen Tondichters die schöne Idee an, auf der Ruhestätte R. Schumann's ein Denkmal zu errichten. Lange Zeit verging indessen, ohne daß sich eine gegründete Aussicht zur Verwirklichung dieses Gedankens eröffnet hätte. Da wurde endlich im Jahr 1872 unter Zustimmung von Schumann's Gattin der Plan gefaßt, eine musikalische Gedächtnißfeier des Meisters nach Art der im Jahr 1871 zu Bonn begangenen Säcularfeier Beethoven's zu veranstalten, und uns deren Erträgen das beabsichtigte Monument zu beschaffen. Infolge dessen fand 1873 in den Tagen des 17., 18. und 19. August zu Bonn in Gegenwart zahlreicher, aus allen deutschen Gauen und sogar aus dem Auslande herzugekommener Freunde und Verehrer der Schumann'schen Tonmuse, eine »Schumannfeier« statt, die ebenso erhebend, wie herzerfreuend war. Bei derselben gelangten ausschließlich Werke des Meisters zur Aufführung.
Es wurden am ersten der drei genannten Tage: dieD-moll-Symphonie und »Paradies und Peri«, und am zweiten: Ouvertüre zu »Manfred,« Concert (A-moll) für Pianoforte, »Nachtlied« für Chor und Orchester, Symphonie (N. II, C-dur) und die dritte Abtheilung der Scenen aus Goethe's »Faust« zur Darstellung gebracht. In der am dritten Tage veranstalteten Matinée für Kammermusik kamen zu Gehör: das Streichquartett (op. 40, N. 3), die Variationen für zwei Pianoforte (op. 46), das Clavierquintett (op. 44) und folgende Lieder: »Stille Thränen,« »Aufträge,« der »Spielmann,« »Wanderlied,« »Wehmuth,« »Sonntags am Rhein,« so wie die Ballade »die Löwenbraut«.
Die artistische Leitung der Aufführungen an den ersten beiden Tagen befand sich in den Händen Jos. Joachim's und des Verfassers dieser Blätter.
Unter den ausübenden Künstlern, welche durch ihre werthvolle[291] Unterstützung die selten schöne Feier mit zu verherrlichen bestrebt waren, verlieh vor Allem Clara Schumann, die Gattin des verklärten Meisters, dem Feste einen besonders bedeutungsvollen Schmuck, was denn auch in vollkommener Würdigung Seiten des zahlreich anwesenden Publikums zu einer ergreifenden Ovation für die edle Frau Veranlassung gab. Als Gesangssolisten waren dabei thätig: die Damen Marie Wilt, Marie Sartorius und Amalie Joachim, so wie die Herren Franz Diener, Julius Stockhausen und Adolph Schulze. Die Herren Ludwig Straus und Otto v. Königslöw fungirten als Conzertmeister an der Spitze des mit größter Sorgsamkeit ausgewählten Orchesters, welches im Ganzen 111 Mitwirkende zählte. Der Chor, durch die besten Gesangskräfte der Nachbarstädte verstärkt, bestand aus nahe an 400 Personen.
Bei der Matinée für Kammermusik waren außer den schon genannten ausübenden künstlerischen Kräften noch mitwirkend thätig: Jos. Joachim und die Herren Lindner und Müller (die beiden letzteren alternirend beim Violoncello), so wie Herr Rudorf (Pianoforte).
Der materielle Erfolg dieser drei Aufführungen ergab einen bedeutenden Fond, welcher nicht allein durch den reichen Ertrag eines, weiterhin zu Bonn noch veranstalteten, und von J. Joachim in uneigennützigster Weise unterstützten Conzertes, sondern auch durch namhafte Beiträge der Herren J. Stockhausen und Baron Senfft v. Pillsach vervollständigt wurde. Inzwischen war A. Donndorf, ehedem in Dresden, jetzt in Stuttgart, mit der Ausführung des Denkmales beauftragt worden, und heute erhebt sich auf dem Grabe des Meisters ein seiner würdiges Monument mit der Inschrift:
Dem grossen Tondichter
von seinen Freunden und Verehrern errichtet
am 2. Mai 1880.[292]
Robert Schumann war von stattlicher und fast großer Statur. Seine Körperhaltung hatte in gesunden Tagen etwas Gehobenes, Vornehmes, Ruhe- und Würdevolles, wogegen sein Gang gewöhnlich langsam, leise auftretend, und ein wenig bequem hinschlotternd war. Im Hause trug er gewöhnlich Filzschuhe. Nicht selten ging er in seinem Zimmer ohne alle äußere Veranlassung auf den Fußspitzen134. Das Auge war meist gesenkt, halb geschlossen, und belebte sich nur im Verkehr mit Näherbefreundeten, dann aber in wohlthuendster Weise. Die Gesichtsbildung machte im Ganzen einen angenehmen Eindruck. Der sein geschnittene Mund, meist etwas vorgeschoben, und wie zum Pfeifen, zugespitzt, war nächst dem Auge die anziehendste Partie seines vollen, runden, ziemlich lebhaft gefärbten Antlitzes. Ueber der stumpfen Nase erhob sich eine gewölbte Stirn die an den Schläfen merklich in die Breite ging. Ueberhaupt hatte sein, von dunkelbraunem, vollem und ziemlich langem Haar bedecktes Haupt etwas Derbes, durchaus Kräftiges.
Der Ausdruck der Physiognomie war bei einer gewissen Geschlossenheit der Züge für gewöhnlich ein gleichmäßig mildernster und wohlwollender. Das reiche Seelenleben spiegelte sich in derselben keineswegs lebendig ab. Wenn Schumann die freundliche, zutrauliche Miene annahm, was indessen nicht zu häufig geschah, so konnte er geradezu bestechend auf seine Umgebung wirken.
Beim Stehen – langes Stehen wurde ihm leicht lästig – hatte er entweder beide Hände auf dem Rücken, oder doch eine Hand, während er mit der andern das Haar an der Seite, den Mund oder[293] das Kinn nachdenklich strich. Saß oder lag er unbeschäftigt, so ließ er oft die aufgerichteten Finger beider Hände gegeneinander spielen.
Die Art seines Verkehrs mit Andern war sehr einfach. Er sprach meist eben wenig oder gar nicht, selbst wenn er um etwas befragt wurde, oder doch nur in abgebrochenen Aeußerungen, die indeß stets seine Denkthätigkeit bei einem angeregten Gegenstande verriethen. Eine manirirte Absichtlichkeit war hierin nicht zu suchen. Seine Art zu reden erschien großentheils wie ein Fürsich hinsprechen, um so mehr, da er sein Organ dabei nur schwach und tonlos verwendete, Ueber gewöhnliche, alltägliche Dinge und Erscheinungen des Lebens verstand er sich durchaus nicht zu unterhalten, denn leere Redensarten waren ihm zuwider, und über wichtige, ihn lebhaft interessirende Gegenstände ließ er sich nur ungern und im Ganzen selten aus. Man mußte bei ihm den günstigen Moment abpassen. War dieser eingetreten, so konnte Schumann auf seine Art auch beredt sein. Er überraschte dann durch bedeutende, geistig hervorragende Bemerkungen, die den berührten Gegenstand wenigstens nach einer Seite hin scharf beleuchteten. Doch nur den wenigen vertrauten Personen seines näheren Umganges gewährte er gelegentlich diese Gunst, da er denn auch oft wieder lange mit ihnen zusammen sein konnte, ohne daß es zu einer Unterhaltung gekommen wäre. Von seiner Schweigsamkeit einer Person gegenüber durfte man aber durchaus nicht auf eine Antipathie seinerseits schließen. Es war eben Charakterzug bei ihm, und zwar ein früh ausgebildeter. Sehr wohl war er sich dessen bewußt. An Zuccalmaglio schreibt er (18. Mai 1837) darauf bezüglich, als dieser ihm seinen Besuch in Aussicht stellt: »Herzlich freue ich mich, Sie hier zu sehen. An mir ist indeß nichts zu haben; ich spreche fast gar nicht, Abends mehr, und am Clavier das Meiste.« Bezeichnend für Schumann's stilles Wesen ist auch folgende Mittheilung Heinrich Dorn's: »Als ich Schumann im Jahre 1843 nach langer Zeit zum erstenmal wieder sah, wurde gerade (am Geburtstage seiner Frau) in seinem Hause Musik gemacht. Unter den Gegenwärtigen war Mendelssohn – wir hatten kaum Zeit ein paar Worte zu wechseln, es kamen immer neue Gratulanten. Als ich fortging sagte Schumann zu mir in bedauerndem Tone: ›Ach, wir haben uns gar nicht unterhalten können.‹ Ich vertröstete ihn und mich auf die nächste Zusammenkunft und sagte lachend: ›Da wollen wir uns recht ausschweigen!‹ ›O,‹ erwiederte er erröthend und leise, ›Sie haben[294] mich also nicht vergessen?‹« – Dieses Beispiel zeigt, wie Schumann's Eigenthümlichkeit zu nehmen war. Da man ihn aber genauer kennen mußte, um sie nicht zu mißdeuten, so ist es leicht erklärlich, wenn er durch sein wortkarges Wesen bei flüchtigeren Begegnungen im gesellschaftlichen Leben vielfach Anstoß erregte, und in Folge dessen manche lieblose, ja ungerechte Beurtheilung erfuhr.
Fremden, oder seinem Wesen nicht zusagenden Persönlichkeiten gegenüber konnten Schumann's gesellige Formen leicht etwas Abstoßendes annehmen. Namentlich war er ebenso leicht durch eine gewisse unberufene cordiale Zutraulichkeit wie durch Zudringlichkeit verletzt. Von Launen und einem etwas störrischen Sinn, namentlich während der letzten, durch anhaltende innere Leiden getrübten Lebensjahre, ist er allerdings nicht ganz freizusprechen. Doch war der Kern immer ein so edler und vortrefflicher, daß die angreifbaren Seiten seiner Persönlichkeit kaum dagegen in Betracht kommen. Am gemüthlichsten befand und zeigte er sich im engeren Freundeskreise bei einem Glase Bier oder Wein. Zu gewissen Zeiten bevorzugte er den Champagner, indem er ausdrücklich zu bemerken pflegte: »dieser schlägt Funken aus dem Geist.« Bei solchen Gelegenheiten durfte die Cigarre nicht fehlen. Schumann führte sehr seine und starke Cigarren, die er mitunter scherzweise »kleine Teufel« nannte.
Im Familienkreise war Schumann selten zugänglich; genoß man aber diese Bevorzugung, so empfing man den wohlthuendsten Eindruck. Seine Kinder liebte er nicht minder als seine Gattin, obschon er nicht die Gabe besaß, mit jenen sich andauernd und eindringlich zu beschäftigen. Traf er sie zufällig auf der Straße, so blieb er wohl stehen, langte seine Lorgnette heraus, und betrachtete sie einen Augenblick, indem er mit zugespitzten Lippen freundlich sagte: »Nun, ihr lieben Kleinen?« Dann aber nahm er sogleich die vorige Miene an, und setzte seinen Weg fort, als ob gar nichts vorgefallen sei.
Das äußere Leben, welches Schumann während der letzten Lebensjahre führte, war sehr einförmig und höchst regelmäßig. Vormittags bis gegen 12 Uhr arbeitete er. Dann unternahm er gewöhnlich in Begleitung seiner Gattin, und des einen oder andern nähern Bekannten einen Spaziergang. Um 1 Uhr speiste er, und arbeitete dann nach kurzer Ruhe bis 5 oder 6 Uhr. Hierauf besuchte er meist einen öffentlichen Ort, oder eine geschlossene Gesellschaft, deren Mitglied er war, um Zeitungen zu lesen, und ein Glas Bier[295] oder Wein zu trinken. Um 8 Uhr kehrte er gewöhnlich zum Nachtmahl nach Hause zurück.
Sogenannte Thee- und Abendgesellschaften besuchte Schumann nicht häufig. Bisweilen sah er einen gewissen Kreis von Bekannten und Kunstfreunden in seinem Hause. Er konnte dann, wenn er sich in guter Stimmung befand, ein sehr angenehmer Wirth sein; ja, es kamen einzelne Fälle während des Düsseldorfer Lebens vor, bei denen er sich ungemein heiter und aufgeräumt zeigte. Einmal schlug er sogar, nachdem musicirt und soupirt worden war, einen allgemeinen Tanz vor, an dem er sich zur freudigen Verwunderung aller Anwesenden selbst lebhaft betheiligte.
In Berufsangelegenheiten war Schumann streng und gewissenhaft, obgleich er fast niemals zu Aeußerungen der Heftigkeit oder Leidenschaftlichkeit bei vorkommenden Ungehörigkeiten sich fortreißen ließ, und wenn es der Fall war, bald wieder in versöhntem Tone sprach. Dies Letztere geschah auch, wenn er gegen eine ihm sonst werthe Persönlichkeit einmal unfreundlich gewesen war, was er hinterher sogleich empfand und wieder gut zu machen suchte. Bei abweichenden Ansichten verhielt er sich gewöhnlich schweigend; dies war dann aber ein sicheres Zeichen seiner, nur nicht verlautbarten Opposition, auf Grund deren er bloß handelte, wie er es für Recht erkannte. Bei einer Comitésitzung des Allgemeinen Musikvereins in Düsseldorf sollte ein Beschluß gefaßt werden, mit dem Schumann nicht einverstanden war. Ohne ein Wort zu sprechen, griff er nach seinem Hute, und verließ das Sitzungslokal. Gegen Böswilligkeit und Gemeinheit der Gesinnung war er unerbittlich streng, und, wo sie einmal sich ihm gezeigt hatte, auch für immer unversöhnlich.
Von der Art und Weise, wie Schumann Kunstgenossen begegnete (als Musiker und Kritiker), ist bereits im Verlaufe der Darstellung ausführlich die Rede gewesen; in dieser Hinsicht wäre er als Muster aufzustellen. Von Neid oder Scheelsucht war keine Spur in ihm. Mit inniger Wärme und Freude erkannte er das Große, Bedeutende und Talentvolle an, namentlich wenn er sich durch verwandte Elemente angesprochen fühlte. Im letzteren Falle zeigte er auch, was bei seiner durch und durch deutschen Denkweise und Richtung auffällt, begeisterte Theilnahme für fremdländische Kunst, obschon er sich durchaus abwehrend gegen die neuere dramatische Musik Frankreichs und Italiens verhielt, und in Bezug auf diese auch niemals[296] zu einer angemessenen, in objektiver Anschauung beruhenden Würdigung kam. Während der letzten Lebensjahre bekundete er sogar für einige große Meister der Vergangenheit, namentlich für Haydn's und Mozart's Kunst zeitweilig weniger Interesse. Ja, er ließ selbst mitunter geringschätzende Worte über namhafte Werke derselben fallen, und mußte hierin natürlich von den Meisten mißverstanden werden; denn hauptsächlich war doch zunächst seine Krankheit die Ursache solcher Aeußerungen, wenn auch nicht zu bezweifeln ist, daß das, mit den vorrückenden Jahren immer mehr überhand nehmende Einspinnen in seine eigene Ideenwelt, einen gewissen Antheil daran hatte. –
In dem Heimgegangenen hat die Kunstwelt der Neuzeit einen ihrer hoch- und reichbegabtesten schöpferischen Geister, – einen ihrer geweihtesten Priester verloren. Sein Leben ist gleich bedeutend wie lehrreich für die Kunstgeschichte. Bedeutend durch sittliche und geistige Größe, durch rastloses, dem Höchsten, Edelsten zugewandtes Streben, sowie durch wahrhaft erhebende Erfolge, – lehrreich durch die Irrthümer, mit denen auch er, wie mehr oder weniger jeder Erdgeborene, der Endlichkeit seinen Tribut zollen mußte. Wer aber so gestrebt und geirrt, der ist selig zu preisen! –[297]
Mittheilungen
des Geh. Sanitätsrath Dr. Richarz in Endenich bei Bonn über Robert Schumann's Krankheitsverlauf und Tod.135
Recht gerne entspreche ich Ihrem Wunsche, über das Wesen der Krankheit und die Todesart Robert Schumann's von mir einige Mittheilungen zu erhalten. Am zweckmäßigsten werde ich dabei von dem Befunde bei Obduction der Leiche, als von einer sichern, objectiv gegebenen Basis ausgehen und einer einfachen Aufzählung der vorgefundenen hauptsächlichsten materiellen Producte der tödtlichen Krankheit eine kurze Erläuterung aus dem Grundcharakter und den Verlauf derselben folgen lassen. Was außer dem Gehirn Abnormes in der Leiche entdeckt wurde, übergehe ich als überhaupt unbedeutend und für Ihren besondern Zweck gänzlich irrelevant. Die Hauptergebnisse der Untersuchung bot natürlich, und wie mit Sicherheit zu erwarten stand, das Gehirn dar. Es wird nicht uninteressant sein, wenn ich hier die Bemerkung vorausschicke, daß sich die transversalen Markstreifen am Boden der 4ten Hirnhöhle (die Wurzeln der Gehörnerven) zahlreich und sein gebildet fanden. Von Abnormitäten zeigten sich dann, nach steigender Wichtigkeit, wie nach ihrer genetischen Wichtigkeit geordnet, folgende:
1) Ueberfüllung aller Blutgefäße, vorzüglich an der Basis des Gehirns.
2) Knochenwucherung an der Basis des Schädels, und zwar sowohl abnorm starke Entwickelung normaler Hervorragungen, als Neubildung anormaler Knochenmassen, die zum Theil mit ihrem spitzigen Ende die äußerste (die harte) Hirnhaut durchdrangen.[298]
3) Verdickung und Entartung der beiden innern (der weichen) Häute des Gehirns und Verwachsung der innersten (der Gefäß-) Haut mit der Rindensubstanz des großen Gehirns an mehren Stellen.
4) Ein nicht unbedeutender Schwund (Atrophie) des Gehirns im Ganzen, indem das Gewicht desselben beinahe 7 Unzen (preuß. Medic.-Gewicht) weniger betrug, als es nach Schumann's Lebensalter sollte.
Diese 4 Punkte stehen in der allernächsten Verbindung mit den seit vielen Jahren bei Schumann vorhanden gewesenen psychischen Zuständen; sie bezeichnen in ihrem Verein ein sehr schweres Leiden der ganzen Persönlichkeit, welches seine zartesten Wurzeln in der Regel schon im frühen Lebensalter des Menschen treibt, immer nur allmählig sich ausbildet, mit der ganzen Individualität verwächst und erst nach langer Vorbereitung in offenbares Irresein auszubrechen pflegt. Dieser Krankheitsverlauf läßt sich auch in Schumann's Leben deutlich genug nachweisen und wird insbesondere die schon seit Langem bemerkbar gewesene Schwerfälligkeit seiner Sprache gewöhnlich als die erste der von diesem Hirnzustande ausgehenden Lähmungen beobachtet. Eine der vorzüglichsten äußern Ursachen dieser Krankheit bildet geistige Ueberanstrengung, übermäßige psychische Thätigkeit im Allgemeinen, geistige Ausschweifung möchte ich sagen: eine Gefahr, welcher das künstlerische, namentlich das musikalische Schaffen sehr leicht ausgesetzt ist. Kein Zweifel, daß solche Excesse auch bei Schumann bestanden und die Krankheit herbeigeführt haben. Dem Gehirn strömt dabei, wie jedem überangestrengten Organe, für eine gewisse Zeit und bis zu einem gewissen Maaße eine, der übermäßigen Thätigkeit entsprechend vermehrte Blutmenge zu. Nächste Folge aber ist Gefäßerweiterung, constante Blutfülle, Ausschwitzungen aus dem Blute (hier Knochenwucherung), Verdickung und Entartung der Häute: weitere Folge, Verwachsung der innersten (der Gefäß-) Haut mit der Hirnsubstanz, Unfähigkeit dieser Haut, ihre Function der Blutzufuhr zum Gehirn zu erfüllen, Abnahme der Ernährung der Gehirnmasse, Schwinden derselben.
Das psychische Leiden, welches aus dieser organischen Hirnkrankheit entspringt, trägt immer den Charakter des Schwachsinns an sich, d.h. einer allmähligen Abnahme der intellectuellen Kräfte, die übrigens bei Schumann erst spät bis zu höhern Graden sich entwickelte. Die Gemüthsverfassung ist dabei in der Regel die der Exaltation, und wenn intercurrent auch kurze Perioden der Depression auftreten, so bleibt doch jene stets vorwaltend.[299]
Unserm großen Tonkünstler war es anders beschieden: in seiner Organisation müssen die Bedingungen dafür gelegen haben, daß seine geistige Schwäche von Anfang bis zu Ende von melancholischer Depression begleitet war, wie dieses allerdings in seltenen Fällen dieser Art vorkömmt. Statt der narrenhaften Heiterkeit, des eitel erhöhten Selbstgefühls und des flachen Optimismus, die gewöhnlich solche Kranke trotz des Zusammenbrechens ihrer Kräfte beseligen und mit grandiosen Wahnbildern umgaukeln, war der diesem Geiste anerschaffene Ernst, die ihm eigene Ruhe und Schweigsamkeit, sein in sich gekehrtes beschauliches Wesen in gesunden Tagen auch die Unterlage der Gemüthsverstimmung in der Krankheit, der Schwermuth nämlich und des Trübsinnes mit den entsprechenden Wahnvorstellungen der Verfolgung, der geheimen Berückung, Verkürzung seines Rechtes und seines Werthes, des Versagens der ihm gebührenden Anerkennung, endlich der geheimen Vergiftung.
Diese während Schumann's Krankheit ununterbrochen andauernde Melancholie war sicher das Ergebniß eines größeren Fonds von primitiver geistiger Kraft, als er da vorhanden ist, wo wie gewöhnlich die Exaltation bei diesem Leiden sich einstellt. Das ruhige Beharren und Ansichhalten der Melancholie im Leiden ist der Ausdruck von Kraft gegenüber jener Neigung zu ohnmächtigen Reactionen, welche die Schwäche kennzeichnet. Umschwebt doch der poetische Duft einer hehren Melancholie wie ein Hauch der Vergänglichkeit jede große und erhabene Erscheinung in der Weltgeschichte, wie in der Kunst (man denke nur an Beethoven).
Die Melancholie erhielt dem Kranken ein höheres Bewußtsein seiner selbst, aber auch seiner Krankheit, als es sonst unter gleichen Umständen der Fall ist: sie entstellte weniger die ursprüngliche Persönlichkeit, und bedingte eine der Schwere des Leidens angemessenere Stimmung, als die Exaltation gethan haben würde, die solchen Kranken bei augenscheinlichem Verfall der leiblichen und geistigen Kräfte nicht nur meistens jedes Bewußtsein eines Leidens raubt, sondern auch eine mit der Wirklichkeit auf's Gräßlichste contrastirende Stimmung verleiht, die das Gefühl des Beobachters auf's Tiefste verletzt, weil sie von der frühern Persönlichkeit gemeinlich nur noch ein Zerrbild erkennen läßt.
Diese Melancholie machte denn auch eine so große scheinbare Besserung möglich, wie sie Schumann im Frühjahr 1855 darbot, bei[300] der übrigens die Fortdauer einiger der schlimmsten Erscheinungen, wenn auch in gemindertem Grade, den Kundigen nicht über den Werth der günstigen Veränderung im äußeren Verhalten täuschen konnte, die den Patienten damals nur wenig von seinem gewöhnlichen Erscheinen, vor der Katastrophe in Düsseldorf, verschieden zeigte.
Die Melancholie stand ferner im engsten ursächlichen Zusammenhang mit den Hallucinationen, die, anfänglich nur, oder doch hauptsächlich im Gehör vorkamen (als Stimmenhören, Hören von Worten und Redensarten, deren Bedeutung den oben genannten Wahnvorstellungen entsprach), und erst später bei zunehmender Schwäche auch im Geruch und Geschmack auftraten, gegen das Lebensende aber in diesen Sinnen die höchste Stufe erreichten, als sie für das Gehörorgan schon längst erloschen waren.
Die Melancholie endlich war es, die, obschon im obigen Sinne ein Zeichen höherer Kräftigkeit, gleichwohl das Ende des verehrten Meisters beschleunigte: während nämlich bei der Exaltation in dieser Krankheit oft ungeachtet des rapiden Unterganges aller höhern Kräfte des Organismus die vegetative Seite desselben nur wenig beeinträchtigt erscheint, war hier der Gang insofern ein umgekehrter, als die geistigen Fähigkeiten und die ihnen zugesellten Triebe, Neigungen und Gewohnheiten sich bis in die letzte Lebenszeit, wenngleich stetig sinkend, auf einer verhältnißmäßig großen Höhe behaupteten, dahingegen die allgemeine körperliche Ernährung unter dem Einflusse des auf dem Nervensystem lastenden Druckes der Melancholie nur eine gewisse Zeitlang künstlich und mühsam aufrecht erhalten werden konnte, wonach dieselbe unter häufiger Nahrungsverweigerung in ein unaufhaltsames Sinken gerieth, so daß bei äußerster Abmagerung der Tod erfolgen mußte.
| 1 | S. Briefe vom Jahre 1833–1854 Nr. 23. |
| 2 | S. Briefe vom Jahre 1833–1854 Nr. 33, 34, 35 und 36. |
| 3 | Die Angabe Schumann's ist abweichend von der in seinem Notizbuche sich vorfindenden; denn in Betreff der Composition des 150. Psalm's, wenn dieser hier gemeint ist, wie nicht gut anders möglich, da kein anderer Compositionsversuch der Art weiter angeführt ist, findet sich in letzterem die Notiz; »1822 oder 23 der 150. Psalm mit Orchester.« |
| 4 | Ueber die Versuche Franz Liszt's, die Schumann'sche Musik in öffentliche Kreise einzuführen, siehe dessen Mittheilungen Anhang F. |
| 5 | S. Briefe vom Jahre 1833–1854 Nr. 35. |
| 6 | S. Briefe vom Jahre 1833–1854 Nr. 31. |
| 7 | Dieses Werk enthält 3 Lieder von der Gattin Schumann's (weshalb auch der Titel beide Namen nennt), und zwar die Nummern 2, 4 und 11. Nachdem Fr. Rückert die Bekanntschaft dieses auf seine Poesien entstandenen Liederheftes machte, veröffentlichte er im Berliner Taschenbuch vom Jahre 1843 folgendes Gedicht: An Robert und Clara Schumann. Lang ist's, lang Seit ich meinen Liebesfrühling sang; Aus Herzensdrang, Wie er entsprang, Verklang in Einsamkeit der Klang. Zwanzig Jahr Wurdens, da hört ich hier und dar Der Vogelschaar Einen, der klar Pfiff einen Ton, der dorther war. Und nun gar Kommt im ein und zwanzigsten Jahr Ein Vogelpaar, Macht erst mir klar, Daß nicht ein Ton verloren war. Meine Lieder Singt ihr wieder, Mein Empfinden Klingt ihr wieder, Mein Gefühl. Beschwingt ihr wieder, Meinen Frühling Bringt ihr wieder, Mich, wie schön Verjüngt ihr wieder; Nehmt meinen Dank, wenn auch die Welt, Wie mir einst, ihren vorenthält. |
| 8 | Bei der später nothwendig gewordenen neuen Ausgabe dieses Werkes (Whistling, Leipzig), kam das erste in demselben befindliche Lied, »der frohe Wandersmann«, in Wegfall, und wurde durch ein anderes, »In der Fremde«, ersetzt. |
| 9 | Es ist wohl denkbar, daß dieses Burns'sche Gedicht im Originale eine höhere Bedeutung gewinnen könne; ich vermag dies nicht zu beurtheilen. |
| 10 | S. Briefe vom Jahre 1833–1854 Nr. 42. |
| 11 | Daß die Begriffe des Melodischen und Gesangsgemäßen nicht zu identificiren sind, wird als selbstverständlich vorausgesetzt. |
| 12 | S. Briefe vom Jahre 1833–1854 Nr. 29. |
| 13 | Sie kam zum ersten Mal in einem öffentlichen Concert von Clara Schumann im Gewandhause zu Leipzig, am 31. März 1841 zur Aufführung. |
| 14 | S. Schumann's Ges. Schriften (Aufl. 2) Bd. II, 142. |
| 15 | S. dessen Claviertrio's op. 99 und 100. |
| 16 | In der neuen Ueberarbeitung wurde diese Symphonie zum ersten Mal beim Niederrheinischen Musikfest des Jahres 1853 in Düsseldorf unter Leitung des Componisten zu Gehör gebracht. |
| 17 | An dieses schöne Werk knüpft sich für mich eine mir besonders werthvolle Erinnerung aus der Zeit meiner Düsseldorfer Wirksamkeit. Schumann ersuchte mich nämlich eines Tages im Hinblick auf die von ihm vorzunehmende Umarbeitung desselben, aus dem ursprünglichen Manuscript das Streichquartett, (wenn mich mein Gedächtniß nicht täuscht, vollständig von Anfang bis Ende) zu copiren, um dann in die so neu angelegte Partitur die zu verändernden Partien der Blasinstrumente einzutragen. |
| 18 | Zum 1. Mal am 6. December 1841 im Leipziger Gewandhaussaale aufgeführt. |
| 19 | Möglicherweise ist das Wort »Orchesterbegleitung« ein Schreibfehler Schumann's. Mir ist nur eine Composition dieser drei Heine'schen Lieder unter dem Titel, »Tragödie« bekannt; sie findet sich in op. 64 mit abgedruckt. Außerdem müßte Schumann noch eine zweite Composition dieses Namens unternommen haben, wenn die obige Angabe richtig sein sollte. Davon besagt aber sein Compositionsverzeichniß nichts. |
| 20 | Eine den zahlreichen Meisterwerken der Vergangenheit gegenüber wohl erklärliche Bescheidenheit ließ Schumann selbst später noch die Aeußerung thun, daß man im Bereich der Sonate und Ouvertüre nichts mehr leisten könne. Gleichwohl componirte er in den letzten Lebensjahren mehrere diesen beiden Gattungen angehörende Werke. |
| 21 | Das bei der Coda derselben vorgeschriebene. »più lento« ist ein Druckfehler und nach Angabe Schumann's in »più mosso« zu verwandeln. Bei dieser Gelegenheit sei auch bemerkt, daß die Metronomisirungen in Schumann's Werken nicht maßgebend sind, weil der Meister sie nach einem unrichtig gehenden Metronom gemacht hat, wie sich erst später herausstellte. |
| 22 | Als damaliger Schüler der Leipziger Musikschule hatte ich selbst Gelegenheit, dies aus eigener Anschauung wahrzunehmen, indem ich in eine der von Schumann zu ertheilenden Clavierstunden beordert wurde, um die Violinstimme in dem B-dur Trio von Franz Schubert op. 99 auszuführen, welches einer der Schüler spielen sollte. Die Stunde verging aber, ohne daß Schumann kaum den Mund geöffnet hatte, obwohl, wie ich mich genau erinnere, genug Veranlassung dazu vorhanden war. |
| 23 | Im Jahr 1843 wurden auch die Nr. 11 (op. 99) und 6 (op. 124) geschrieben. |
| 24 | Ein Mitarbeiter der »Neuen Zeitschr. f. Musik (Bd. 52, S. 211)« ist der Meinung, daß Schumann für diese Umgestaltung die Uebersetzung desselben Gedichtes von Theodor Oelkers (Leipzig, Tauchnitzjun.) wesentlich benutzt habe, da etwa ein Drittel dieser Arbeit mit dem Texte zu Schumann's, »Peri« übereinstimmend sei. |
| 25 | Die Louri's sind nach dem Islam weibliche, mit unvergänglichen Reizen versehene Wesen, welche die Bestimmung hatten, die Seligen zu bedienen und ihnen auch Gesellschaft zu leisten. |
| 26 | Vergl. beispielsweise S. 63, Takt 23–26, S. 69, Takt 3–5, S. 114. Takt 3–5 und S. 118, Takt 6–10 des Clavierauszuges. |
| 27 | S. Briefe vom Jahre 1833–1854 Nr. 58. |
| 28 | Clara Schumann hatte seit ihrer Verheirathung erst eine größere Kunstreise wieder unternommen, und zwar nach Copenhagen, aber ohne ihren Gatten, da die Berufsverhältnisse ihm die Mitreise nur bis Hamburg gestatteten. S. Briefe vom Jahre 1833–1854 Nr. 42. |
| 29 | S. Briefe vom Jahre 1833–1854 Nr. 38. |
| 30 | Es sind die beiden Grafen Gebrüder Wielhorsky, Joseph und Michael, die auf dem Pianoforte und Violoncell als kunstgebildete Dilettanten einen Namen von gutem Klange haben, wenigstens in Rußland. |
| 31 | Die B-dur-Symphonie op. 38. |
| 32 | Heft V der »Lieder ohne Worte« Nr. 5. |
| 33 | Es war der älteste Bruder von Schumann's Mutter, Carl Gottlob Schnabel, welcher als Medic. pract. nach Rußland auswanderte, um als Wundarzt in dortige Militairdienste zu treten. |
| 34 | Es geschah also. |
| 35 | Dieser Plan kam nicht zur Aufführung; das Künstlerpaar kehrte auf dem gewöhnlichen Wege nach Deutschland zurück. |
| 36 | Ein Sohn Friedrich Wieck's, ehedem Mitglied der Kaiserl. Kapelle zu Petersburg. |
| 37 | Schumann dichtete während der russischen Reise Verse, unter anderm über den Kreml in Moskau. Für diese Stadt scheint er eine besondere Vorliebe gehabt zu haben; »der Name Moskau klingt immer wie der helle Ton einer großen Glocke an das Ohr«, schreibt er schon acht Jahre vorher, und zwar am Charfreitag 1836 an Zuccalmaglio. |
| 38 | Vergl. S. 193. |
| 39 | Vergl. S. 135. |
| 40 | S. Briefe vom Jahre 1833–1854 Nr. 29. |
| 41 | S. Briefe vom Jahre 1833–1854 Nr. 35. |
| 42 | S. neue Zeitschrift für Musik. Bd. 20, S. 204. Von Oswald Lorenz ging die Zeitschrift zu Anfang 1845 an F. Brendel über. |
| 43 | Aus Schumann's im December 1840 angefangenen Projectirbuch geht hervor, daß er beabsichtigte, eine Oper »der Corsar« nach Byron's Gedicht zu componiren. Wenigstens findet sich dieser Stoff unter der Rubrik »Operntexte« von Schumann's Hand mit verzeichnet. Möglicherweise war er schon im Besitze eines Textbuches, dem die oben angeführten, bis jetzt noch unbekannt gebliebenen Bruchstücke vielleicht angehören. |
| 44 | Vergl. S. 87 u. 133. |
| 45 | Obwohl die pathologische Anatomie uns noch die Antwort schuldig ist, ob und welchen Nutzen sie seit je für das Heilen der Krankheiten gehabt habe; so wird sich doch der Naturforscher, Phrenolog und Psycholog freuen, welchen Ausspruch die Anatomie über Schumann's Hirnbau thun wird. Ein Gypsabguß seines merkwürdigen Kopfgebäudes und eine Raumangabe seiner Schädelhöhle (nach Morson) sind nicht blos zu Vergleichungen mit Beethoven, Mozart, Haydn etc., sondern auch in psychologischer Hinsicht höchst wünschenswerth und um so sicherer von den Obducenten zu erwarten, als gerade der jetzige reale Standpunkt obiger Wissenschaft alle Theorie umgehend sich blos an das rein Objective hält. (Anmerkung des Dr. Helbig.) |
| 46 | Felix Mendelssohn-Bartholdy starb angeblich in Folge der Apoplexia nervosa, und zwar am 4. November 1847. |
| 47 | Mittheilung des Dr. Helbig. |
| 48 | Später gab Schumann sich wieder nach und nach dem Verkehr mit Andern hin, namentlich mit Berthold Auerbach, Eduard Bendemann, Ferdinand Hiller, Julius Hübner und Robert Reinick. Auch interessirte er sich lebhaft für die, im Herbst 1845 in Dresden eingerichteten Abonnementsconcerte unter F. Hiller's Leitung, die aber in Folge von dessen Berufung zum städtischen Musikdirektor nach Düsseldorf (Ende 1847) wieder einschliefen. Schumann war sogar Direktorialmitglied dieser Concerte. Siehe Briefe vom Jahre 1833–1854 Nr. 48. |
| 49 | An den Verf. d. Blätter. |
| 50 | Der in op. 124 unter Nr. 20 abgedruckte Canon gehört dazu. |
| 51 | Die Idee für den »Pedalflügel« zu schreiben, ist wenig praktisch zu nennen, da dergleichen Instrumente höchst selten im Gebrauch sind. Veranlassung dazu mag Schumann speciell durch die Einführung eines Pedalflügels bei der Leipziger Musikschule zur Vorübung der Schüler der Orgelklasse empfangen haben. Man kann aber sehr wohl diese, von Schumann für den Pedalflügel verfaßten Compositionen auf einem gewöhnlichen Clavier ausführen, indem man einen zweiten Spieler die Pedalstimme eine Octave tiefer übernehmen läßt. |
| 52 | Die erste öffentliche Aufführung dieser Symphonie fand in einem der Leipziger Gewandhausconcerte am 5. November 1846 statt. |
| 53 | Es ist sehr bemerkenswerth, wie ein und dasselbe Motiv von verschiedenen Meistern benutzt ist, ohne daß dabei von einem Plagiat die Rede sein kann. Die vier ersten Takte des von Schumann im letzten Satze seiner C-dur-Symphonie gebrachten melodischen Motivs kommen mit geringer Abweichung auch in dem letzten Stücke des Liederkreises von Beethoven an die »ferne Geliebte«, sowie im Andante von Mendelssohn's Symphoniecantate vor. Ein verwandtes Motiv findet sich in dem Rondo von Haydn's Claviertrio (C-dur Nr. 26), im 15. Takte. |
| 54 | In Schumann's Compositionsverzeichniß sind beiop. 59 fünf Lieder vermerkt; die gedruckte Ausgabe dieses Werkes enthält nur 4 Nummern. |
| 55 | Zu diesem opus gehört, wie es im Druck erschienen ist, noch »Tragödie« von Deine. Vergl. S. 176. |
| 56 | Dies Werk enthält, wie es gedruckt ist, nur 7 Stücke. |
| 57 | Vergl. S. 179. |
| 58 | Vergl. S. 158. |
| 59 | Die folgenden Mittheilungen verdanke ich theils der Gattin Reinick's, theils sind sie einem Bericht Pohl's über die Verhandlungen Schumann's mit Hebbel entnommen. S. Neue Zeitschr. f. Musik, Bd. 50, S. 254 f. |
| 60 | S. Briefe vom Jahre 1833–1854 Nr. 55 u. 56. |
| 61 | S. Briefe vom Jahre 1833–1854 Nr. 71. |
| 62 | Die Wiesbadener Hofbühne hat es den ebenso erfolgreichen als anerkennenswerthen Bemühungen des Herrn Capellmeisters Jahn zu verdanken, daß seit dem Jahre 1874, in welchem auf derselben die Genoveva zuerst erschien, bereits nahe an dreißig Vorstellungen des Werkes unter reger Theilnahme des Publikums stattgefunden haben. |
| 63 | Die Ouverture wurde bereits in einem, für den Leipziger Orchesterfonds veranstalteten Concert am 25. Februar 1850 aufgeführt. |
| 64 | Bis jetzt noch nicht veröffentlicht. |
| 65 | Zum ersten Mal aufgeführt in einem für die Armen im Leipziger Gewandhaus veranstalteten Concert am 10. December 1849. |
| 66 | Vergl. S. 71. |
| 67 | Es sind der Zahl nach 43 in der veröffentlichten Ausgabe. Erst später findet sich diese Zahl auch auf dem Titel. |
| 68 | S. Briefe vom Jahre 1833–1854 Nr. 63. |
| 69 | Von wem ist mir nicht bekannt. |
| 70 | Offizier in Oldenburgischen Diensten. |
| 71 | S. Briefe vom Jahre 1833–1854 Nr. 73. |
| 72 | An den Verf. d. Blätter. |
| 73 | S. Briefe vom Jahre 1833–1854 Nr. 58. |
| 74 | Der Dresdner Chorgesangverein wurde am 4. Januar 1848 mit durch Schumann begründet, und von ihm bis zu seiner Uebersiedelung nach Düsseldorf (im Sommer 1850) dirigirt. Nach dieser Zeit löste sich zwar der Verein nicht auf, er hielt aber keine regelmäßigen Zusammenkünfte, und begann erst wieder 1855 am Stiftungstage, also am 5. Januar, unter Leitung Robert Pfretzschner's, von Neuem eine geregelte Thätigkeit. |
| 75 | S. Briefe vom Jahre 1833–1854 Nr. 58. |
| 76 | S. Briefe vom Jahre 1833–1854 Nr. 66. |
| 77 | S. Briefe vom Jahre 1833–1854 Nr. 66. |
| 78 | Dieses »noch« bezieht sich auf die Ende 1848 bereits geschriebenen fünf, den »Waldscenen« angehörigen Stücke. |
| 79 | Zum ersten Mal aufgeführt in einem Concert für den Orchesterpensionsfond im Leipziger Gewandhaus am 25. Februar 1850. |
| 80 | die veröffentlichten Ausgaben von op. 67 und 75 enthalten nicht 14 Stücke, wie oben angegeben, sondern nur 10. Zwei weitere Hefte »Romanzen und Balladen für Chorgesang«, enthalten gleichfalls zusammen 10 Nummern. Dieselben entstanden auch im Jahr 1849, und sollten mit den Werkzahlen 102 und 107 erscheinen. Thatsächlich wurden sie aber erst im Jahr 1860 als op. 145 und 146 (in jedem der beiden Hefte sind wiederum wie in op. 67 und 75 fünf Gesänge enthalten) durch den Druck veröffentlicht. |
| 81 | Von dem spanischen Liederspiel op. 74 sind in dem gedruckten Heft nur 10 Nummern vorhanden. |
| 82 | Mit diesen zugleich entstand offenbar der in op. 99 als Nr. 14 abgedruckte, die Jahreszahl 1849 tragende »Geschwindmarsch«. |
| 83 | Zum ersten Mal in den Düsseldorfer Abonnementconcerten am 21. November 1850 aufgeführt. |
| 84 | Zum ersten Male in den Düsseldorfer Abonnementconcerten am 13. Mai 1851 aufgeführt. |
| 85 | Zum ersten Mal in den Düsseldorfer Abonnementconcerten am 11. Januar 1851 aufgeführt. |
| 86 | S. die Briefe des Anhanges Nr. 91. |
| 87 | S. Seite 224. |
| 88 | Dieses Lied ist in op. 77 (entst. 1840 u. 1850) als Nr. 5 mit abgedruckt. Dasselbe Heft enthält auch noch den in der ersten Ausgabe von op. 39 veröffentlichten »frohen Wandersmann«, sowie gleichfalls drei andere Lieder; »Mein Garten« »Geisternähe« und »Stiller Vorwurf«, von denen das letztere sich nicht in Schumann's Compositionsbuch vermerkt findet. Auch die in op. 27 und 51 enthaltenen Lieder (entst. 1840 und 1842) fehlen sämmtlich in dem genannten Verzeichniß; ebenso die Composition zu Schiller's »Handschuh« (op. 87), deren Entstehung in das Jahr 1850 fällt. |
| 89 | Von diesen Liedern sind »Wandrers Nachtlied«, »Schneeglöckchen«, »Ihre Stimme«, »Gesungen«, und »Himmel und Erde« in op. 96 (entst. 1850) aufgenommen. »Geisternähe« und »Mein Garten« befinden sich, wie schon erwähnt in op. 77. »Frühlingslust«, »Frühnligslied«, »Husarenabzug«, und »Mein altes Roß« endlich, gehören zu dem Liederhefte (op. 127), welches als fünftes Lied noch »Volkers Lied« (componirt 1851) enthält. |
| 90 | Das Quintenmotiv ist schon lange vor Schumann in der Instrumentalmusik auf charakteristische Weise benutzt worden. So z.B. hat Franz, Heinrich Biber in einer seiner sechs, 1681 zu Salzburg erschienenen Violinsonaten das Quintenmotiv als Basso ostinato gebraucht; und wie Haydn dasselbe dem ersten Satz seines charaktervollen D-moll-Quartetts zu Grunde legt, ist allgemein bekannt. Auch im ersten Satz von Beethoven's C-moll-Symphonie kommt dieses Quintenmotiv als Ueberleitung zum zweiten Thema vor, und gleicherweise am Anfang von Mendelssohn's Hymne für Sopran-Solo und Chor: »Hör' mein Bitten, Herr, neige dich zu mir.« Das erstere Stück kannte Schumann schwerlich; die bezeichneten Stellen in den Werken Haydn's und Beethoven's dagegen haben ihm vielleicht unbewußt Anregung zur Benutzung des fraglichen Motivs gegeben, welches übrigens bereits bei ihm in seinem opus 5, sowie im ersten Trio des Clavierquintetts op. 44 erscheint. Die angeführten Beispiele zeigen, daß ein und dasselbe Motiv auf durchaus verschiedene Art geistreiche Anwendung finden kann, ohne zu einer anfechtbaren Reminiscenz zu werden, von der natürlich auch hier in keinem einzigen der gegebenen Fälle die Rede sein kann. |
| 91 | S. Nr. 69 der im Anhang mitgetheilten Briefe. |
| 92 | Schumann's in Rede stehende Musik war zur Feier von Goethes hundertjährigem Geburtstag in Leipzig aufgeführt worden. |
| 93 | Bekanntlich war Mendelssohn, ehe er an die Gewandhausconcerte nach Leipzig berufen wurde, Musikdirektor in Düsseldorf. Ihm folgte Julius Rietz, und diesem wiederum Ferd. Hiller. |
| 94 | Damals Concertmeister in Dresden. |
| 95 | Hier hielt Schumann, wie bereits früher bemerkt wurde, sich öfter besuchsweise auf dem Gute der Frau Serre auf. |
| 96 | Der Sonnenstein ist eine Irrenanstalt bei Pirna. |
| 97 | Hiller hatte zu der, von ihm für Chopin in Düsseldorf veranstalteten Gedächtnißfeier ein Gedicht verfaßt. |
| 98 | Es betraf die zweite Capellmeisterstelle am Königl. Hoftheater zu Dresden. |
| 99 | Franziska Schwarzbach, damals k. Sächs. Hofopernsängerin, gegenwärtig in München. |
| 100 | S. Briefe vom Jahre 1833–1854 Nr. 77. |
| 101 | Vergl. S. 180. |
| 102 | Da ich mich damals selbst unter den Mitwirkenden auf dem Orchester befand, so kann ich hierüber aus eigener Wahrnehmung berichten. |
| 103 | S. Briefe vom Jahre 1833–1854 Nr. 89. |
| 104 | Ich beschränke mich darauf, in Betreff dieser Angelegenheit ohne jede Nebenbemerkung den mir von völlig competenter Seite mitgetheilten Thatbestand zu referiren. |
| 105 | Dies Werk wurde als Manuscript zum ersten Mal aufgeführt in den Düsseldorfer Abonnementsconcerten am 11. Januar 1851. |
| 106 | Zum ersten Mal in den Düsseldorfer Abonnementsconcerten aufgeführt am 6. Februar 1851. |
| 107 | In den Düsseldorfer Abonnementsconcerten zuerst aufgeführt am 13. Mai 1851. |
| 108 | Von diesen Liedern sind in op. 107 nur die drei ersten und das letzte enthalten. Volkers Lied ist weggelassen, und befindet sich in op. 125, wogegen zwei andere in op. 107 mit aufgenommen wurden, nämlich »Im Walde« und die »Spinnerin«, beide 1852 componirt. Das letztere Lied ist in Schumann's Compositionsverzeichniß nicht zu finden. |
| 109 | Zum ersten Mal bei Gelegenheit des Männergesangfestes am 3. August 1852 in Düsseldorf zu Gehör gebracht. |
| 110 | Kam in den Düsseldorfer Abonnementsconcerten zum ersten Mal am 5. Februar 1852 zur Aufführung. |
| 111 | Am 6. Mai 1852 in den Düsseldorfer Abonnementsconcerten zum ersten Mal aufgeführt. |
| 112 | In diese Zeit, und zwar Ende Juli fällt eine Erholungsreise nach der Schweiz. S. Briefe vom Jahre 1833–1854 Nr. 77. |
| 113 | Ist, wie schon bemerkt, in op. 107 enthalten. |
| 114 | op. 119 enthält außer diesen beiden Liedern auch noch ein drittes von Pfarrius: »der Bräutigam und die Birke«, welches in dem Compositionsverzeichniß nicht zu finden ist. |
| 115 | Von diesem Stücke existirte in Düsseldorf das, bis auf die Instrumentation fertige Manuscript, welches Schumann so interessirte, daß er es vollendete. |
| 116 | Die Correspondenz Schumann's mit dem Dichter wegen des Textes s. Briefe vom Jahre 1833–1854 Nr. 74–76 und 78–80. |
| 117 | S. Briefe vom Jahre 1833–1854 Nr. 77. |
| 118 | Vergl. S. 166. |
| 119 | Es ist mir unbekannt, von wessen Hand dieser veränderte Schluß herrührt. |
| 120 | Das Gedicht ist von E. Geibel. Schumann's Composition wurde als Manuscript bereits am 2. December 1852 in den Düsseldorfer Abonnementsconcerten zum ersten Mal aufgeführt. |
| 121 | Ist mit in op. 122 enthalten. |
| 122 | Die Bearbeitung des Gedichts ist von Dr. Hasenclever. |
| 123 | Aufgeführt zum ersten Mal beim Musikfest in Düsseldorf am 17. Mai 1853. |
| 124 | Von J. Joachim zum 1. Mal öffentlich vorgetragen in den Düsseldorfer Abonnementsconcerten, am 27. October 1853. |
| 125 | Bis hierher reichte Sch's Compositionsübersicht, als er sie mir zur Benutzung im Herbst 1853 nach Bonn schickte. |
| 126 | Der betreffende an den Verf. d. Bl. gerichtete Brief ist vom 11. Juni. |
| 127 | Robert Radecke, k. Musikdirektor in Berlin, war damals besuchsweise in Düsseldorf anwesend. |
| 128 | S. Briefe vom Jahre 1833–1854 Nr. 84. |
| 129 | S. Briefe vom Jahre 1833–1854 Nr. 85. |
| 130 | S. Briefe vom Jahre 1833–1854 Nr. 87. |
| 131 | S. Briefe vom Jahre 1833–1854 Nr. 84 u. 85. |
| 132 | S. neue Zeitschrift f. Musik, Bd. 39, S. 185 u. ges. Schr. (Aufl. II.) Bd. 2, 374. |
| 133 | S. Briefe vom Jahre 1833–1854 Nr. 91. |
| 134 | Ich kann hier natürlich nur von den letzten Lebensjahren, während welcher ich Schumann näher gekannt, sprechen. |
| 135 | Auf mein besonderes Ersuchen als Beitrag für die Biographie eingesandt. |
Buchempfehlung
Meyer, Conrad Ferdinand
Jürg Jenatsch. Eine Bündnergeschichte
Der historische Roman aus der Zeit des Dreißigjährigen Krieges erzählt die Geschichte des protestantischen Pastors Jürg Jenatsch, der sich gegen die Spanier erhebt und nach dem Mord an seiner Frau von Hass und Rache getrieben Oberst des Heeres wird.
188 Seiten, 6.40 Euro
Im Buch blättern
Ansehen bei Amazon
Buchempfehlung
Romantische Geschichten III. Sieben Erzählungen
Romantik! Das ist auch – aber eben nicht nur – eine Epoche. Wenn wir heute etwas romantisch finden oder nennen, schwingt darin die Sehnsucht und die Leidenschaft der jungen Autoren, die seit dem Ausklang des 18. Jahrhundert ihre Gefühlswelt gegen die von der Aufklärung geforderte Vernunft verteidigt haben. So sind vor 200 Jahren wundervolle Erzählungen entstanden. Sie handeln von der Suche nach einer verlorengegangenen Welt des Wunderbaren, sind melancholisch oder mythisch oder märchenhaft, jedenfalls aber romantisch - damals wie heute. Nach den erfolgreichen beiden ersten Bänden hat Michael Holzinger sieben weitere Meistererzählungen der Romantik zu einen dritten Band zusammengefasst.
- Ludwig Tieck Peter Lebrecht
- Friedrich de la Motte Fouqué Undine
- Ludwig Achim von Arnim Isabella von Ägypten
- Clemens Brentano Geschichte vom braven Kasperl und dem schönen Annerl
- E. T. A. Hoffmann Das Fräulein von Scuderi
- Joseph von Eichendorff Aus dem Leben eines Taugenichts
- Wilhelm Hauff Phantasien im Bremer Ratskeller
456 Seiten, 16.80 Euro
Ansehen bei Amazon
- ZenoServer 4.030.014
- Nutzungsbedingungen
- Datenschutzerklärung
- Impressum