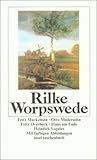Fritz Overbeck
[89] Die Zeit geht rasch. Als Modersohn und Mackensen im Herbst 1891 wieder einmal nach Düsseldorf und in den »Tartarus« kamen, da fanden sie lauter neue Leute und wenig bekannte Gesichter. Die Gäste aus Worpswede erregten Neugier und Staunen. Keiner von den jungen Leuten konnte sich denken, daß es möglich sei, auch im Winter in irgend einem Dorf zu sitzen, einzuschneien und der Welt den Rücken zu drehen. Und einer, der sich besonders wunderte, kam auf Otto Modersohn zu und, da er, obwohl er schweigsam schien, zu reden pflegte, wenn die Zeit zum Reden gekommen war, fragte er ihn, wie es möglich sei. »Worpswede? das kenne ich wohl,« sagte er, »ich bin Bremer.« Und, einmal im Gange, fragte er weiter, wie es denn da auf dem Dorfe sei. Man konnte merken, er hatte nicht übel Lust es selbst zu erproben. Modersohn besah sich aufmerksam den breitschultrigen, bartlosen jungen Mann mit der schweren, gedrungenen Gestalt, der damals bei Jernberg arbeitete und dessen liebstes Wort »unbändige Naturkraft« war. Er lud ihn ein zu kommen. Und es dauerte nicht lange, daß er kam und blieb. Es war Fritz Overbeck.
Worpswede war auch für ihn das Ereignis. Anders als für Modersohn. Er hatte hier nicht die Sprache gefunden, in der er seine Seele sagen wollte. Er dachte gar nicht daran, sie zu sagen: er war kein Dichter. Es träumte irgendwo in ihm hinter einer dicken Schale von Schweigsamkeit und er brauchte ein Gegengewicht[89] dafür in der Welt. Deshalb malte er, malte die Dinge nach seinem Ebenbilde, stark, breitschultrig und voll von einer schweren Schweigsamkeit. Und hier waren sie nun so oder vielleicht sah er sie so, jedenfalls kamen sie seinem Schauen entgegen, gingen auf ihn ein und ihre klangvollen Farben und die Behäbigkeit ihrer Formen und die Stille, mit der sie dastanden: alles das gab ihm das Gefühl von einer Wirklichkeit, die um ihn war, und eben das brauchte er: Wirklichkeit. Das war es, was ihn so stark anzog, wenn er Björnsons Bücher las. So dachte er sich das Leben, so meinte er es. Man kam irgendwo an, in einer kleinen, hellen Stadt, nicht weit vom Fjord, man trat ein und es waren Leute da, mit irgend etwas Einfachem, Vernünftigem beschäftigt, was man gleich begriff, es waren hellblonde Kinder da, die Butterbrot aßen, und kleine Hunde, welche bellten, und das war alles ganz in der Ordnung so. Man konnte sich niedersetzen unter diesen Leuten, eine Pfeife rauchen und durch eines der hellen Fenster hinaus in die Landschaft schauen. Man war nicht gezwungen, etwas zu sagen als höchstens guten Tag, war man aber gelaunt zu sprechen, so hatte auch das durchaus nichts Ungewöhnliches an sich, durchaus nicht. Alle fanden es ganz natürlich, freuten sich, sagten gelegentlich auch ein Wort, und es wurde Abend dabei, stiller, hoher, heller nordischer Abend, und die Glocke in der alten Kirche auf dem Hügel läutete fromm und feierlich, so daß alle merken konnten, daß es Abend war. Das sind nicht etwa Stimmungen, die Fritz Overbeck malt, aber wenn er malt, lebt er sie. Man denkt[90] an die alten Holländer dabei, die vielleicht so gemalt haben, um des Gleichgewichtes willen. Es ist auch eine von den Anpassungsmöglichkeiten an das Leben, deren es so viele giebt, glückliche und unglückliche, einfache und umständliche, stille und polternde. Fritz Overbeck malt, wie manche Leute Musik machen: sie spielen, und das Stück, das sie spielen, ist stark oder sanft, gewaltig oder erwartungsvoll; aber, obwohl sie es ganz meisterhaft spielen, sind sie selber nicht drin, sie spielen es, um irgendwo zu Hause zu sein, nicht in dem Liede, irgendwo, wo sie sind. So malt er: nur daß seine Bilder das Gegenteil sind von Musik. Musik löst alles Vorhandene auf in Möglichkeiten und diese Möglichkeiten wachsen und wachsen und vertausendfältigen sich, bis die ganze Welt nichts ist, als eine leise schwingende Fülle, ein unabsehbares Meer von Möglichkeiten, von denen man keine einzige zu ergreifen braucht. Auf seinen Bildern aber setzt sich alles zur Wirklichkeit um, füllt sich, verdichtet sich. Sogar seine Himmel sind Tatsachen, an denen man nicht vorüber kann. Wenn er sie wolkenlos malt, dann ist es die kräftige Farbe, die sie stofflich macht, aber viel öfter stehen Wolken in ihnen, greifbar und groß, Wolkendörfer, eine Wolkenstadt. Auch seine Mondnächte sind so, voll eines Himmels, der zur Erde gehört, der schwer geworden ist und sich daran gewöhnt hat, mit den Dingen zu leben. Es ist eine große, rührende, kindliche Bejahung der Weit in dieser herzlichen, handfesten Malerei. Nirgends kann ein Zweifel aufkommen, es giebt nichts was ungewiß wäre, überall steht es in breiten Lettern: Est, est, est![91]
Man betrachte seine Radierungen. Eine der ältesten gleich mit der Brücke und der Mühle und dem Berg in der Ferne bestätigt, was hier zu sagen versucht worden ist. Ja sie weist sogar noch darüber hinaus. Sie spricht von der Kunst, die Massen im Raume zu verteilen; hier ist mit ihnen hantiert worden wie mit Dingen. Die einen sind gleichsam hineingestellt, andere hineingeschoben, und die Balken der Brücke scheinen vom Berge her an ihren Platz geschleudert worden zu sein. Das alles sitzt und man mag daran rütteln, es rührt sich nicht. Und die andere Brücke, genannt: Stürmischer Tag. Hier scheint es gelungen, den Sturm selbst zu einem Dinge zu machen. Er füllt das ganze Blatt aus und Gräser, Büsche und Bäume scheinen nur seine Konturen zu sein. Die Birken aber, denen man ansieht, daß sie im Wehen gewachsen sind, zeugen von hundert Sturmtagen und Sturmnächten. Immer wieder findet man sie bei ihm, diese vielzulangen Birken mit den Bewegungen des Windes, dem sie nachgegeben haben und über den sie schließlich doch wieder hinausgewachsen sind in lautlos stehenden Sommertagen. Auch in ruhigen Morgen- und Mittaglandschaften, wenn die Wassergräben einen fröhlichen oder trägen Himmel wiederholen, winden sie sich manchmal hinauf, diese aufgeregten Birkenstämme, wie beunruhigt von ihrer Vergangenheit. Und sie scheinen dann durch ihren bizarren und eigensinnigen Kontrast die Stille ihrer versöhnten Umgebung noch zu vertiefen.
Es sind fast dieselben Motive, die Overbeck auf Radierungen und Bildern verwendet und durch seine Malerei[92] wie durch seine Schwarzweißkunst geht dasselbe Streben, wie ein breiter Strom: Einzelheiten in ihrer ganzen Pracht hinzustellen, ohne dadurch den Gesamtwert aufzuheben. So oder ähnlich hat er selbst früher einmal ausgesprochen was er will. Und er setzt seinen Willen durch. Er hat seine Kunst damit ganz charakterisiert und man tut gut, jenen Satz als Maßstab zu gebrauchen vor seinen Bildern. Man wird gegen sie am gerechtesten sein, wenn man untersucht, in wie weit in ihnen die Absicht des Malers erreicht worden ist. Es ist zu sagen, daß er in vielen Radierungen und in einigen Bildern der Erfüllung sehr nahe gekommen ist. In den Bildern kommt die Farbe hinzu, welche fähig ist, dem Bestreben, Einzelheiten in ihrer ganzen Pracht zu erfassen, sehr zu helfen; aber durch sie wird zugleich die Aufgabe erschwert, über die Einheitlichkeit des Ganzen an keiner Stelle hinauszugehen. Es ist nicht leicht, erhobene Stimmen in gleicher Stärke zu erhalten, und die Freude am Einzelnen ist immer eine Gefahr für den Zusammenhang.
Seltsamerweise sind die Bilder Overbecks, obwohl ihre Farben mit erhobenen Stimmen verglichen werden konnten, von einer eigentümlichen Schweigsamkeit durchdrungen, die kein Laut unterbricht. Es ist schwer zu entscheiden, ob die Farbenstimmen sich gegenseitig aufheben, wie es manchmal mit den Geräuschen des Meeres der Fall ist, die man nicht mehr hört und als die Fülle eines unermeßlichen Schweigens zu empfinden geneigt ist, oder ob dieses Gefühl irgendwie inhaltlich begründet ist und durch den Umstand hervorgerufen[93] wird, daß auf Overbecks Bildern fast nie eine Figur erscheint. Wo eine einmal vorkommt, ist sie so unwichtig, auch räumlich meistens so wenig dringend bedingt, daß man sie ruhig zudecken kann, ohne dem Wesen des Bildes auch nur im Entferntesten Zwang anzutun. Aber seine Landschaften, wenn sie auch ohne Gestalten sind, machen doch nicht den Eindruck der Einsamkeit. Die Mondnächte und Sonnenuntergänge liegen vor einem offen da, als wäre man eben aus der Stube, wo liebe nahe Menschen um ein Feuer beisammen sitzen, herausgetreten. Wohl rührt sich draußen nicht ein Blatt am Baum und es ist, soweit man sieht, niemand zu sehen, nicht einmal ein Hund schlägt an in der Nachbarschaft, aber man ist doch, während man da hinausblickt, ganz erfüllt und gleichsam durchwärmt von dem Bewußtsein jener nahen stillen Stube, in die man jeden Augenblick zurückkehren kann. Und die großen leuchtenden Tage, die er malt, sind lauter Sonntage und die Leute sind dann alle zu Hause oder in der Kirche und ruhen aus vom langen Wochenwerk. Die Blicke feiernder Menschen scheinen auf dieser weiten, kräftigen Natur zu ruhen und aus ihr herauszustrahlen.
Und wie diese farbigen Klänge, die er so liebt, nordisch sind, so ist auch die Schwermut nordisch, die manchmal aufkommt, wo Bäume und Brücken wie von den Schatten unsichtbarer Dinge verdunkelt sind. Es ist jene Schwermut, die manchmal in der Nähe des Meeres herrscht, an sturmstillen Tagen, wenn die Möwen nach Regen schreien. Vielleicht würde dieser Maler auch das Meer[94] malen können und die Berge. Seine Wasserläufe sind breit und schimmernd wie jenes Wasser, nahe bei Bergen, von dem es bei Björnson einmal heißt, »daß man nicht wußte, ob es ein Binnensee war, oder ein Arm des Meeres«. Dort lautet es weiter: »Und dann diese Berge selbst! Kein einzelner Berg war es, sondern Ketten von Bergen, ein Rücken sich stets gewaltiger hinter dem anderen erhebend, als wäre hier die Grenze der bewohnten Welt.« Kann man sich nicht denken, daß Overbeck das gemalt hätte? Ich weiß nicht zu sagen, ob er das Meer einmal gesehen hat und wo es war, aber er hat jedenfalls als Knabe viel von ihm gehört.
In Bremen, im Bureau seines Vaters (der technischer Direktor des Norddeutschen Lloyd war), waren die Wände mit Schiffsmodellen, Plänen und Zeichnungen bedeckt und es wurde fast immer vom Meere gesprochen in diesem geheimnisvollen Raum, von Schiffen, die unterwegs waren, von Schiffen, die heimkehrten und anderen, die sich anschickten, den Hafen zu verlassen. Und später noch, als der Vater, der dem Jungen immer die bunten Bleistifte spitzte, schon gestorben war, da saß er noch oft und baute Maschinen aus Zigarrenkistenholz und zimmerte Schiffe, Schiffe, die unterwegs waren, Schiffe, die heimkehrten, und solche, die sich anschickten den Hafen zu verlassen. Und weil der Vater, an den man immer dabei denken mußte, tot war, so lag eine gewisse Traurigkeit über diesem Tun, vielleicht dieselbe Traurigkeit, die über dem wirklichen Meere liegt, wenn man auf einem[95] Schiffe steht und Abschied winkt oder auch gar niemanden hat, dem man Abschied winken kann, und einfach so hinausfahren muß in die weite, ach so weite Welt. Wie oft mag der Knabe in der Bahnhofstraße jenen Auswanderern begegnet sein, der Bevölkerung jener unbarmherzigen Schiffe, – die, noch betäubt von einer endlosen Eisenbahnfahrt, herausgerissen aus allem, in der fremden Stadt jeden Augenblick stehen bleiben und mit stumpfem Ausdruck zurückschauen, als erwarteten sie, gerufen zu werden. Dann dachte der Junge wohl manchmal, wenn er die Leute zählte und fand, daß es sehr viele waren, daß jetzt irgendwo weit in jener Richtung, aus der sie kamen, ganze Dörfer leer stehen mußten und er sah die verlassenen, kalten Häuser und die lautlosen, seltsam verstörten Gassen, und das war alles immer wieder voll von einer beunruhigenden Traurigkeit und so, als ob man etwas machen müßte, daß es anders würde. Anders war es in dem Leben der Pflanzen und der kleinen Tiere. Da schien es so beängstigende Dinge nicht zu geben. Diese Eidechsen, Käfer, Frösche und Schlangen waren ganz zufrieden, sie bewegten sich eilig oder träge, sprangen oder schlichen am Boden entlang, schnappten etwas auf und lagen dann stundenlang mit atmenden Flanken in der Sonne, und damit ging ihr Leben hin, das nichts Unerwartetes oder Böses zu enthalten schien. Aber auch nur solange sie lebten, waren sie interessant, aufgespießt oder in Spiritus gesteckt, verloren sie alle Wirklichkeit und wurden mit einem Male abstoßend oder langweilig.
Mit solchen Ansichten Naturforscher zu werden, war[96] natürlich ausgeschlossen. Auch reichte weder dafür noch für das Ingenieurfach die mathematische Begabung aus und es blieb nichts übrig als zu den schönen bunten Bleistiften zurückzukehren, die ja schließlich auch die älteste von allen Liebhabereien waren.
So ungefähr sechzehn Jahre mochte der junge Overbeck gewesen sein, als er anfing draußen vor der Natur zu zeichnen und zu malen. Wie wenig ernst seine Mutter übrigens damals seinen Plan, Maler zu werden, noch nahm, beweist der Umstand, daß sie ihm bei einer Dame Unterricht geben ließ, wo der schweigsame junge Mensch unter lauter ähnlich beschäftigten Backfischen eine äußerst merkwürdige Rolle spielte. Inzwischen absolvierte er langsam das Gymnasium und setzte den aufgeregten Bemühungen, die man machte, ihn von der unseligen Idee mit der Malerei abzubringen, nichts als seinen breiten Rücken entgegen, was ihm auch schließlich nach Düsseldorf verhalf. Die Akademie bildete damals natürlich den In begriff alles Heiles für ihn, aber er vergaß, wenn er das später einmal erzählte, niemals hinzuzusetzen: »Jetzt aber nicht mehr.«
Seine Ausdrucksweise hat, wie man sieht, etwas ungemein Überzeugendes und Klares, und diesem Umstand ist es zuzuschreiben, daß er im Jahre 1895, als alle Welt von Worpswede wissen wollte und kein Mensch imstande war, etwas davon zu erzählen, selbst zur Feder gegriffen hat, um in der »Kunst für Alle« von seiner und seiner Freunde Wahlheimat sachgemäß zu berichten. Was er damals geschrieben hat, ist seither oft und oft zitiert worden, aber man wird sich vielleicht[97] trotzdem freuen, einige seiner schlichten Worte, die am besten zeigen können, wie dieser Maler sein Land sieht, hier wiederzuerkennen.
»Ein Hauch leiser Schwermut liegt ausgebreitet über der Landschaft. Ernst und schweigend umgeben weite Moore und sumpfige Wiesenpläne das Dorf, das, als suche es einen Zufluchtsort gegen unbekannte Schrecknisse, sich an dem steilen Hange einer alten Düne, dem Weyerberge, zusammendrängt. Wirr und regellos durcheinander zerstreut liegen Häuser und Hütten, beschirmt von schwer lastenden, moosüberkleideten Strohdächern und knorrigen Eichen, an deren weitausladenden Wipfeln sich machtlos die Stürme brechen. Über dem Dorfe wölbt sich der ›Berg‹, zerklüftet von zahlreichen Rinnsalen, die das abfließende Regenwasser sich ausgewaschen, gekrönt mit einem verkümmerten Eichenbuschwald. In dessen Mitte erhebt sich auf freiem, mit alten Föhren umgebenen Platze ein Obelisk, zum Gedächtnisse Findorfs, des Mannes, der im Anfange dieses Jahrhundertes die Gegend urbar gemacht, das Moor entwässert und dem Verkehr erschlossen hat. Aus wuchtigen Granitquadern aufgeschichtet, ragt das Monument in seltsamer Feierlichkeit gen Himmel. Von der einsamen Höhe schweift weithin der Blick ins Land hinaus, über Moor und Heide, Felder und Wiesen. Dunkle Eichenkämpe, die in ihrem Schatten spärliche Gehöfte der Bauern bergen, unterbrechen hin und wieder die Monotonie der großen Ebene. Wasserläufe blitzen auf und der Spiegel der schlangengleich gewundenen Hamme, darauf in stiller geheimnisvoller[98] Fahrt schwarze Segel durchs Land ziehen. Darüber spannt sich der Himmel aus, der Worpsweder Himmel...«
Es liegt etwas von der monochromen schattigen Tonigkeit seiner radierten Blätter in dieser einfachen Darstellung, etwas Dunkles und Helles, etwas Massiges, als wäre alles bei Einbruch der Nacht gesehen.
Die Farbigkeit Worpswedes aber – soweit sie in Worten ausgedrückt werden kann – hat niemand überzeugender beschrieben, als Richard Muther in seiner glänzenden impressionistischen Technik. Im Herbst 1901 fuhren wir nach Worpswede, an einem früh dämmernden, aber trotzdem stark farbigen Tage, wie es deren in diesem Lande, besonders im Oktober und November, viele giebt.
Muther erzählte im »Tag« davon:
»Eine Fahrt nach Worpswede ist eine Staroperation: als schwinde plötzlich ein grauer Schleier, der sich zwischen die Dinge und uns gebreitet. Gleich wenn man der Zweigbahn entstiegen ist, die von Bremen nach Lilienthal fährt, beginnt ein seltsames Flimmern und Leuchten. Haben diese Bauern einen Farbendämon im Leib? Oder ists nur die Luft, die weiche, feuchtigkeitdurchsättigte Luft, die alles so farbig macht, so tonig und strahlend? Ich blicke auf die blauen Zügel, die mein Kutscher hält. Sie phosphoreszieren und flirren. Ich blicke auf die baumwollenen Handschuhe, auf das tiefrote Brusttuch eines Bauernpaares, das ganz fern auf der Landstraße daherkommt – sie leuchten und strahlen wie von innerem Feuer durchglüht. Da steht[99] ein Arbeiter in hellblauem Kittel neben einem perlgrauen Birkenstamm. Dort hängt an einer Leine ein roter Unterrock, und er sprüht Farbe wie Purpur. Dort ist eine Bauernhütte, blutig rot gestrichen, ähnlich denen, die es in Norwegen giebt. Doch während dort in der dünnen durchsichtigen Luft alles klar sich abzeichnet, wird es in Worpswede zur Tonsymphonie: Diese rote Mauer mit dem saftigen Efeu, dieses hohe, fast bis zum Boden reichende Strohdach, worüber feuchtgrünes Moos sich wie ein Teppich breitet. O dieses Moos in Worpswede! Alle Dinge überspinnt es: nicht nur die Stämme der Bäume, auch das Gebälk der Häuser, die Ziegeln der Backöfen und das Holz der Zäune. Da schillert es citronengelb, dort grüngelb, dort bläulich grün, die ganze Natur in eine Farbenvision verwandelnd...«
So war das Land, als Muther es zuerst sah. Und am nächsten Tage gingen wir zu den Malern.[100]
|
Ausgewählte Ausgaben von
Worpswede
|
Buchempfehlung
Schnitzler, Arthur
Reigen
Die 1897 entstandene Komödie ließ Arthur Schnitzler 1900 in einer auf 200 Exemplare begrenzten Privatauflage drucken, das öffentliche Erscheinen hielt er für vorläufig ausgeschlossen. Und in der Tat verursachte die Uraufführung, die 1920 auf Drängen von Max Reinhardt im Berliner Kleinen Schauspielhaus stattfand, den größten Theaterskandal des 20. Jahrhunderts. Es kam zu öffentlichen Krawallen und zum Prozess gegen die Schauspieler. Schnitzler untersagte weitere Aufführungen und erst nach dem Tode seines Sohnes und Erben Heinrich kam das Stück 1982 wieder auf die Bühne. Der Reigen besteht aus zehn aneinander gereihten Dialogen zwischen einer Frau und einem Mann, die jeweils mit ihrer sexuellen Vereinigung schließen. Für den nächsten Dialog wird ein Partner ausgetauscht indem die verbleibende Figur der neuen die Hand reicht. So entsteht ein Reigen durch die gesamte Gesellschaft, der sich schließt als die letzte Figur mit der ersten in Kontakt tritt.
62 Seiten, 3.80 Euro
Im Buch blättern
Ansehen bei Amazon
Buchempfehlung
Große Erzählungen der Spätromantik
Im nach dem Wiener Kongress neugeordneten Europa entsteht seit 1815 große Literatur der Sehnsucht und der Melancholie. Die Schattenseiten der menschlichen Seele, Leidenschaft und die Hinwendung zum Religiösen sind die Themen der Spätromantik. Michael Holzinger hat elf große Erzählungen dieser Zeit zu diesem Leseband zusammengefasst.
- Clemens Brentano Die drei Nüsse
- Clemens Brentano Geschichte vom braven Kasperl und dem schönen Annerl
- E. T. A. Hoffmann Das steinerne Herz
- Joseph von Eichendorff Das Marmorbild
- Ludwig Achim von Arnim Die Majoratsherren
- E. T. A. Hoffmann Das Fräulein von Scuderi
- Ludwig Tieck Die Gemälde
- Wilhelm Hauff Phantasien im Bremer Ratskeller
- Wilhelm Hauff Jud Süss
- Joseph von Eichendorff Viel Lärmen um Nichts
- Joseph von Eichendorff Die Glücksritter
430 Seiten, 19.80 Euro
Ansehen bei Amazon
- ZenoServer 4.030.014
- Nutzungsbedingungen
- Datenschutzerklärung
- Impressum

![Worpswede: Fritz Mackensen, Otto Modersohn, Fritz Overbeck,Hans am Ende, Heinreich Vogeler [Reprint der Originalausgabe von 1905]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/31vGpoJs1kL._SL160_.jpg)