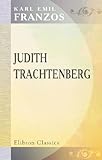Achtes Kapitel
[275] Auf den weiß glänzenden, beschneiten Kuppen des Monte Baldo glühte und schimmerte das Morgenrot, und aus dem Bergtal der Sarka kam der Wind geflogen, der kalte Nordwind, und fegte den See von Nebeln rein und den Himmel von Wolken. Nur noch an den Bergspitzen flatterten die grauen, trübseligen Schleier dahin, wie Trauerflaggen, oder sie bargen sich scheu in einer Schlucht, dicht über der azurnen Flut. Aber auch da erreichte sie die Sonne, als sie endlich emporstieg über dem mächtigen »Altissimo di Nago«, der sich breit und ungeschlacht zwischen die beiden lachenden Landschaften des Etsch- und des Gardagaus schiebt. Das Morgenrot verblich, die Dünste verschwanden, und das goldige Licht spann sich voll und gütig über die Landschaft, über das tiefe Blau des Himmels und der Wasser, über die mattgrünen Wiesen und die grauen oder rötlichen oder violetten Felsen mit den weißen Schneekäppchen und über die engen, winkeligen Gäßchen von Riva, welches sie die »Regina del Garda« nennen, die alte, häßliche Herrscherin eines ewig jungen und schönen Reiches.
Auf dem Balkon des alten, wohl erhaltenen Palazzino, welcher dicht vor Porta San Michele mit seinem schlanken Gemäuer mitten aus dem dichten Grün eines wohlgepflegten Gartens emporsteigt, stand der junge Graf und blickte über das Häusergewirr zu seinen Füßen auf die blaue, fast endlos ausgegossene Flut und das gesegnete Anland mit den weiß schimmernden Hütten. Es war der erste schöne Morgen nach endlosen Regentagen – wie hatte er nach der Sonne geschmachtet und gewähnt, wenn sie nur erst da sei, dann müsse es ihm auch in Herz und Hirn lichter werden. Diese Schatten scheuchte keine Sonne. Er war ein Tor gewesen, wie an jenem Tag vor zwei Monaten, dem leuchtenden Septembertag, da er zuerst dieses Haus betreten[275] und sich gesagt: es sei ja so schön hier, so still und friedlich; hier müsse alle Wirrnis sich klären, alle Unruhe sich sänftigen. Für sein zermartertes Gemüt gab es keine Friedensstätte mehr auf Erden. Und ein Wahn auch war es gewesen, als er vor einigen Wochen, da ihm die Wehmutter den neugeborenen Knaben in die Arme gelegt, zum Himmel emporgestammelt: »Dank dir, Barmherziger, Dank für den Engel, der mich erretten und emporführen soll!« Es war ein schönes, heiteres Kind, mit dem hellen Haar der Mutter, den dunklen Augen des Vaters, und die Amme versicherte, es lache schon, wenn es den Signor Conte sehe – ihm aber war's, als blickten ihn diese dunklen Augen drohend an, als stieße ihn diese kleine Hand noch tiefer in Schuld und Wirrnis hinein.
Es war anders gekommen, als er gedacht, ehe er in die unselige, häßliche Komödie gewilligt, in jener Nacht auf dem Jagdschloß, da er fiebernd am Bett der Kranken gesessen oder in seiner Schlafstube auf und nieder gewandelt. Damals hatte er auf dem Wege, den ihm der Versucher wies, nur ein Schreckbild erblickt: die Entdeckung des Betruges, die Schmach vor der Welt. Wie sich das Zusammenleben mit der Geliebten gestalten sollte, nachdem er ihrer Seele auf diese Weise »künstlichen Schlaf« gebracht, und wie einst das Erwachen sein würde, dahin schweiften seine Gedanken kaum. Das hatte ja Zeit, das mußte sich finden – vielleicht führte auch dieser Weg nicht ins Freie, nur etwa eben in einen Garten, den hohe Kerkermauern umschlossen, aber auch über ihm schien die Sonne und wandelten die Sterne auf und nieder – es war ein Eden gegen die enge, dunkle Marterzelle, in welcher er sich während der Unterredung mit dem Arzte gefühlt, bevor ihm der abgefeimte Mensch den Rat gegeben. Freilich, die Schmach der Entdeckung! Aber war sie wahrscheinlich, und wenn sie hereinbrach, befleckte sie den Namen der Baranowski so sehr wie ein Selbstmord oder gar eine Heirat mit der Jüdin?! Und auch der Geliebten wegen mußte er es tun, es war das einzige Mittel, sie am Leben zu erhalten, zu beruhigen. Wählte er den Tod, so starb sie ihm nach – war dies eine mildere Lösung?
So hatte er eingewilligt und wie erlöst aufgeatmet, als Wroblewski das Schloß verlassen. Auch in den nächsten Tagen kam[276] ihm die Reue nicht. Im Gegenteil, als er sah, wie sein stammelndes Versprechen: »Dein Wille geschieht ... der Priester kommt!« genügte, um die Hinsiechende neu aufleben zu lassen, als er Stunde um Stunde an ihrem Lager saß und dem leisen Schluchzen horchte, in welchem der Krampf der Erregung sanft verzitterte, in ihr Antlitz blickte, welches unter dem Tränenschleier wieder lächeln konnte, da sagte er sich, es sei gut, daß er dies über sich vermocht, und der Ausweg schien ihm sogar viel mutiger, als wenn er sich etwa aus dem Leben weggestohlen hätte. Sie sprachen beide nicht über das Geschehene, nur einmal sagte sie: »Wir wollen einander unsere Sünden verzeihen, du, daß ich dich verlassen wollte, ich, daß du zögertest! Nun aber nur Glück und Treue und Liebe, solange uns Gott das Leben gönnt. Ach! das Leben ist so schön!« Er beugte sich auf ihre Hand nieder und bedeckte sie mit Küssen. Ja! er hatte doch unter all den drohenden Übeln das geringste herausgefunden, und seine Kraft wollte er dareinsetzen, es so gelind als möglich zu gestalten, wenn erst die häßliche Zeremonie vorbei war.
Ihm bangte vor dieser Stunde, je näher sie heranrückte, und er benahm sich wie ein Knabe, der vor unabwendbarer Gefahr steht: er schloß die Augen, sie nicht zu sehen. »Wozu mit dem Menschen sprechen?« wehrte er ab, als Wroblewski eines Nachmittags mit dem Gauner eintraf und diesen vorstellen wollte, »zur Besprechung des Programms der morgigen Vorstellung«. Auch der Aufschub war ihm peinlich; das Kostüm habe der Mensch ja wohl mitgebracht, und sein Kammerdiener Jan könne die Schloßkapelle sofort beleuchten; Jan wisse, was bevorstehe, auch daß er als Zeuge mitwirken solle, nur daß er den Trudka für einen wirklichen Priester halte. Der Kommissär lächelte: »O stürmische Ungeduld des Verliebten! Aber der hochwürdige Herr muß das schöne Kind doch vorher taufen, und ehe er es tauft, sollte er es doch mindestens eine Stunde lang über die Heilslehre unsrer Kirche aufklären!« Der Graf taumelte zurück und starrte ihn fassungslos, ja entsetzt an. Er war kein Frömmler und kein Atheist; er hatte nie über die Religion nachgedacht; er glaubte an Gott und hielt die katholischen Festtage, weil man es ihn so gelehrt und weil es sich für einen Baranowski schickte; wie er in jener Nacht nur daran gedacht, daß sein Vorhaben ein[277] Frevel gegen das Staatsgesetz sei und nicht auch gegen Judith, ebensowenig war ihm das Gotteslästerliche seines Beginnens klargeworden; nun erst faßte und lähmte ihn diese Erkenntnis. Doch das mußte getragen, das Sakrament der Ehe entwürdigt sein, aber jenes der Taufe? Das war ja gleich heilig, ja noch heiliger; er kannte seinen Katechismus. »Taufe?« stammelte er endlich, mühsam nach Fassung ringend, »sie kann ja Jüdin bleiben!« Der Kommissär lachte laut auf. »Bleibt sie ja auch, lieber Graf! Aber wenn wir ihr diesen ersten Hokuspokus nicht vormachen, so glaubt sie an den zweiten nicht. Das Mädel ist sehr gescheit und weiß ganz genau, daß sie vorher Katholikin werden muß, wenn die Ehe gültig sein soll. Also, keine Sentimentalitäten! Und da es Ihnen so gefällt, so wollen wir beides kurz und sofort abmachen!« Der Graf nickte stumm, gab Jan seine Befehle und ging zu Judith. Sie war ja dieser Nachricht in den letzten Tagen von Stunde zu Stunde gewärtig gewesen, und es war ihr eigener Wille, an dessen Erfüllung sie ihr Leben gesetzt; gleichwohl schrak sie zusammen und brach dann in wildes, krampfhaftes Weinen aus. Er faßte ihre Hand und suchte sie zu beruhigen. »Laß nur«, wehrte sie ab, »du kannst es nicht verstehen.« Dann aber schluchzte sie doch: »Sieh, ich weiß ja, nur als Christin kann ich dein Weib werden! Und daß du dich dazu entschlossen, will ich dir mein Leben lang kniefällig danken; das ist ja mein Himmel auf Erden, in den mich deine gütige Hand führt. Aber was vorher kommt, ist für mich die Hölle. Schilt mich nicht, ich sage es nicht aus Haß gegen deinen Glauben und nicht einmal deshalb, weil er mir fremd ist. Selbst mein Vater, der doch gewiß ein treuer Jude ist, pflegt ja zu sagen: ›Wir sind alle Kinder desselben Vaters da oben!‹ Aber bedenke: dieser Schritt scheidet mich doch für immer von ihm und von Rafael. Ich habe von nun ab nur noch dich auf der Welt! Aber nicht aus Mitleid mit mir, sondern mit ihnen muß ich so weinen. Sie haben nun keine Tochter, keine Schwester mehr; deiner Gattin könnten sie die Flucht verzeihen, die Christin ist für sie tot. Ach, was werden sie in ihrem Herzen leiden und von unsern Leuten zu erleiden haben. Ich muß nur immer an die Miriam Gold denken, deren Tochter ja auch an einen Christen verheiratet ist!« Nur stammelnd rangen sich die Worte von ihren[278] Lippen, und die Tränen strömten über die Wangen; ihm war's, als hätte er noch nie einen Menschen so weinen sehen. Stumm, keines Wortes mächtig, stand er neben ihr; was sollte er ihr auch sagen? Daß er ihr diesen Schmerz ersparen wollte? Dann war ja vielleicht das ganze Spiel verloren. Er schwieg, aber so tief hatte ihn die Szene erschüttert, daß er sich selbst kaum aufrechtzuerhalten vermochte, als er die Bebende zur Kapelle führte.
Der einstige Priesterzögling hatte es kurz gemacht, beide Zeremonien in wenigen Minuten erledigt. Und dem Grafen war damals zumute gewesen, als sähe er alles nur durch einen Schleier und höre jeden Ton wie aus weiter Ferne, so wild strömte ihm das Blut gegen den Kopf. Aber wie oft war ihm seither doch dies Bild vor die Augen getreten: die düstere, matt erleuchtete Kapelle, das arme, bleiche Weib an seiner Seite, das Galgengesicht des Menschen im Ornat, zur Seite der Kommissär mit salbungsvoller Miene, der fleißig das Taschentuch gebrauchte, um nicht laut aufzulachen, daneben der alte, treue Jan, in Tränen aufgelöst, weil ein Baranowski eine Jüdin heiratete ... Und wie er so heute auf dem Balkon stand – rings Sonnenglanz und Farbenpracht der südlichen Landschaft – und auf einen Nachen starrte, der eben am Ponalfall vorübersegelte, da war plötzlich alles verschwunden, er sah nur noch die Kapelle zu Borky, und mitten durch das Zwitschern der Vögel im Park klang eine näselnde Stimme in sein Ohr: »Und so erkläre ich euch für Mann und Weib, im Namen ...«
»Ach!« stöhnte er auf, »das war furchtbar! Es hätte nie geschehen dürfen! Das war das schlimmste von allem, was ich damals tun konnte.«
Und nicht um jenes lästerlichen Segens willen sagte er sich dies nun, ein Jahr, nachdem es geschehen. Nun wußte er längst, daß nicht die Sünde gegen Gott sein schwerstes Vergehen gewesen, geschweige denn die gegen das Gesetz. Schon am Morgen nach der traurigen Komödie war ihm dies aufgedämmert. Der Kommissär war abgereist. »Nun aber fort!« sagte er zum Abschied. »Nach Italien oder noch weiter! Erwägen Sie die Gefahr, wenn etwa der rachgierige Bursche, der Rafael, die Anzeige wegen Entführung gegen Sie erstattet, und es erscheint[279] eines schönen Tages hier eine Kommission, welche auch die gnädigste Gräfin ins Verhör nimmt!« Agenor ging sofort zu Judith und sagte ihr, daß sie schon morgen reisen müßten. Sie sei bereit, erwiderte sie, nur müsse der Weg durch ihr Heimatstädtchen gehen.
»Warum?«
»Damit ich meines Vaters Verzeihung erflehen kann.«
Er erschrak; die Kunde seines Todes mußte sie aufs tiefste erschüttern – und war sie erst im Städtchen, dann enthüllte sich auch sicherlich das Geheimnis dieser Trauung. So beschwor er sie denn, sich die Aufregung zu sparen; »es ist ja nutzlos«, schloß er, »du weißt, daß er der Christin nicht verzeihen kann.«
»Ich muß es versuchen!« war ihre Antwort, »das bin ich ihm und mir schuldig. Aber auch dir, Agenor! Mein Vater soll dein Weib nicht für ein ehrloses, leichtfertiges Geschöpf halten. Jagt er die Gräfin Baranowski von seiner Schwelle, dann darf mein Gewissen ruhiger sein!« Ratlos suchte er es ihr auszureden, ohne einen einzigen triftigen Grund ersinnen zu können. Endlich fiel ihm etwas bei, was dafür gelten konnte. »Die Gräfin Baranowski«, rief er, »darf sich nicht der Gefahr aussetzen, von irgend jemandes Schwelle gejagt zu werden. Das bist du mir schuldig!« Und da er sah, daß dies Wort auf sie wirkte, so wiederholte er es immer wieder und beschwor sie, die Ehre seines Namens zu schonen. Sie weinte bitter: »Diese Ehre steht dir höher als die Ruhe meines Herzens«, aber sie fand sich darein und bat nur, dem Vater schreiben zu dürfen. Einige Stunden später brachte sie ihm den Brief und forderte sein Ehrenwort, daß er ihn bestellen wolle. »Mein Ehrenwort!« murmelte er mit bleichen Lippen. Und als er einige Minuten später, nachdem sie gegangen, vor den Kamin trat und zusah, wie die züngelnde Glut den Brief an den Toten verzehrte, da klang die qualvolle Frage in ihm auf: »Wodurch unterscheide ich mich nun noch von jenem Menschen, den ich so sehr verachte?!«
Nur fort – fort! Das war sein einziger Gedanke, bis sie den Wagen bestiegen. Durch die Warnungen des Kommissärs eingeschüchtert, hatte er einen Reiseweg gewählt, der sie rasch aus dem Lande und in abgelegene Gegenden brachte, durch die Bukowina, Siebenbürgen, das südliche Ungarn nach Fiume, von[280] da zu Schiff nach Ancona. Was durch Geld an Bequemlichkeit zu erreichen war, bot er auf; ein Kurier reiste voraus und bereitete alles vor. Dennoch war es eine trübselige Fahrt auf den tief verschneiten Wegen, durch die öden, spärlich bewohnten Bergländer, und kein Gold konnte die elenden Wirtshäuser in behagliche Nachtquartiere wandeln. Auch ging die Reise sehr langsam, nicht bloß der unwegsamen Straßen wegen, sondern weil Judiths Zustand Schonung forderte; sie war so schwach und bleich, und das schmale Antlitz blickte ihn aus dem vermummenden Pelzwerk müde und traurig an. »Wenn wir nur erst in Klausenburg wären!« seufzte sie immer wieder; er hatte ihr gesagt, daß dies die erste Stadt sei, wo sie auf Briefe aus der Heimat rechnen dürften. Aber als sie nun endlich diese Stadt erreicht – womit sollte er sie nun darüber trösten, daß sie noch keine Antwort des Vaters vorfand? Und ihre Tränen bedrückten ihn um so mehr, als auch ihn nur schlimme Nachricht erreichte; der Kommissär schrieb, Rafael habe die Anzeige wegen Entführung erstattet und die Richter durch Bestechung zu ungewöhnlichem Eifer bestimmt; er hoffe die Sache doch noch beizulegen, aber das erfordere große Opfer. Der Graf wies ihm die Summe an – wird es fruchten? mußte er sich angstvoll fragen. Er hatte gleich bei Beginn seiner Reise den Namen eines Grafen Nogila angenommen – nicht gerade ein falscher Name, da derselbe mit zu den vielen Prädikaten der Baranowski gehörte – und seinen Dienern eingeschärft, Judith den neuen, den Leuten den alten Namen nicht zu verraten; er hielt das letztere für ausführbar, da sie ja kaum mit Fremden sprach. Nun, während dieser unerquicklichen Rast in Klausenburg enthüllte es ihr ein Zufall, und sie befragte ihn. In seiner Bestürzung fand er keine Antwort, er war der Lüge nicht gewohnt; es währte lange, und ihr Bangen war schon aufs höchste gestiegen, als er ihr endlich sagte: »Du sollst alles wissen! Wir hoffen vergeblich auf einen Brief der Deinen; sie zürnen uns und lassen uns durch die Gerichte verfolgen, weil ich dich, die Minderjährige, ohne ihre Zustimmung zu meinem Weibe gemacht. Schwer ist die Strafe nicht, die uns treffen kann; daß ich ihr dennoch aus dem Wege gehe, um unser aller willen, wirst du begreiflich finden.« Nun glaubte sie ihm wieder; ihre Tränen bewiesen es[281] ihm und ihr verzweifelter Ausruf: »Also müssen wir für immer heimatlos bleiben!« Nein, tröstete er, nur bis sich jener Zorn gelegt, und darauf hoffe er. »Vielleicht ist Gott barmherzig!« erwiderte sie. »Wie furchtbar wäre sonst mein Los, und wie könnt ich das Leben ertragen, wenn ich wüßte, daß du meinetwegen auf immer um Glück und Heimat und Ruhe gekommen!« Die Klage traf ihn schwer, schwerer als vorhin ihr Mißtrauen – sie sprach ja die Wahrheit, nur daß es seine eigene Schuld war. Und dazu der Zwang, täglich, stündlich lügen zu müssen und vor der Entdeckung der Lüge zu zittern. Da hatten sie, auf der Reise durchs Banat von einem Schneesturm überrascht, Zuflucht in einem Schloß am Wege suchen müssen, und die Besitzerin, eine alte, ungarische Edelfrau, hatte sie freundlich aufgenommen. »Wie heißen Sie?« fragte sie die junge Frau im Geplauder nach dem Souper. Judith errötete tief. »Nogila«, stammelte sie endlich. »Das weiß ich ja«, erwiderte die alte Dame, »ich meinte mit dem Vornamen!« Judiths Verlegenheit wuchs; hilfeflehend blickte sie Agenor an. »Aber Judith«, rief er und zwang sich zu einem Lachen, »du wirst doch wissen, wie du heißt!« Als sie dann allein waren, brach sie in Tränen aus. »Ach!« schluchzte sie, »nicht einmal meines Namens bin ich mehr sicher. Du nennst mich noch immer Judith, aber da mich der Priester Maria getauft, so dacht ich, ich müßte andern diesen Namen nennen, und schwankte doch wieder.« Vielleicht mehr als all ihre Klagen und Tränen zeigten ihm diese Worte, wie es um sie stehe, und Mitleid erfüllte sein Herz, Mitleid mit ihr und sich selbst.
Aber damals konnte er noch solcher Stimmungen Herr werden. Wie er gewähnt, daß sich die Schatten lichten müßten, wenn nur die Komödie vorbei sei, und dann, wenn sie das düstere Borky im Rücken hätten, so erhoffte er nun alles von Italien. Er hatte als blutjunger, sorgloser Offizier einige Monate dort verweilt; als ein Paradies von Licht und Wonne lebte ihm das Land in der Erinnerung, dort mußte alles Weh und Düster enden. Und gänzlich wenigstens schien ihn diese Hoffnung nicht zu trügen. Er hatte sie zunächst nach Florenz geführt und eine der herrlichen Villen vor Porta al Prato gemietet; wie die Ruhe, die milde Luft des Südens dem jungen Weibe wohltat, daß ihre Wangen sich röteten, ihre Augen heller strahlten, so schien[282] sie auch im Gemüt heiterer und ruhiger; es gab sogar Stunden, wo sie wieder lachen und scherzen konnte, wie es ihrem Alter entsprach. Das wirkte auf seine Stimmung zurück; auch er fühlte sich glücklicher oder suchte es doch zu scheinen, und als sie ihm nach einem schönen Tag, den sie in Fiesole verbracht, um den Hals fiel und erglühend ein holdes Geheimnis zustammelte, da jubelte er auf – jubelte, weil er sie liebte, weil er aus ganzem Herzen dies reine Glück für sie herbeigesehnt, welches sie mit neuen, starken Banden an das Leben fesseln sollte. Nun konnte er auch leichteren Mutes die Briefe des Kommissärs lesen, welcher immer häufiger schrieb, die Gefahren, die durch Rafael drohten, schwarz ausmalte, auch bekümmert klagte, wie unverschämt nun Trudka in seinen Forderungen werde. Er kannte ja den Mann: ein Erpresser, der die Maus zum Elefanten machte – aber gleichviel, dies Peinliche war ja mit Geld abzumachen, und er war reich, hielt sich wohl auch für reicher, als er war. Schwerer traf es ihn, als mit dem Beginn der wärmeren Jahreszeit die Reisenden aus Rom und Neapel nach dem kühleren Florenz strömten und in den Straßen der Stadt, den Alleen der Cascinen zuweilen auch ein bekanntes Gesicht auftauchte: ein ehemaliger Kamerad aus der Armee oder ein Standesgenosse aus Galizien. Die verheirateten Herren, die würdevoll, mit Gemahlin und Töchtern, in der Carozza an ihm und seiner Gefährtin vorbeifuhren, starrten ihn wohl neugierig an, schienen ihn jedoch nicht zu erkennen; nur die Junggesellen oder Strohwitwer grüßten mit eigentümlichem Lächeln. Die Zahl dieser Begegnungen häufte sich, der Aufenthalt ward ihm immer unbehaglicher, gleichwohl zögerte er mit der Abreise, weil sich Judith hier wohl zu fühlen schien und der Ruhe bedurfte. Da mußte er sich doch dazu entschließen. Eines Tages wurde ihm eine Karte gebracht; Baron Viktor Oginski – es war ein Genosse aus der Jünglingszeit. Erfreut empfing er den alten Freund, auch Oginski begrüßte ihn herzlich, dann jedoch begann er sehr ernst: »Da du unter einem Inkognito reisest, so willst du offenbar unbeachtet bleiben, und selbst die Sehnsucht nach dir hätte mich nicht so indiskret gemacht, dich aufzusuchen. Aber als dein Freund hielt ich mich dazu für verpflichtet. Du wirst um deiner Gefährtin willen in der Stadt viel beredet.«[283]
»Wen geht es etwas an«, fuhr Agenor auf, »wie und in wessen Gesellschaft ich leben will?!«
»Niemand«, war die Antwort, »solange nicht damit die Vermutung einer Handlungsweise verknüpft ist, welche einen Schatten auf dich werfen könnte. Man kennt deine Ansichten über Standespflichten und die Herkunft jener Dame, darum hat bisher niemand geglaubt, daß du mit ihr vermählt seiest, und es nur als Zeichen einer allerdings weit getriebenen Feinfühligkeit gedeutet, daß du sie deiner Dienerschaft gegenüber als deine Gattin gelten läßt. Aber nun hat dein Jan, als ihn ein anderer polnischer Lakai mit seiner Leichtgläubigkeit hänselte, hoch und heilig geschworen, er sei selbst Tauf- und Trauzeuge gewesen, und das hat sich hier rasch herumgesprochen. Ernstlich geglaubt wird es ja dennoch nicht, aber man ist stutzig geworden, und so gebietet mir denn meine Freundschaft, dich selbst zu fragen.«
»Ich danke für deinen guten Willen«, erwiderte Agenor, »muß jedoch jede Antwort ablehnen.«
»Das ist schlimmer als ein Ja«, warnte Oginski, »die Sache bleibt unklar und wird damit der Klatschsucht zum unersättlichen Stoff.«
»Dennoch muß ich dabei bleiben.«
Oginski griff nach seinem Hut. »Dann kann ich dir, als dein Freund, nur den Rat geben, insolange als du keine klare Antwort geben willst, an Orten zu leben, wo dich niemand kennt.« Zwei Tage später folgte Agenor diesem Rate.
Es war zu Ende April, und die Reise ging über Mailand an die Seen – Licht und Duft und Schönheit, wohin das Auge blickte – aber als das Paradies, welches Wunder bewirken könne, erschien ihm nun Italien nicht mehr. Er hatte unter dem Eindruck jener Unterredung sein Wiener Bankhaus als Adresse seiner Briefe bestimmt, niemand in Galizien sollte wissen, wo er verweilte, und so schwer lastete die Demütigung auf seinem Gemüte, daß er nach kurzem Verweilen in Bellagio, obwohl ihm hier noch kein Bekannter begegnet, weiter hastete, bis er einen bescheidenen, spärlich besuchten Ort erreicht. Zu Iseo am gleichnamigen See machten sie wieder Rast – für wie lange, fragte er sich verzweifelt.
Dann, als Woche um Woche still und ohne Störung verstrichen,[284] faßte er sich wieder, wenigstens insoweit, um Judith nicht seine Stimmung ahnen zu lassen, aber ganz gelang es ihm nicht. Und es war nicht allein der Widerschein dieser Stimmung, wenn sie seit der Abreise von Florenz lange Tage in düsterem Brüten verbrachte. Sie weinte nicht mehr, aber dieser stumme, verhaltene Jammer war tiefer, als es der laute gewesen, und auch die Fieberschauer kamen wieder. Der österreichische Stabsarzt, der zuweilen auf Agenors Wunsch aus Brescia herüberkam, schüttelte den Kopf: »Ein heiteres Gemüt kann ich leider nicht verschreiben. Sprechen Sie einmal ernstlich mit Ihrer Frau Gemahlin. Vielleicht ist es nur das Bangen vor ihrer schweren Stunde; man trifft das bei jungen Frauen zuweilen.« Agenor zögerte lange, bis er endlich die Frage wagte. Sie schwieg, und erst als er nicht abließ, sie mit Bitten zu bestürmen, erwiderte sie: »Und wenn es so wäre? Muß eine Frau, die ihres Vaters Fluch belastet, nicht vor der Stunde zittern, wo sie Mutter werden soll?« Er versuchte sie zu trösten, sprach von Gottes Barmherzigkeit. »Gott?!« brach sie leidenschaftlich aus. »Ja! wenn ich zu ihm sprechen, zu ihm flehen, wenn ich beten könnte, Agenor! Aber ich kann nicht! Wenn mich sonst irgendein Leid bedrückte, eine Sorge, eine Schuld, dann griff ich zu meinem Gebetbuch und sprach zu dem Gott meiner Väter. Nun habe ich kein Gebetbuch mehr ...«
»Aber denselben Gott«, wandte er ein, und der Formeln bedürfe es nicht. Sie schüttelte finster das Haupt. »Das habe ich mir selbst gesagt, aber es nützt mir nichts! ... Ach, wie soll ich's dir nur erklären, was in meinem armen Kopfe vorgeht?! Man muß doch eine Sprache haben, in der man betet; die alte habe ich verlernt, und die neue kenne ich nicht ... Du hast mich in viele Kirchen geführt, um die schönen Bilder oder die Höhe der Wölbung zu bewundern; wie mir dabei zumute war, hast du nie gefragt. Mich fröstelte, wenn wir aus dem Sonnenschein in die kühlen Hallen traten; bis ins Herz hinein fröstelte es mich. Es war mir alles so fremd, so unheimlich – wie werd ich je in einer Kirche beten lernen? Vielleicht stünde es besser um mich, wenn man mir alles recht erklärt hätte, aber ich weiß ja nichts von eurem Glauben, ich kann nicht einmal ein Kreuz schlagen, und wenn ich's könnte, wie dürfte ich's tun? Was weiß ich von dem[285] Gekreuzigten mehr, als daß er ein abtrünniger Rabbi war, um dessenwillen alle, die meines Blutes sind, noch heute Schmach und Verfolgung erleiden müssen?!«
Er mußte schuldbewußt sein Haupt beugen; nun verstand er, daß jene Taufe nicht bloß eine Sünde gegen den Gott seines Katechismus gewesen, sondern auch ein Frevel an einer armen, sehnsüchtigen, dürstenden Menschenseele. Was sollte er sagen, wie sie aufrichten?! Es gab nur eines, woran er sie mit Recht mahnen durfte: ihre Pflicht gegen das junge Leben, das unter ihrem Herzen keimte. Und als er davon sprach, da wich denn auch die Starrheit aus ihren Zügen, und sie fand die Tränen wieder. »Wirst du dich des Kindes freuen?« fragte sie. »Wird es dir nie zur Last sein?« Und da ihm sein Herz darauf die rechten Worte eingab, so verfehlten sie ihre Wirkung nicht. »Ich will stark sein«, versprach sie und hielt Wort.
Nun kamen wieder Tage, da sie lächeln und sich wenigstens auf Stunden all der Schönheiten um sie her freuen konnte. Auch er schüttelte sein Bangen vor der Welt insofern ab, als er kleine Ausflüge mit ihr unternahm, nach Brescia, an den Gardasee, nach Verona. In dieser Stadt, im Garten der Franziskaner, wo sie einen Steintrog als »tomba di Giulietta« bewundern mußten, erlebten sie eine so heitere Stunde, wie sie ihnen seit jenem leuchtenden Tage in Fiesole nicht mehr vergönnt gewesen. Sie sollte trüb genug enden; während sie so übermütig durch die Gemüsebeete wandelten, welche um den Trog angelegt sind, zuckte Agenor plötzlich zusammen und drängte zur Rückkehr ins Hotel, dann zur Abreise; ihm sei nicht ganz wohl, schützte er auf ihre Frage vor. Aber als Judith eine halbe Stunde später aus dem Hotelzimmer auf die Straße blickte, wo eben ihr Wagen angeschirrt wurde, erkannte sie den wahren Grund: da stand ein Herr und sprach mit Jan, der mürrisch Antwort gab, in polnischer Sprache; derselbe Herr war vorhin, ohne daß sie seiner viel geachtet, im Garten der Franziskaner gewesen. Sie wurde sehr bleich, sagte aber nichts, und erst zwei Tage später, da Agenor, ihre Verstimmung gewahrend, neuerdings einen Ausflug vorschlug, wehrte sie dies bitter ab: »Du könntest wieder unwohl werden! ... Verzeih!« schluchzte sie dann auf, »ich weiß, auch du bist nicht glücklich! Du, der daheim der geachtetste[286] Mann gewesen, wagst dich nun in der Fremde nicht unter Menschen, damit dich kein Landsmann sehe und daheim erzähle, daß die Jüdin dein Weib geworden ist. Ich frage nicht, ob das wirklich eine so bittere Schmach ist und ob sie dadurch geringer wird, indem du sie selber dafür hältst, mir genügt es zu wissen, daß du um meinetwillen unglücklich bist ... Wie elend muß ich mich da fühlen!«
»Gedenke des Kindes!« bat er wieder, er hatte nun keine andere Beschwörungsformel mehr, aber auch die hatte ihre Wirkung eingebüßt.
»Gerade weil ich seiner gedenke«, rief sie verzweifelt, »bin ich doppelt elend. Das Kind der Frau, die dir zur Last ist, das dich noch enger an sie fesselt, wie solltest du es lieben können! Du hast bisher nur der Stunde unserer Trauung geflucht, bald wirst du auch der Stunde seiner Geburt fluchen!« ... Sie waren beide unglücklich geworden, ins tiefste Herz hinein unglücklich, und es gab kein Ende dieses Jammers, nur neuen Jammer, neue Schuld ...
»Ich war schlecht ... ich war wahnsinnig!« murmelte der junge Mann vor sich hin, während er so dastand und zusah, wie die verregnete Landschaft immer heller aufleuchtete im Glanz der Spätherbstsonne. »Welches von beiden mehr, ich weiß es nicht ... Und was soll ich ihr sagen, wenn sie mich wieder fragt, wann das Kind getauft wird?!«
Das war seine nächste, drückendste Sorge, aber es war nicht die einzige, die ihn quälte. Er hatte bisher die Erpressungen des Kommissärs kaum geachtet, nun mußte er sich nachgerade der Gefahren bewußt werden, welche seiner Zukunft, der blanken Ehre seines Geschlechts durch diesen Vampir drohten. Und wie sollte das Ende sein?! Er wollte Judith nicht verlassen, sie nicht aus ihrem gläubigen Wahn erwecken – nein! nein! Aber konnte er sein Leben hier verbringen, müßig und schimpflich – ein Flüchtling, der vor jedem Gendarmen zusammenzuckte, ob der Mann nicht nach den Papieren des Grafen und der Gräfin Nogila fragen werde, und sich auf der Straße an jedem Reisewagen vorbeidrückte, weil vielleicht ein Bekannter darin saß. So ging es nicht weiter, und doch – gab es einen Ausweg?!
Ein helles Stimmchen ließ ihn aus seinem Brüten emporfahren:[287] unten im Garten vor dem Hause ging die italienische Amme, die dicke Annunziata, auf und nieder und suchte das wimmernde Kind durch Gesang einzulullen. Dann hörte er Judiths Stimme, die nach der Amme rief; sie war wohl schon im Frühstückszimmer und harrte seiner. Er richtete sich auf, strich mit der Hand übers Antlitz, als wollte er die Spur seiner kummervollen Gedanken davon entfernen, und ging ins Erdgeschoß.
In der Tür des Frühstückszimmers trat ihm die Amme entgegen. Er beugte sich über seinen Knaben nieder, der ihn aus weitgeöffneten dunklen Augen ernsthaft, wie nachdenklich, anstarrte, und drückte einen Kuß auf seine Stirn. Als er seinen Blick erhob, begegnete er dem Judiths, der scharf, wie prüfend auf ihm ruhte. Er verstand diesen Blick, die Unglückliche, dachte er, beaufsichtigt mich, mit welcher Miene ich das Kind küsse! ... So unbefangen, als ihm möglich, bot er ihr den Morgengruß. An ihren Augen, an der Blässe ihrer Wangen sah er, daß sie wohl auch diese Nacht viel geweint. Und warum es geschehen – ach, er brauchte sie nicht erst darnach zu fragen!
Er setzte sich ihr gegenüber, schlürfte den Tee und begann mit gepreßter Stimme den schönen Morgen zu preisen. »Wie ein Frühlingstag bei uns!« schloß er. »Und wir sind tief im Spätherbst.«
»Ja!« erwiderte sie mit zitternder Stimme, »es ist der 30. November.«
»Schon?!« erwiderte er gleichmütig. »Wie rasch die Zeit ...« Er brachte den Satz nicht zu Ende. Ihr seltsamer Ton kam ihm ins Bewußtsein, und als er sie ansah – »Mein Gott!« rief er und setzte sich neben sie und zog sie in seine Arme. »Verzeih! ... Wie ich's nur vergessen konnte! Unser Hochzeitstag ...«
Sie erwiderte nichts; schluchzend hing sie an seinem Halse und weinte still vor sich hin. »Laß nur«, murmelte sie, als er sie zu beruhigen suchte, und drückte ihr Antlitz fester an seine Schulter. »So ist's am besten ...«
Dann aber trocknete sie ihre Tränen und entwand sich sanft seinen Armen. »Nun setz dich wieder mir gegenüber«, bat sie, »und laß uns vernünftig sprechen. Wir wollen einander das Herz nicht schwer machen, Agenor, und nicht verbittern. Wir wollen nicht fragen, wie uns dies Jahr vergangen und ob es so[288] hat sein müssen. Aber wie soll es nun werden? Gedenkst du hier zu bleiben?«
»Gewiß – wenigstens den Winter über«, erwiderte er rasch. »Das heißt – wenn es dir so gefällt. Sonst könnten wir ja nach dem Süden gehen, etwa nach Sizilien ...«
Sie schüttelte den Kopf. »Und nach dem Norden? Nach Hause, Agenor?«
»Du weißt«, sagte er gepreßt, »daß dies unmöglich ist!«
»Nein«, erwiderte sie, »ich weiß es nicht, sondern glaube es dir nur. Aber siehst du selbst da ganz klar? Du sagst, daß dich meines Vaters Klage vor den Gerichten bedroht, weil du mich ohne seine Zustimmung geheiratet. Aber die Strafe kann unmöglich groß sein, und entehrend ist sie sicherlich nicht!«
»Für einen Mann meines Standes ...«, begann er.
Sie hob abwehrend die Hand. »Nicht so!« bat sie. »Für einen Mann deines Standes ziemt es sich auch, den ererbten Besitz selbst zu verwalten, und vor allem ziemt es sich für ihn, jedem Menschen frei ins Auge zu sehen und sich nicht vor allen, die ihn kennen, im verborgensten Winkel eines fremden Landes zu verstecken. Ist es also wirklich nur die Furcht vor dieser Strafe, so kann ich dich nur um deinetwillen anflehen: Laß uns heimkehren!«
»Ich habe mich schon erkundigt«, sagte er unsicher. »Wenn die Strafe wirklich gering ist ...«
»Du kannst schlecht lügen«, fiel sie ihm ins Wort. »Hättest du dich erkundigt, die Antwort wäre dir längst zugekommen. Aber es ist wohl nicht so sehr die Furcht vor der Strafe als vor der Schmach, mit der jüdischen Gattin heimkehren zu müssen ...«
»Nein! nein! wie oft soll ich's dir beteuern?«
»Was ist es sonst? Wir gehen ja beide daran zugrunde, Agenor! Begreifst du nicht, was ich bei dem Gedanken empfinde: Solange mein Vater lebt, dürfen wir nicht heimkehren, weil sein Zorn dich bedroht! Sieh, daß er uns zürnt, weiß ich ja; er hat auch meinen zweiten Brief unbeantwortet gelassen ...«
»Du hast ihm geschrieben?« rief der Graf erblassend.
»Ja, wenige Tage vor meiner Niederkunft, als ich mein Bangen nicht mehr bezwingen konnte. Und es stehen Worte in dem Brief – – gewiß, er zürnt mir sehr, wenn er darauf schweigt. Dennoch flehe ich dich an, laß es mich mündlich versuchen ...«[289]
Er hörte sie nicht; sein Antlitz war immer fahler geworden, je mehr er sich die Folgen dieses Briefes ausmalte ... Nun ist alles verloren, dachte er, sie wissen um den Betrug ... »Wie konntest du dies tun?« murmelte er.
»Was?« schrie sie auf, und ihr Auge flammte. »Du wagst mir aus diesem Brief einen Vorwurf zu machen? Bist du kein Mensch? Hast du keine Eltern gehabt? Und du sagst, daß du mich liebst!«
»Nein, nein!« wehrte er bestürzt ab. »So war es nicht gemeint ... Du hast ja recht, wir müssen an die Heimreise denken. Aber doch nicht vor dem Frühling. Eine Winterreise mit dem zarten Kinde – vom Gardasee nach Galizien –, das wäre ja Wahnsinn. Denke doch an unsere Reise bis Fiume!«
»Da schlugst du einen besonders mühseligen Weg ein. Wir könnten über Wien gehen.«
»Auch die Alpen sind im Winter unwirtlich genug. Bedenke, wenn dem Kinde etwas geschähe. Das sollst du nicht auf dem Gewissen haben!«
»Wann also willst du reisen?«
»Sobald es drüben Frühling wird.«
»Im April. Gut. Dein Ehrenwort, Agenor?«
Sie werden mich wohl schon weit früher hier verhaftet haben! fuhr es ihm durchs Hirn. »Mein Ehrenwort!« sagte er.
»Und noch eins! Wann soll die Taufe des Kindes sein? Es ist nun sechs Wochen alt. Die Amme klagt mir, daß sie um des kleinen Heiden willen von den Leuten viel gehänselt wird.«
»Es soll baldmöglichst geschehen«, versprach er. »Ich sagte dir schon: ich habe keine Papiere mit, die meinen wirklichen Namen ausweisen. Ich schrieb um sie, aber sie sind noch nicht eingetroffen. Es ist so weit hin!«
»Ja, weit!« seufzte sie tief auf und starrte vor sich hin. »Nütze doch den schönen Tag«, fügte sie dann hinzu. »Fahr auf den See hinaus!«
»Du begleitest mich nicht?« Sie verneinte. Er faßte ihre Hand, sie war kalt. »Judith!« begann er, »was immer kommen mag ...« Aber die Kehle war ihm wie zugeschnürt, er konnte den Satz nicht zu Ende bringen. Stumm verließ er das Zimmer.
Mechanisch griff er nach dem Hut und schlug den Weg zum[290] See ein. Dann, während er so langsam, gesenkten Hauptes dahin ging, war nur ein Gedanke in ihm: wie etwa noch die Gefahr abzuwehren sei, welche dieser Brief über ihn gebracht. Etwa durch schleunige Flucht nach Sizilien, nach Ägypten? Aber war wirklich die Anzeige bei den Gerichten gemacht und nahmen diese die Sache ernst, dann nützte ihm die Flucht nichts mehr; dann war auch schon ein Steckbrief hinter ihm erlassen, und es blieb ihm nur noch eins übrig: eine Kugel vor den Kopf oder ein Sprung in die klare, unergründlich tiefe Flut um ihn. Denn als ihm dieser Gedanke kam, da saß er – kaum wußte er selbst, wie dies zugegangen – in einem Nachen, den sein Lieblingsferge, ein brauner, hübscher Junge, lenkte ... »Nicht so tief hinabbeugen, Signor Conte«, hörte er ihn plötzlich sagen, »das bringt den Nachen aus dem Gleichgewicht.« Er richtete sich wieder auf. Nein, das durfte nicht eher sein, als bis es eben unbedingt nötig war, schon um des armen Weibes willen ... »Zurück!« befahl er, und während ihm so das Städtchen wieder aus den Wogen entgegenwuchs, suchte er seine Gedanken zu ordnen. Er hatte nur einen Weg offen: er mußte den Kommissär benachrichtigen, ihm die nötigen Mittel anweisen, die Sache bei den Gerichten totzumachen. Der Mensch vermag nach dieser Richtung viel, dachte er, und wird es um seiner eigenen Haut willen tun! Daß und auf welche Weise Herr Wroblewski aus dem Amte geschieden, war ihm nicht bekannt; der Ehrenmann hatte wohlweislich geschwiegen, und Michael Stiegle schrieb keine Zeile, die ihm nicht unbedingt nötig schien.
Er eilte heim und begann hastig den Brief. Aber schon nach wenigen Zeilen entsank die Feder seiner Hand. »Wie abscheulich dies ist«, dachte er, »wie feig! ... Wer mir gesagt hätte, wessen ich noch fähig sein würde ... Häßlich, häßlich!« knirschte er und ballte die Faust, daß die Nägel schmerzhaft ins Fleisch drangen. Aber dann griff er doch wieder zur Feder, es mußte ja sein. Freilich, lange genug währte es, bis er Worte für den bedenklichen Auftrag gefunden. Er kuvertierte den Brief, fügte eine Anweisung an Stiegle bei, dem Kommissär zehntausend Gulden zu bezahlen, kuvertierte nochmals und gab das Ganze in einen Umschlag, der die Adresse des Wiener Bankhauses trug. »Auch das ist feig und verkniffen«, murmelte er in qualvoller[291] Selbstverachtung. »Und wann soll dies Lügen und Betrügen ein Ende haben?« Der Gedanke an die Taufe seines Kindes fiel ihm wieder schwer aufs Herz. Das unehelich geborene Kind der Jüdin Judith Trachtenberg mußte eigentlich nach dem Josephinischen Gesetz Jude werden; kein katholischer Priester durfte es taufen, ehe nicht die Mutter schriftlich ihre Einwilligung gegeben. Und als Graf Nogila oder Baranowski trug den Knaben kein Priester in die Matrikel ein, ehe der Trauschein der Eltern vorgelegt war. Was sollte er tun? Abermals ein Verbrechen begehen? Die Wahrheit gestehen? Und da keines von beiden möglich war – wie lange noch konnte er dem Drängen der Mutter standhalten?!
Der herrliche Tag war für den Grafen der trübste, den er je erlebt, und als die Sonne glorreich über den Hügeln ob Torbole sank, daß See und Anland in roter, tiefer Glut loderten, da sah er ihr bange nach – sie hatte ihm heute Schlimmes gebracht, aber was erst beschien sie vielleicht morgen?! Er fand erst spät den Schlaf, und häßliche Träume quälten ihn.
Als der Graf erwachte, stand die Sonne schon hoch am Himmel. Sein Diener Jan stand vor ihm. Der alte Mann sah verstört aus. »Verzeihung, daß ich Sie geweckt habe«, stammelte er, »aber die Frau Gräfin liegt in tiefer Ohnmacht, und ich« – er rang die Hände –, »ich alter Esel bin schuld daran!«
»Was ist geschehen?« rief Agenor und fuhr hastig in die Kleider.
»Weil ich nämlich nicht lesen kann!« fuhr der Alte weinerlich fort. »Sonst hätte ich ja die Adresse verstanden und den Postvermerk – und hätte ihr den Brief nicht gegeben ...«
»Welchen Brief?« rief der Graf, zitternd vor Erregung, und faßte ihn an den Schultern.
»Nämlich – sie hat mir ja diesen Brief vor mehreren Wochen gegeben, noch ehe unser Prinzchen zur Welt gekommen war. ›Jan‹, sagte sie, ›auf die Post – gegen Schein!‹ Ich gebe ihn also auf. Nun komme ich heute an den Schalter, unsere Post zu holen – es ist aber nur die Zeitung da, und ich will schon gehen, da sagt mir der Beamte: ›Herr Jan‹, sagt er, ›diesen Brief bekommen Sie zurück; in das Land, wo der Adressat jetzt ist‹, sagt er, ›geht noch vorläufig die Post nicht.‹ Ich frage nicht weiter[292] und nehme den Brief, komme damit zur Frau Gräfin, die sitzt schon im Frühstückszimmer, und wie sie den Brief ansieht, schreit sie auf: ›Mein Vater!‹ und sinkt ohnmächtig hin. Nämlich der Brief war an ihn, und auf der Rückseite steht: ›Adressat verstorben!‹ Das sagt die Hania, die kann ja lesen, und ich alter Esel ...«
Der Graf hörte ihn nicht mehr, er war bereits auf dem Weg zum Frühstückszimmer. Die Zofe Hania stand vor der Tür. »Die Frau Gräfin ist bereits bei Bewußtsein«, meldete sie, »will aber allein bleiben und hat mir befohlen, niemand zu ihr zu lassen ... Auch Sie nicht!« fügte sie bei, als er die Klinke ergriff. Er schob sie beiseite und trat ein.
Die Unglückliche lag auf der Diele hingestreckt; in wirren Strähnen hing das gelöste Haar über das fahle, starre Antlitz. Er stürzte auf sie zu, sie hob langsam den Kopf und stützte sich auf die Arme auf und sah ihn an – mit einem Blick, daß er unwillkürlich stehenblieb und die Lider senkte; in dies starre Auge konnte er nicht sehen. »Geh!« sagte sie leise, kaum verständlich, aber der Ton ging ihm durch Mark und Bein. Wie ein Verurteilter wankte er hinaus.
Auch den Tag über durfte er sie nicht sehen; sie blieb in ihrer Schlafstube und, wies Speise und Trank von sich. Der Graf war ratlos, aber der Hania, die sehr an der Herrin hing, kam ein guter Einfall. Entschlossen nahm sie am Abend das Kind auf den Arm, trat vor die Herrin und flehte sie an, sich zu fassen. Sie hoffte, Judith dadurch aus der Starrheit ihres Schmerzes zu erlösen, zu Tränen zu bewegen. Das zwar gelang ihr nicht, aber Judith streichelte das Kind und ließ sich bewegen, etwas Suppe zu nehmen. Einige Stunden später – es ging doch schon auf Mitternacht – ließ sie auch Agenor holen.
Zaghaft kam er herein, und als er an ihr Lager trat und in ihr Antlitz blickte, da wollte ihm das Herz stillestehen vor Mitleid und Reue. »Judith«, murmelte er, »wenn du wüßtest, was auch ich leide ...«
Sie nickte. »Angenehm ist's dir nicht«, sagte sie hart. »Aber ich will dir keine Vorwürfe machen. Ich habe dich rufen lassen, weil ich einiges wissen muß. Du wirst mir die Wahrheit sagen. Du glaubst an Gott, Agenor, und wirst mich in solcher Stunde nicht belügen!«[293]
»Judith«, bat er, »rege dich heute nicht noch mehr auf. Denke an unser Kind.«
»Eben darum«, erwiderte sie. »Ich werde sonst wahnsinnig ... Antworte, Agenor, wann ist mein Vater gestorben?«
Er wollte eine ausweichende Antwort geben, versichern, daß er es nicht wüßte, unter dem Bann dieser Augen vermochte er es nicht. »Vor etwa einem Jahre«, sagte er.
»Oh!« Es war ein einziger kurzer Laut, ein Laut furchtbarer Seelenqual. Dann schloß sie die Augen und lag schwer atmend da.
»Judith!« murmelte er und suchte ihre Hand zu fassen.
»Still!« zischte sie. »Still! ... Ich bin seine Mörderin gewesen ... Die Wahrheit, Agenor! Am Tage nach meiner Flucht ist er gestorben?«
»Nein«, beteuerte er, »einige Wochen später ...«
»Gleichviel, aus Gram über mich ... Warum logst du, daß er uns verfolge?«
»Das war keine Lüge! Er selbst hatte noch die Gerichte gegen uns angerufen, und seit seinem Tode betreibt Rafael die Sache. So wurde mir vom Hause geschrieben ...«
»Möglich! Rafael ist ein guter Sohn, er sucht seines Vaters Tod an den Mördern zu rächen ... Wenn er wüßte, wie überflüssig das ist! ›Mein ist die Rache‹, spricht der Herr. Wenn er wüßte, wie Gott selbst dies Werk begonnen hat ... Und er wird's vollstrecken, ich fühl es ... Das arme, schuldlose Kind!« schrie sie auf.
Er sank zu Füßen ihres Lagers nieder und hob die gefalteten Hände zu ihr empor. »Eben um des Kindes willen, Judith ... Es kann noch alles gut werden ...«
Sie schüttelte finster den Kopf. »Auf Fluch und Lüge baut sich kein Glück auf ... War er schon tot, als ich dir angetraut wurde?« fragte sie dann.
Er schwieg.
»Darum also durft ich damals nicht heim! Aber schreiben ließest du mich und gabst dein Ehrenwort, daß du den Brief bestellen wolltest. Dein Ehrenwort, Graf Agenor Baranowski!«
»Erwäge, in welcher Lage ich damals war. Du warst kaum[294] genesen, der Arzt hatte vor jeder neuen Aufregung gewarnt ... Du kannst und darfst mich darum nicht verachten!«
»Aber war dies deine einzige Lüge? ... Steh auf«, befahl sie, »blick mir ins Auge! ... Bin ich dein Weib, bin ich Christin?«
Er fühlte, wie ihm alles Blut zum Herzen strömte. »Aber so erinnere dich doch ...«
»Ich weiß ... Aber mir schwankt der Boden unter den Füßen – mir ist's, als müßte ich auch daran zweifeln, was meine eigenen Augen gesehen, meine eigenen Ohren gehört haben. Und dann – was weiß ich von euren Bräuchen? Vielleicht war alles ungültig, ein Betrug, mich am Leben zu erhalten. Denkbar wär's, dein Freund und Ratgeber war ja ein Schurke ... Wenn es ein Betrug war, so gesteh es wenigstens jetzt. Ich werde mich nicht töten, ich versprech es dir. Denn dann hätte ja mein Kind keinen Vater mehr, und ich müßte ihm wenigstens die Mutter erhalten ... Ich will die Wahrheit wissen. Wenn ich keine Christin bin, so werde ich doch wieder beten können und meinen Vater betrauern in unserer Weise. Du müßtest der Schlechteste aller Menschen sein, Agenor, wenn du jetzt noch lügen könntest. Antworte, ich frage nochmals: Bin ich Christin, bin ich dein Weib?«
Er fühlte seine Knie wanken und griff nach dem Bettpfosten, sich zu halten. Wild brauste das Blut in seinen Ohren, das Herz stand still. Vielleicht nur eine Sekunde zögerte er mit der Antwort, es dünkte auch ihm eine unerträglich lange Zeit. Und als er endlich sprach, da war's ihm, als hörte er eines anderen Stimme, so verändert klang sie: »Ja! Du bist eine Christin und mein Weib!«
|
Ausgewählte Ausgaben von
Judith Trachtenberg
|
Buchempfehlung
Lewald, Fanny
Jenny
1843 gelingt Fanny Lewald mit einem der ersten Frauenromane in deutscher Sprache der literarische Durchbruch. Die autobiografisch inspirierte Titelfigur Jenny Meier entscheidet sich im Spannungsfeld zwischen Liebe und religiöser Orthodoxie zunächst gegen die Liebe, um später tragisch eines besseren belehrt zu werden.
220 Seiten, 11.80 Euro
Im Buch blättern
Ansehen bei Amazon
Buchempfehlung
Geschichten aus dem Biedermeier III. Neun weitere Erzählungen
Biedermeier - das klingt in heutigen Ohren nach langweiligem Spießertum, nach geschmacklosen rosa Teetässchen in Wohnzimmern, die aussehen wie Puppenstuben und in denen es irgendwie nach »Omma« riecht. Zu Recht. Aber nicht nur. Biedermeier ist auch die Zeit einer zarten Literatur der Flucht ins Idyll, des Rückzuges ins private Glück und der Tugenden. Die Menschen im Europa nach Napoleon hatten die Nase voll von großen neuen Ideen, das aufstrebende Bürgertum forderte und entwickelte eine eigene Kunst und Kultur für sich, die unabhängig von feudaler Großmannssucht bestehen sollte. Für den dritten Band hat Michael Holzinger neun weitere Meistererzählungen aus dem Biedermeier zusammengefasst.
- Eduard Mörike Lucie Gelmeroth
- Annette von Droste-Hülshoff Westfälische Schilderungen
- Annette von Droste-Hülshoff Bei uns zulande auf dem Lande
- Berthold Auerbach Brosi und Moni
- Jeremias Gotthelf Die schwarze Spinne
- Friedrich Hebbel Anna
- Friedrich Hebbel Die Kuh
- Jeremias Gotthelf Barthli der Korber
- Berthold Auerbach Barfüßele
444 Seiten, 19.80 Euro
Ansehen bei Amazon
- ZenoServer 4.030.014
- Nutzungsbedingungen
- Datenschutzerklärung
- Impressum