Anmerkungen
1 Auf diese Stelle hat Asoko sich gegen Ende seiner letzten Säuleninschrift bezogen, wo er sagt: Tata cu lahu se dhaṃmaniyame, nijhatiyā va bhuye: »Da ist denn das geringfügig, rechte Tugend: tiefe Einsicht ist wohl mehr.«
2 Die klar bewußte falsche Aussage, Lüge, wird im 25. Itivuttakam als der erste Schritt zu aller Übeltat angegeben: ganz im Einklang, wie ROBERT L'ORANGE richtig erkannt hat, mit dem Worte SCHOPENHAUERS über den Meineid, Paralipomena § 133 Mitte.
3 Zu samārambho Inangriffnehmen, Anlegen, gehört insbesondere prāṇānaṃ anāraṃbho Kein Wesen angreifen, verletzen, bei Asoko auf der letzten Säuleninschrift gegen Ende; auch auf den Felseninschriften I, III, IV, XI, passim.
4 Die von Tanz und Musik begleiteten dramatischen Darstellungen, deren hier Erwähnung getan, reichen sicher schon in ṛgvedische Zeiten hinauf. Später zu regelrechten Yātrās geworden, »Volksstücken mit Tanz und Gesang« wie wir cum grano sagen könnten, erfreuen sie sich noch gegenwärtig breiter Beliebtheit: während leiser klingende Dramen, kunstvolle Dichtungen wie akuntalā, Ratnāvalī etc. nie eigentlich für die bunte Menge, immer zunächst reine kaṇṭhasthās waren, Werke zum Vortrag nur für sich selbst, wie etwa wir unseren Hamlet oder Faust innehaben und auch dergleichen nicht gern öffentlich, nach der ach so bekannten town-crier Art von der Bühne herab anhören mögen; wo hingegen die echten plunderfrohen Yātrās und Possen in allen Gestalten, von der Tingeltangeldame und dem dummen August bis zu den Theatralika der Gralsritter, als leicht verständliche mehr oder minder gefällige Personifikationen oder über- und unterhaltende Spiegelbilder aus aller Welt, hier durchaus am Platze sind. In diesem praktisch aristotelischen Sinne lieben also auch die Inder ihre Festspiele und Yātrās, deren uralte nugatorische Entstehung, beiläufig bemerkt, im Viṣṇupurāṇam V Kap. 13 prachtvoll veranschaulicht ist; nicht übel wiedergegeben von A. PAUL, Krischnas Weltengang, 5. Andacht. – Über altindische Musik s. Lieder der Mönche Anm. 398, sowie unsere Anm. 523 und 651.
5 sobhaṇakam mit den barmanischen Handschriften zu lesen, desgl. dhovanam.
6 hatthatthare vielleicht auch in der Mittleren Sammlung S. 616 zu beachten.
7 Vergl. Bruchstücke der Reden Anm. 106.
8 Cf. Mittlere Sammlung Anm. 140 als ύστεροπρωτον.
9 Solche hic et ubique nämliche Äußerungen der Polyhistorie und Pedanterie hat einmal ROBERT L'ORANGE ungemein treffend gekennzeichnet als »krankhafte Eitelkeit, Misanthropie und Unaufrichtigkeit: das sind Symptome einer heimlichen Krankheit, die ich sehr wohl kenne, da ich sie selbst durchgemacht habe; es ist die unglückliche [625] Liebe zur Sophia, die man den Unglücklichen schon am Gesicht absehn kann – ein Sehnen ohne Befriedigung, ein Durst ohne Stillung:
Nennt ihr 's doch selber Philosophie,
Spottet eurer selbst und wißt nicht wie.«
10 Der Maulwurf gilt infolge seines ungemein feinen Gehörs, von dem PLINIUS X, § 191 meint, daß es das menschliche an Helligkeit übertreffe, seit den dunkelsten Zeiten als das erlesene Tier der Wahrsagerei. In den Ruinen von Hissarlik hat SCHLIEMANN, nach gütigen handschriftlichen Mitteilungen OTTO KELLERS in Prag, eine Maulwurfsfigur aus Ton sieben Meter unter dem Boden ausgegraben, Trojanische Altertümer II 188 No. 3450. Im weiteren Verlaufe der klassischen, mir gern zur Verfügung gestellten Nachweise bemerkt dann der ausgezeichnete Forscher: »Man schrieb dem geheimnisvollen chthonischen Tiere und der von ihm aufgeworfenen Erde besondere Heilkräfte zu. Wer z.B. Maulwurfserde, terra talparum, in die Hand nahm und dazu eine bestimmte Zauberformel sprach, konnte sein Pferd von Viperbissen heilen (PELAGONIUS § 283).« Die alten Magier, berichtet wiederum PLINIUS XXX, § 3, hätten den Maulwurf ohne Vergleich jeder anderen Weissagung aus Eingeweiden u.s.w. vorgezogen, sie hielten kein Tier für besser geeignet zu religiöser Kunde: ut si quis cor eius recens palpitansque devoret, divinationis et rerum efficiendarum eventus promittant. DE LORENZO, dem ich letzteren Hinweis mit verdanke, und ETTORE ROMAGNOLI in Catania machen mich freundlich noch aufmerksam, daß dieser Glaube auch später überliefert ist, so in den »Api« des LEO dem X. befreundeten RUCELLAI, v. 558: »La talpa cieca, che la Magìa adora.« Freilich denkt man bei solcher Verehrung alsbald an HUME'S Γετας τους αϑανατιζοντας und was damit zusammenhängt, Bruchstücke der Reden Anm. 3151. Vergl. auch die nur so ganz verständliche, tief wehmütige Ironie, wann Hamlet den Verborgenes enthüllenden unterirdischen Geist mit »old mole« anspricht. Auf unsere Magier wieder und deren Jünger bezieht sich Henry IV 1, 3, 1 i.m.:
...telling me of the moldwarp and the ant,
Of the dreamer Merlin, and his prophesies; etc. –
Zu mūsikācchinnam Maulwurfloch cf. mūṣikotkaras, mūṣikasthalam Maulwurfhügel. Bemerkenswert ist auch die nach anderer Seite entwickelte Bedeutung mūsikukkuro Maushund, d.i. Kaninchen, Mittlere Sammlung S. 606, in der siamesischen Ausgabe p. 379 Ende. – Maulwurf = mūwërf ist also kaum von  merda, mulda, vielmehr von
merda, mulda, vielmehr von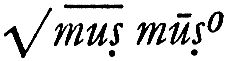 mus, mul ursprünglich abzuleiten; nb die Nebenlinie ital. muso. Hier gehört endlich noch her, daß der Mūṣikarathagaṇe as ohne Zweifel dem Απολλων Σμινϑιος Χρυσευς innig verwandt ist: die feine Schnauze, die bis in die entlegensten Winkelgänge vordringt und Verborgenes zutage fördert, ist unser gemeinsam uraltes tertium comparationis. Sollten nicht etwa auch die Musen ihre mānasī siddhi als apollinische Mäuse und Maulwürfe erworben haben? Die glücklichen geistigen Anlagen einer wohlbekannten musikalischen Begabung und Vorliebe helfen den Bund mit verschwistern.
mus, mul ursprünglich abzuleiten; nb die Nebenlinie ital. muso. Hier gehört endlich noch her, daß der Mūṣikarathagaṇe as ohne Zweifel dem Απολλων Σμινϑιος Χρυσευς innig verwandt ist: die feine Schnauze, die bis in die entlegensten Winkelgänge vordringt und Verborgenes zutage fördert, ist unser gemeinsam uraltes tertium comparationis. Sollten nicht etwa auch die Musen ihre mānasī siddhi als apollinische Mäuse und Maulwürfe erworben haben? Die glücklichen geistigen Anlagen einer wohlbekannten musikalischen Begabung und Vorliebe helfen den Bund mit verschwistern.
In der christkatholischen Kirche wird die Beschwörung der Mäuse u.s.w. auch heute noch mit folgenden frommen Wünschen vorgenommen: »Exorcizo vos pestiferos mures, per Deum Patrem † omnipotentem, per Jesum Christum † Filium ejus unicum, per Spiritum † Sanctum ab utroque procedentem, ut confestim recedatis a campis et agris nostris, nec amplius in eis habitetis, sed ad ea loca transeatis, in quibus nemini[626] nocere possitis: pro parte omnipotentis Dei, et totius curiae coelestis, et Ecclesiae sanctae Dei vos maledicens, ut, quocumque ieritis, sitis maledicti, deficientes de die in diem in vos ipsos, et decrescentes; quatenus reliquiae de vobis nullo in loco inveniantur, nisi necessariae ad salutem et usum humanum. Quod praestare dignetur, qui venturus est judicare vivos et mortuos, et saeculum per ignem. Qui fecit coelum et terram. Amen.« So gegeben im Benedictionale Romanum, Appendix ad Rituale p. 115 sequ: zu Regensburg neu approbiert am 14. Juli 1901. Ähnlich lehrreich ist ib. die benedictio ensis oder der Waffensegen, wovon gleichfalls oben, freilich anders, die Rede ist, und mancherlei mehr, das an alten atharvischen Zauber zurückmahnt, Auguren und Runen überdauert hat.
11 ādāsapañho gehört zur maṇikā vijjā: cf. Anm. 243.
12 mahat, mahān: es ist Indras gemeint, der von sich sagt: aham asmi mahāmaho, 'bhinabhyam udīṣitaḥ, nach der Ṛksaṃhitā X 119, 12; vergl. auch den Titel Maharddhi in Anm. 273.
13 Vor bhūrikammaṃ mit S bhuttikammaṃ zu lesen.
14 Hervorragende ärztliche Kenntnisse kann man wiederholt in der Mittleren Sammlung beiläufig bemerken: vergl. Anm. 339 die Nachweise.
15 adhimuttipadāni auch mit S zu lesen. – Vergl. Mittlere Sammlung 552f., wo im gleichen Sinne von der Zukunft die Rede ist.
16 Vergl. hier das merkwürdige Wort jenes Mannes, der in seiner Art unzählbare Ausdrucksmöglichkeiten des Lebens hienieden und unter und ober uns bis zu verdämmernden Sternenkreisen in immer neuer, feinerer, geistigerer Fülle und Weite heiter entdecken und, nicht als ein tätig Leidender, sondern taub nach außen wie der Asket in der Einigung, eben darum als ein selig innen Schauender sagen mochte: »O es ist so schön, das Leben tausendmal leben!«; denn dem Symphoniker, der in der Neunten Sphäre froh die Sonnenbälle nach sicherem Gesetze auf Oktavenbahnen sich selber zum ewigen Spiele Quadrille tanzen läßt, war allmählich die Variation einer weltweisen Erkenntnis schon aufgegangen: zu sehn sind jene tausend Leben freilich schön, aber sie zu sein ist ganz etwas anderes. Cf. hierzu Bruchstücke der Reden Anm. 709.
17 Zu dieser Ansicht von Geschick und Bestimmung, Notwendigkeit, der niyati, dem vidhiḥ u.a.m. gehört nebenbei das Dilemma vom schlimmen und vom glücklichen Zufall, Mittlere Sammlung S. 782f. u. 788; cf. noch ib. Anm. 126 und Anm. 128. Nach der letzteren kommen hier und im Folgenden auch die Satkāryavādinas mit ihrer giebelständigen Gründung zu Worte, wie schon GARBE in seiner Sāṃkhyaphilosophie S. 5, 6, 13 u.s.w. mit BÜHLER bemerkt hat. All diese Priester und Asketen, die Seele und Welt als ewig auslegen, sind übrigens im Bṛhadāraṇyakam III 7, 4 als ātmavidas und lokavidas angedeutet und sind in der Bṛhaddevatā, ed. MACDONELL VII 71, unserem Texte schön entsprechend, als ātmavādinas zusammengefaßt: und zwar ausdrücklich nach alter Überlieferung. Die Zuverlässigkeit dieser Angabe wird übrigens noch durch das jinistische Ātmapravādam bestätigt.
18 Mit S imehi zu lesen, desgl. S. 18 etc.
19 Mit S evaṃgatikā bhavanti etc.
20 Der Beginn des Zusammenballens der Welt ist der Anfang vom Ende einer Äon. Davon spricht auch Asoko auf der vierten und fünften Felseninschrift, Girnār Zeile 8f. und 2f., wo er sagt, wie seine Söhne und Enkel und Urenkel den rechten Wandel nach ihm bis an das Ende der Äon durchführen werden. Und wirklich scheint der unvergeßliche Lapidarstil, in welchem jener König der Vorzeit immer noch so großartig uns anspricht, den Nachkommen so etwas anzudeuten als wie: es kann die Spur von [627] seinen Erdetagen nicht in Äonen untergehn. – Die alsbald oben dargestellten selbstleuchtenden Wesen und ihre Eigenschaften sind so zu sagen Postulate der praktischen Vernunft: vergl. Mittlere Sammlung S. 901.
21 Mit S etc. so pi zu lesen. – Der hier entwickelte brahmā sayampabho antalikkhacaro hat in der vedischen Sphäre des antarikṣaṃ svayaṃbhu seinen Schwerpunkt. Obzwar in finsterer Öde kreisend ohne Tag und Nacht wunschglühend parame vyoman, nach der Ṛksaṃhitā X, 129, hält dieses allmählich sinkende Wesen sich, wie oben weiterhin folgt, für den Vater von allem u.s.w.: doch ist ein solches Dafürhalten eben nur ein Wahn, eine gewisse mangelhafte Erinnerung, offenbar auch eine himmlische Gedächtnisschwäche. Denn der liebe Brahmā wird in der 49. Rede der Mittleren Sammlung heimgesucht und freundlich belehrt, daß es noch drei fernere Arten des Daseins gebe, wohin sein Kennen und Sehn nicht reicht: »Es gibt, Brahmā, eine leuchtende Art des Daseins: aus dieser verschieden bist du hier erschienen, wo dir im Laufe deines ungemein langen Verweilens die Erinnerung daran entschwunden ist; daher kennst du und siehst sie nicht, die ich kenne und sehe. – Und es gibt, Brahmā, eine strahlende Art des Daseins, und es gibt, Brahmā, eine gewaltige Art des Daseins: die kennst du nicht und siehst sie nicht, die ich kenne und sehe. Und somit bin ich dir, Brahmā, nicht nur nicht gleich an Erkenntnis, geschweige daß ich unter dir stände, sondern bin dir weit überlegen.« Von seiner Umgebung dann freilich, die gleichfalls an mangelnder Erinnerung leidet, wird der Gott in seinem Irrtum bestärkt, als ob er wirklich der ›Herr von Absolut‹ wäre: wie oben seine weitere Lebensgeschichte zeigt. Vergl. auch später Anm. 245; bei EMPEDOKLES:
Σφαιρος κυκλοτερης μονιηι περιηγει γαιων.
22 Zu vasavattī cf. die paranimmitavasavattī devā, die jenseit unbeschränkter Freude selbstgewaltigen Götter der 11. Rede, während der Kommentar mißverständlich erklärt: vasavattī ti, sabbaṃ janaṃ vase vattemi.
23 tena bhotā brahmunā mit S, C etc. zu lesen. – Dieser brahmā ist jetzt oben der aus den Upanischaden bekannte geistige svayaṃbhūḥ geworden. Übrigens heute noch in Nepāl mit verehrt. Bei uns als »der liebe Gott« populär, von dem JESUS als »der erste und einzige glaubwürdige Mensch«, wie ROBERT L'ORANGE einmal sagte, »behauptet hat, daß er ihn kenne und sehe, daß er sich an ein früheres Leben beim Gotte erinnere: ›Ich bin ja vom Gotte (εκ του ϑεου) ausgegangen und gekommen, nicht aber von mir selbst hergekommen‹, ›Denn du hast mich geliebt ehe die Welt gegründet ward‹, ›Ich bin von oben herab‹, u. dergl. m.« JESUS ist demnach in dem eben hier angegebenen, gemeinsam abfolgenden Falle gewesen, sich nur bis dahin und nicht weiter zurückerinnern zu können. Wie später aus der 13. Rede, im Gespräch mit Vāseṭṭho, hervorgehn wird, hat Gotamo, nach L'ORANGES Worten, »diesen Gott und diese Gottheit durch und durch gekannt, konnte daher den kürzesten Weg dahin zeigen: denn es ist immer besser, man geht dahin, als daß man nirgendwohin, im schlechten Sinne, gehe.« Dazu schließen sich als schönster Kommentar drei Erkenntnisse HERAKLITS an, deren letzte lautet: Ανϑρωπους μενει τελευτησαντας ἁσσα ουκ ελπονται ουδε δοκεουσιν, bei DIELS fragm. 25-27. Als Nebenstufe oder Seitenflügel ist hier noch das Dilemma vom bösen Schöpfer, pāpiko issaro, und vom gütigen Schöpfer, bhaddako issaro, aus der 101. Rede der Mittleren Sammlung S. 783 und 788 zu vermerken.
24 khiḍḍāpādosikā zu lesen.
25 Diese Geister, die manopādosikā, geben mit den vorigen khiḍḍāpādosikā den Inbegriff [628] der vedischen oberen und unteren Welthälfte an, der rodasī oder rodhasī: die dyāvāpṛthivīvantas, zwischen Himmel und Erde Auf- und Abschwebenden; später sind sie zu lo kantarikā, Wesen der finsteren Zwischenwelten, geworden, Mittl. Sammlung S. 919. – Ein Anklang im HESIOD, Erga v. 109-126. Sehr schön von DIOTIMA im Symposion p. 202 erklärt: Και γαρ παν το δαιμονιον μεταξυ εστι ϑεου τε και ϑνητου.
26 An diesen alten Spiritualismus halten sich auch heute noch die Tarkamīmāṃsakās; cf. Tarkasaṃgrahasūtram 18: Sukhaduḥkhādyupalabdhisādhanam indriyaṃ manaḥ, tacca pratyātmaniyatatvād anantaṃ paramāṇurūpaṃ nityaṃ ca.
27 Die hier gegebenen vier Antinomien von der Endlichkeit und Unendlichkeit u.s.w. der Welt reichen in gerader Linie bis zum Puruṣasūktam der Ṛksaṃhitā X 90 hinauf. Der tausendhäuptige Urgeist, heißt es da, hatte die Erde überall durchdrungen, spṛtvā, wie richtig mit den Vājasaneyinas und nach der Mittleren Sammlung S. 899 überliefert wird: und er ragte zehn Ringe über sie empor; er eben ist dieses Ganze, u.s.w.; ein Teil von ihm sind alle Wesen: drei Teile von ihm sind Ewigkeit im Himmel; dreiteilig oben aufgegangen ist der Urgeist: ein Teil von ihm blieb aber hüben. Während nun in diesem Liede weiterhin die mächtig verschlungenen kontrapunktorischen Themen bis zur Sonne, die aus dem Auge hervorgeht, erklingen, hat unser Text oben sich mit dem knappen, gewissermaßen schon kritischen Ausdruck der vier Thesen begnügt.
28 Vergl. Mittlere Sammlung S. 555. – Ähnlich Midsummer Night's Dream V 3: »His speech was like a tangled chain, – nothing impaired, but all disordered.« Aber das richtige glückliche Gegenstück ist die berühmte sokratische Gedankenentbindung, seine Maieusis, deren ganze Kunst er bei der Behandlung der gebärenden Geister bis zum Abschneiden der Nabelschnur, επι τῃ ομφαλητομιᾳ, so sicher zu handhaben versteht, Theaitetos 149f.
Der buddhaghosische Kommentar weiß natürlich der amarā, die zwar im Saṃskṛt recht bekannt ist, von keiner Seite beizukommen: na maratīti amarā sinniert er zuerst, apariyantavikkhepo aniyamitavikkhepo zuletzt, nachdem er ohne Rat und Hilfe in der Mitte herumgetappt hat, aparo nayo: amarā nāma macchajāti, sā ummujjananimmujjanādivasena udake sandhāvamānā gahetuṃ na sakkā ti, evam evādi – eine Auskunft etwa so schlau wie die unserer eigenen Schulsäcke: »Gräfenwart bekam seinen Namen von den vom Grafen der fliehenden Gräfin nachgerufenen Worten: ›Gräfin warte!‹«: nur Doppelbeispiel zur vergleichenden Seelenkunde indogermanischer Siebenschläfer.
29 Mit S ahañ ce kho pana zu lesen.
30 Mit S iti tena zu lesen.
31 Die hier vorgetragene Lehre der Syādvādinas oder Skeptiker umfaßt auch, wie ROBERT L'ORANGE erkannt hat, den naiven Idealismus, der da sagt no c'assaṃ, no ca me siyā, na bhavissāmi, na me bhavissati: im Saṃyuttakanikāyo XXII No. 152 in seine Bestandteile aufgelöst, ib. No. 90 auf dem mittleren Pfade zwischen den beiden Enden »Alles ist« und »Alles ist nicht« überwunden.
32 adhiccasamuppannikā, von vi + adhi, smaraṇe. Cf. das Ego cogito, ergo sum, Bruchstücke der Reden, Anm. 917. Der Kommentar hat adhītya mit adhitya verwechselt, vergl. Mittlere Sammlung Anm. 88.
33 asaññīsattā mit S. Noch in Nepāl, z.B. im Divyāvadānam p. 505, als asaṃjñisattvās angeführt. In den Upanischaden als turyātītam = unmananam erklärt, und tasmān mano vicāryate oder yāty unmanībhāvam; wie Brahmabindūpaniṣat v. 4. Bei uns hat ECKHART gesagt, »man sol got suchen mit vergezzenheit und mit unsinnen«: wobei letzteres auch etymologisch das Upanischadwort vollkommen wiedergibt.
[629] 34 santatāya mit S etc.; C sattatāya.
35 Das uddham āghātanam, oben Anschlagen, ist eine schöne altindische Metapher, gehört zu den Gleichnissen der ruti und Smṛti wie ūrdhvaṃ gacchati nach oben gehn, ūrdhvasrotās der nach oben Strömende, ūrdhvaretās dessen Same nach oben schlägt, d.h. über die Welt hinaus, der drüben wurzelt, ūrdhvamūlas; gegen hundert Belegstellen in Colonel JACOBS Upaniṣadvākyako as, Bombay 1891, s.v. ūrdhvādi. Hier folge nur ein Beispiel aus der Bṛhadāraṇyakā IV 48 (BÖHTLINGKS Text IV 4 11 ist verderbt, cf. die indischen Ausgaben):
Aṇuḥ panthā vitataḥ purāṇo,
māṃ spṛṣṭo 'nuvitto mayaiva:
tena dhīrā api yanti brahmavidaḥ,
svargaṃ lokam ita ūrdhvā vimuktāḥ.
Gotamo selbst hat Bild und Begriff nach seiner Weise angewandt, in der 53. Rede der Mittleren Sammlung, wo der unterwiesene, heranreifende Jünger, dem bebrüteten noch in der Eischale eingeschlossenen Küchlein verglichen, allmählich sich entwickelt, erwächst, heil wird, »ja bis oben an die Verschalung gelangt ist«, ap' uccaṇḍatāya samāpanno, fähig zur Durchbrechung, fähig zur Erwachung, fähig die unvergleichliche Sicherheit zu finden. – Vergl. hier noch ein anderes, aber nicht minder zuständiges Bild SCHOPENHAUERS, Paralipomena § 140 i.f.: » ... es ist die Welt der Endlichkeit, des Leidens und des Todes. Was in ihr und aus ihr ist muß enden und sterben. Allein was nicht aus ihr ist und nicht aus ihr sein will durchzuckt sie mit Allgewalt wie ein Blitz, der nach oben schlägt, und kennt dann weder Zeit noch Tod.« Auch BRUNO, am Ende seiner Widmung des Hauptwerkes al proprio spirto, hat ebenso den Stempel vom flammenden Durchschlag geprägt:
At mage sublimeis tentet natura recessus,
Nam tangente Deo fervidus ignis eris.
Es ist der Durchbruch, auf den wir im Grunde jeden Illuministen und Lichtbringer als attadīpo und dīpankaro zunächst sich vorbereiten sehn, nachdem er bei sich angeklopft hat, mit der Frage:
Du Erdengeist, kennst du die Macht,
Was eine Menschenbrust vermag?
Ich breche durch. Nach dieser Nacht
Was kümmert mich ein neuer Tag.
36 Aus einem solchen oder solchen der acht Urstände, die da sämtlich auf mehr oder minder haltlosem adhyāropas oder einer μεταβασις εις αλλο γενος beruhn, sind die vielgeschäftigen Untersuchungen der gewöhnlichen Priester und Büßer vor- und nachgotamidischer Zeiten und leider auch der meisten hellenischen Denker sowie endlich aller unserer Pastoralphilosophen und Psychologiekanoniker herzuleiten.
37 sato sattassa mit S, C etc. zu lesen.
38 Dieses Selbst ist der sthūlabhuk caturātmā, der Grobes genießende vierfache Ātmā, in der Nṛsiṃhottaratāpanīyopaniṣat mit am Anfang überliefert. Von ARISTOTELES als vegetative Seele oder Lebenskraft sehr schön beschrieben, De anima II 4.
39 Ist der sūkṣmabhuk caturātmā, der Feines genießende u.s.w., l.c.; der νους, oder wenn man will der λογος.
40 Vergl. Kaṭhopaniṣat 6 5 yathādar e tathātmani, s.v.a. das Leuchten und Wiederleuchten der eigenen Natur ECKHARTS, ed. JOSTES p. 2.
[630] 41 Vergl. die vedischen Nachweise hierzu Mittlere Sammlung, Anm. 210. – ECKHART sagt: »di sel ist aller dinge stat und sie hat selb chein stat.« Es ist nach Überwindung der Raum- und Zeit(Bewußtsein)-Sphäre die Aufhebung der Kausalität: eine fernere Staffel auf dem Wege zur Erwachung; aber eben nur Staffel, zur Übung taugliche Vorstufe, nichts weiter, wie l.c. dargetan und 490 als unzulänglich verworfen, nach gotamidischer Erkenntnis.
42 Mit S hier immer yaṃ tvaṃ ... tam ahaṃ zu lesen. – Die vier zuletzt angegebenen Stufen stellen die Weltseele in immer höherer Betrachtung dar, nach der Nṛsiṃhottaratāpanīyopaniṣat neuntem Abschnitt, ja schon nach der Kaṭhopaniṣat III 15 als a abdamaspar amarūpam. Nb noch das wundervoll entsprechende Stück aus der Bṛhadāraṇyakā IV 4 2, wo der arūpajñaḥ erklärt wird, mit dem Ende ekībhavati, na vijānātīty āhuḥ.
43 Besser mit S zu lesen paramadiṭṭhadhammanibbānappatto hotīti.
44 Diese hier vorgebrachten zweiundsechzig Urstände scheinen die Grundlagen all der verschiedenen Ansichten und Lehren über die Welt u.s.w., wie ruti und Smṛti sie geben, in einem großen Rahmen zusammenzufassen; die Satzung Gotamos kann endlich als die dreiundsechzigste und letzte gezählt werden, nach Sabhiyos Annahme von dreiundsechzig Asketenmeistern in v. 538 der Bruchstücke der Reden. Eine ebenso einteilende Reihenzahl ist auch sonst noch überliefert: bei den Jainās als die kosmologischen triṣaṣṭi alākāpuruṣās, im Vāyupurāṇam 26 28 als die kosmogonischen varṇās:
nānāvarṇāḥ svarā divyam
ādyaṃ, tacca tadakṣaraṃ:
tasmāt triṣaṣṭivarṇā vai
akāraprabhavāḥ smṛtāḥ.
ROBERT L'ORANGE freilich hat von einem höheren Standpunkte die zweiundsechzig gegebenen Ansichten als »alle in Zeit und Raum möglichen diṭṭī« betrachten mögen.
45 Gesicht, Gehör, Geruch, Geschmack, Getast, Gedenken. – Mit S besser phussā phussā zu lesen.
46 Mit S, C etc. sukhumacchiddakena zu lesen, auch besser udakarahadam und dann sabbe p'ete.
47 na naṃ dakkhinti mit S und C. – Das hier gegebene, vollständig ausgeführte Gleichnis spielt auf die Bṛhadāraṇyakā IV 3 41 an: yathāmraṃ bandhanāt pramucyeta, evam evāyaṃ ārīrādi; wie denn auch der in dieser Upanischad alsbald folgende Vergleich mit dem Karren in derselben Weise von Gotamo auf sich selbst angewandt und ausgeführt worden ist, gegen Ende des zweiten Teils unserer 16. Rede. Eben die vollkommene Ausführung der Gleichnisse ist, nach der 27. Rede der Mittleren Sammlung, Merkmal des Meisters. Mit den letzten Worten aber von der Sichtbarkeit nur des Leibes u.s.w. hat Gotamo die urasketentümliche Anrede jener Vorgänger anklingen lassen, die schon nach der Ṛksaṃhitā X 136 3 von sich gesagt hatten:
arīred asmākaṃ yūyaṃ
martāso abhi pa yatha:
die Leiber nur an unserstatt,
ihr Erdensöhne, seht ihr da.
48 Vergl. Mittlere Sammlung S. 360: dann S. 919 u. 922 mit der Variante »zehntausendfach«; ib. 900 »hunderttausendfach«. – Im Mahāvastu I 40 dafür trisāhasramahāsāhasro lokadhātuḥ, i.e. trimilliograndimilliarium universum. – Zu brahmajālam =[631] brāhmaṇajālam nb schon Atharvasaṃhitā X 5 1-2 brahmayogas gegenüber kṣatrayogas. Ein Hinweis in LANMANS Ausgabe von WHITNEYS Kommentar etc., Harvard Oriental Series VIII 580.
Wie oben »Priesternetz« mit als gemeinsamer Titel angegeben ist, hat bei uns einmal ähnlich ein alemannischer Dichter des fünfzehnten Jahrhunderts für seine zusammenfassende Darstellung aller Stände und ihrer Ansichten und Gepflogenheiten den Titel »Des Teufels Netz« gewählt. – Cf. Bruchstücke der Reden Anm. 206 i.f., desgl. 787.
49 Cf. Mittlere Sammlung Anm. 53.
50 Vergl. Bruchstücke der Reden Anm. 5473.
51 Zu Nāthaputto cf. Bruchstücke der Reden Anm. 779 i.f.
52 S hat das ältere padiko erhalten.
53 Mit S einmal.
54 So S.
55 Obige Frage und Antwort, eine gebräuchliche Wendung bei uns, taucht im Mahāvastu III 47f. als versaṃskṛtisierter Brocken wieder auf: pṛcchema vayaṃ kiṃcid eva prade am sacet me āyuṣmān Ānando 'vakā aṃ karoti pra navyākaraṇāye + pṛcch' āyuṣmaṃ Kā yapa yad ākāṃkṣasi, rutvā pravedayisyāmi: wobei letztere Zugabe unser sutvā vedissāmi darstellen soll, aus der 114. Rede der Mittleren Sammlung aufgefangen; in der siamesischen Ausgabe, der bisher allein brauchbaren, Seite 434 zu finden.
56 Mit S, C etc. sūdā.
57 evam eva mit S.
58 Mit S 'pi.
59 Mit S, C etc. yathā katham.. vyākariṃsu.
60 Mit S, C etc. avocam.
61 S hier vā ti pāṭho dissati.
62 labujam, lakucam = likucam, cukrā. – Mango und Tamarinde sind nach Geschmack und Wirkung entgegengesetzt.
63 anikujjento zu lesen. S hat anikkujjento.
64 Vergl. die vedischen sieben unteren Welten, aufgezählt bei DEUSSEN, Allgemeine Geschichte der Philosophie I 2: Die Philosophie der Upanishad's, S. 196.
65 Zum abschließenden Gleichnisse cf. Bruchstücke der Reden Anm. 1040. – Die richtige Textfassung passim in TRENCKNERS Majjhimamkāyo p. 517f. – Sehr fein hat einst ROBERT L'ORANGE eine Stelle über Makkhali Gosālo, nach OLDENBERGS Buddha (in der 4. Auflage S. 199), näher erklärt: »Wie von allen gewebten Gewändern, die es gibt, ein hären Gewand das schlechteste heißt – ein hären Gewand, ihr Jünger, ist in der Kälte (dem Leben) kalt, in der Hitze (dem Tode) heiß, von schmutziger Farbe (in sich selbst unrein), schlecht riechend (anderen anstößig), rauh anzufühlen (grob ausgedacht: seicht, rationalistisch, jedem Unverständigen, der selber dazu neigt, verständlich) – so, ihr Jünger, heißt von jeglichen Lehren der anderen Asketen und Brahmanen des Makkhali Lehre die schlechteste.« Vielleicht nicht mit Unrecht hatte L'ORANGE die Lehre von der Unfreiheit des Willens wie bei Gosālo bei SCHOPENHAUER alsbald erkannt und verworfen. Und zwar in folgender Weise. »Ich verstehe ja vollkommen deutlich«, sagte er, »was ihr eigentlich meint: ›Wir können zehnmal sagen, ich will anders sein, es hilft doch nichts, wir bleiben wie wir sind!‹ Ja, ganz recht: ich kann zehnmal sagen, ich will ans andere Ufer, ich kann doch nicht: das Wasser hat eben keine Balken. Da gilt es eben ein Floß zu bauen: attūpanāyiko dhammo, eine das Selbst nach oben führende Eigenschaft. ›Woraus aber das Floß bauen?‹ Nun,[632] aus den Stoffen, die hier um dich herumliegen: die allbekannten Tugenden und guten Eigenschaften. ›Wie aber bauen? Und wie den richtigen Kurs finden, nachher?‹ Fürs erste sind die denkbar ausführlichsten Vorschriften vorhanden, und fürs zweite eine so genaue Karte, sankhalikhitam brahmacariyam, daß auf ihr jedes Riff, jede Insel u.s.w. angegeben ist. – Und wenn man die ersten Riffe und Inseln gefunden hat, nach Vorhersage, soll man dann nicht Vertrauen bekommen zur Karte, avecca pasādo? – Wer hat rechtbehalten, Kolumbus oder die Gelehrten? Und selbst wenn wir wie er ins Ungewisse steuern müßten, was aber, wie eben gesagt, nicht der Fall ist: haben wir hier etwas zu verlieren in dieser schauerlichen Öde, in diesem Schmutz, in diesem Elend, in diesem brennenden Schmerz? – Die Freiheit des Willens ist genau so ein Unsinn wie die Gebundenheit des Willens, der Determinismus: die Wahrheit liegt aber hier wie überall zwischen den beiden antā: seyyathāpi ein Verschuldeter; kann der einfach sagen ›Ich will schuldenfrei sein‹ und ist es dann auch? Oder ist er anderseits für ewig gezwungen in dieser Lage zu verharren? Wer in aller Welt hindert ihn durch Entsagung und angestrengte Arbeit sich nach und nach zu befreien? – Wie schnell, hängt ganz und gar von seinem Fleiß ab.« Die Gleichnisse, von welchen L'ORANGE hier gesprochen, werden wir später kennenlernen, pariyāyena.
66 Vergl. Mittlere Sammlung S. 410.
67 Mit S, C etc. sakkā mahārāja zu lesen.
68 Knecht und Diener: d.i. das Verhältnis zum König als Lehnherrn, dem alle vier Stände, Krieger, Priester, Bürger und Bauern, als Steuerzahler unterworfen, im übrigen durchaus frei galten, nach der weisen Proportion vom Goldenen Schnitte schon angewandt im modernen Begriffe; daher denn ein so ausgezeichneter Augenzeuge und Beobachter wie MEGASTHENES die damals bestandene allgemeine Freiheit, die noch hundert Jahre später unter Asoko für jeden in seiner Art so trefflich geregelt war, dem griechischen Frondienst gegenüber gepriesen, »eben auch dies als ein Großes im Lande der Inder« bewundert hat: ειναι δε και τοδε μεγα εν τη Ινδων γη, παντας Ινδους ειναι ελευϑερους, ουδε τινα δουλον ειναι Ινδον, von ARRIAN überliefert, Indica § 10. Vergl. noch besonders die Anm. 164 zur fünften, im lauteren Mittel binnenpolitischen Rede.
69 rāsivaḍḍhako Schatzvermehrer: der nämlich durch Steuerabgaben das königliche Einkommen mehrt; Landbesitzer z.B. haben 1/12-1/6 des jährlichen Ertrages abzuliefern, Manus VII 130. – Vergl. Anm. 158.
70 So mit S etc.
71 Mit eben dieser Gedankenfolge hat Asoko seine vorletzte Felseninschrift abgeschlossen, wo sramarati unsere beiden Hauptbegriffe im Stempel vortrefflich wiedergibt, Ṣāhbāzgarhī Zeile 12: »Alles kann zu Freude werden bei freudigem Fleiß: denn der taugt für diese Welt und für jene Welt.« Hierher gehört weiterhin des Königs Wort: Tato ubhayasa ladhaṃ bhoti, cf. Mittlere Sammlung, Anm. 480.
72 Mit S nihatapaccāmitto zu lesen.
73 Das altvedische Gleichnis nach der Ṛksaṃhitā X 136, 5 vom muni, vātasyā vo vāyoḥ sakhā, als Windesroß, der Lüfte Freund, ist hier übernommen, weitergeführt und zu Ende gebracht. Vergl. ferner noch Mittlere Sammlung Anm. 367.
74 Dem Gleichnisse von der Begierde als Schuldenlast ist ein anderes von den Begierden als Darlehen beigeordnet, in der Mittleren Sammlung S. 400 im einzelnen ausgeführt. Beide geben so zu sagen die Oberstimme zum wohlbekannten Lemurenchor an:
Es war auf kurze Zeit geborgt;
Der Gläubiger sind so viele.
[633] Die zweifelhafte Landstraße ist, wie ROBERT L'ORANGE bemerkt hat, bei den Soūfi wiederzufinden, z.B. in THOLUCKS Blüthensammlung S. 141.
75 Vergl. Mittlere Sammlung S. 888.
76 Vergl. Mittlere Sammlung Anm. 419.
77 Im Sāṃkhyam wiederzufinden, Kapilabhāṣyam III 7: Mātāpitṛjaṃ sthūlaṃ prāyàsa, itaranna tathā.
79 Vergl. Mittlere Sammlung Anm. 111; Anm. 159. – Die iddhividhā mit ihren acht hier einzeln angegebenen Wirkungen ist, wie so viel aus dem alten yaugajñānam, auch in das Sāṃkhyam übergegangen, schon Kārikā 45, als ai varyād avighātaḥ mit der noch genau zutreffenden Erklärung etad ai varyam aṣṭaguṇam aṇimādiyuktam, und schließt dann unserem Texte gemäß, yāva brahmalokā pi kāyena vasaṃ vatteti, mit ebendieser achten magischen Wirkensart ab: brāhmādiṣu sthāneṣvai varyaṃ na vihanyate. Die Kommentatoren freilich haben das nicht mehr recht verstanden, Radeblumen daraus gemacht, wie Gauḍapādas im bhāṣyam 23 zeigt. Diese durchaus asketische Wunderkraft war aber längst in der Ṛksaṃhitā X 136 begeistert verkündet, wo zumal in der 4. Strophe eine gewisse Wirkensart wie oben vorgeführt ist:
Aṃtarikṣeṇa patati
vi vā rūpāvacāka at,
munir, devasya devasya
saukṛtyāya sakhā hitaḥ.
Gotamo hat die Wunderkraft in anariyā iddhi und ariyā iddhi eingeteilt, in unheilige Macht und heilige Macht: zu ersterer gehören alle angegebenen Mirakel, letztere ist Herrschaft über das eigene Herz und vollkommener Gleichmut den Dingen gegenüber. Cf. die Nachweise in den Liedern der Mönche, Anm. 375.
80 Der Paukenschall, bherisaddo, desgl. im übertragenen Sinne bei Asoko: bherīghoso aho dhaṃmaghoso, auf der vierten Felseninschrift, Girnār Zeile 3. Die sogleich folgenden vimānadasaṇā ca hastidasaṇā ca agikhaṃdhāni ca, sowie »andere himmlische Bilder«, añāni ca divyāni rūpāni, sind ganz ebenso aus den Reden ihm wohlbekannte Gleichnisse und Gegenstände, die der König dem Volke, wie er sagt, eben jetzt bei seiner Wallfahrt hat aufweisen lassen, ta aja dhaṃmacaraṇena dasayitpā janaṃ. – Wallfahrt ist hier wie zuweilen bei uns, z.B. in »Erdewallen«, nur im höheren Sinne als rechter Wandel zu betrachten; die konkrete Wallfahrt ist dhammayātrā, auf der achten Felseninschrift, cf. Mittlere Sammlung Anm. 533, von Asoko freilich geistig verklärt.
Ähnlich in den yogischen Upanischaden die bherīmṛdanga ankhanādās, wie z.B. in der Haṃsopaniṣat im 8. Stück.
81 So auch Mittlere Sammlung S. 576f.; vergl. ibid. 116. – Zur Herzenskunde nb die Nachweise in den Bruchstücken der Reden, Anm. 474. Das früheste geschichtliche Gegenstück bei uns hat ATHANASIOS in seiner Lebensbeschreibung des Archasketen ANTONIOS, p. 113 der Ausgabe Augsburg 1611, erhalten, wo er nach eigener Anschauung berichtet: και γαρ και τουτο ην μεγα της ασκησεως του Αντωνιου, ότι (καϑα προειπον) χαρισμα διακρισεως πνευματων εχων, επεγινωσκεν αυτων τα κινηματα και προς ό τις αυτων ειχε την σπουδην και την ὁρμην, τουτο ουκ ηγνοει, κτλ. Es erinnert zugleich an die Spiegelkunst, von der später, in der Einleitung zur elften Rede, im Gespräch mit Kevaṭṭo, gehandelt wird.
82 Vergl. Mittlere Sammlung S. 962; auch Bruchstücke der Reden Anm. 678.
83 vītisañcarante zu lesen; vergl. RHYS DAVIDS, Dialogues of the Buddha p. 92 n. 2. [634] Zum Gleichnis vom Hause cf. Lieder der Mönche v. 183-184 nebst Anmerkung; und damit noch Faust v. 11604:
Wer hat das Haus so schlecht gebaut?
84 Der Heilige als Träger der Welt, insofern er nämlich der Traumerwachte, Alleigene, kevalī geworden, ist bereits im letzten Ṛkmaṇḍalam mit sieghafter Gewißheit ausgesprochen, im 136. Liede, wo der Muni oder Denker sich selbst als durchzuckenden Blitz, ke ī, erkennt, der das Feuer trägt, das Ganze (viṣaṃ ist alte Korruptel für vi vaṃ, auch in v. 7), beide Welten trägt, der als Blitz dieses Licht genannt wird, ke īdaṃ jyotir ucyate: daher denn sogar ein so volkstümlicher Text wie das Dhammapadam diese Vedenstelle vom Muni als Träger beider Welten zur Stütze genommen und angebracht hat, v. 269, yo munāti ubho loke munī tena pavuccati. Zur Begründung dieser Ansicht nach den Gesetzen der Erkenntnislehre dient die Antwort, die Kevaṭṭo von Gotamo erhält, am Ende der II. Rede.
85 Mit S imasmā ca pana mahārāja sandiṭṭhikā sāmaññaphalā aññamādi. – Vergl. Asoko auf seiner neunten Felseninschrift, Girnār Zeile 4: ayaṃ tu mahāphale maṃgale ya dhaṃmamaṃgale. Mit noch genauerem Anklang an Gotamos Topus, idam pi kho sāmaññaphalam, diesen berühmtesten der ganzen Längeren Sammlung an der entsprechenden Stelle in Ṣāhbāzgarhī, Mansehra und Kālsī vom Könige wiederholt: iyaṃ cu kho mahāphale ye dhaṃmamaṃgale.
86 Mit S yo 'ham bhante.
87 Mit S yo tvam.
88 Mit S yev' assa āsane. – Khato zeigt das vorige anumoditvā als Glosse an.
89 Vergl. Mittlere Sammlung Anm. 280.
90 tayā zu lesen, wie im Brahmāyusuttam, MN No. 91.
91 Vergl. Bruchstücke der Reden Anm. 5476. – Die sieben Juwelen sind aus der Ṛksaṃhitā VI, Anfang des vorletzten Liedes, überkommen; cf. die Erklärung in der Bṛhaddevatā, ed. MACDONELL 5 123:
Cakraṃ ratho maṇir bhāryā
bhūmir a vo gajas tathā:
etāni sapta ratnāni
sarveṣāṃ cakravartinām.
Man findet hier fünf unserer Juwelen wörtlich erhalten, während der beste Bürger und der beste Staatsmann als bester Boden(verwalter) und bester Wagen(lenker) noch auf den älteren Zustand hinweisen. Der Topus vom Bürger als bester Boden, gṛhastha ucyate reṣṭhaḥ, ist in der Mittleren Sammlung S. 760 behandelt.
92 Mit S und C besser āgaccheyyātha, manasikareyyātha, und dann vusitamānī zu lesen; mit C yeva kho pana bho ayam Ambaṭṭho māṇavo.
93 Mit S pāpito, wie Mittlere Sammlung No. 80 und No. 99.
94 Vergl. den Sakyerprinzen Daṇḍapāṇi und seinen standesgemäßen Spazierstock, in der Einleitung zur 18. Rede der Mittleren Sammlung. – Mit S, C etc. Sakyakumārā zu lesen.
95 laṭukikā mit S, C etc. wie Majjhimanikāyo No. 66; hierher werden auch Asokos gelāṭe gehören, »Singwachteln«, von gai geṣṇādi, deren sich der König auf seiner fünften Säuleninschrift, gleichwie dann der Fledermäuse, Eichhörnchen, der »Mangonager«, wie er diese nennt, und all der anderen harmlosen wilden und zahmen Tiere als [635] Schützer mit väterlichen, bis einzeln genau vorsorgenden Bestimmungen warm angenommen hat. Zu den Mangonagern cf. Bruchstücke der Reden, Anm. 443.
96 Mit S, C etc. na arahat' āyasmā Ambaṭṭho.
97 Kaṇho, der altvedische Kṛṣṇas. Vergl. Krischnas Weltengang, München 1905.
98 Okkāko, oder mit S Ukkāko, ist der vedische Urkönig, schon im Ṛk und Atharvan bekannt, ein Aikṣvākas und somit auch der Ahnherr des Königs Da arathas; welcher letztere dann später wiederum genau ebenso seinen geliebten ältesten Sohn Rāmas in die Verbannung schickt: unsere Sage von Okkāko gibt also nun die gleichentwickelte Vorgeschichte zum Rāmāyaṇam an. Nach den Raghuiden ist denn auch Gotamos Sohn Rāhulo, i.e. Rāghulas, genannt; cf. Bruchstücke der Reden Anm. 335. – Vergl. ib. Anm. zu v. 302; zu v. 685 über der Sakyer Gebiet.
99 pabbajjāpesi mit C.
100 Die sakkische Eiche, ākas, Tectona grandis, ist noch immer der schönste Baum des Himālayo. – Zur Eiche am Ufer des Sees cf. Lieder der Mönche Anm. 1149 i.f., – Die Namen der vier Söhne sind recht unsicher, desgl. im Mahāvaṃso und sonst auch im Mahāvastu, anders angegeben. Für Ukkāmukho spricht die jihvā vaivasvatī, Bruckstücke der Reden Anm. 1022.
101 Es sind, indischen Verhältnissen gemäß, Töchter vom selben Vater aber von einer anderen Mutter gemeint, Halbschwestern; vergl. oben die Lieblingsgattin. Ähnliche Heiraten im alten Hellas und Latium; später die Sobrinenehe. – Die sagenhaft erzählte Vermählung der Sakyer wird übrigens dem jungen Priester auf Grundlage der einst ṛgvedischen Yama + Yamī-Hochzeit mit leicht andeutendem Humor vorgetragen; wovon allerdings das grobschlächtig scholastische Gefasel des Kommentars (nebenbei: von ALBRECHT WEBER in dessen Indischen Streifen I 235-224 trefflich übersetzt) keine Ahnung verrät.
Der sambhedo oben im Texte gilt sphuṭane, ist bei Wiedergabe dieser Stelle auch noch im Mon durch lüm-ā, d.i. zerstören-hin, übersetzt, nach P.W. SCHMIDT, Buch des Rāǵāwaṇ, Sitzungsber. der phil.-hist. Klasse der kais. Akad. d. Wissensch. Wien, 151. Bd. 3 Abh. p. 40f.
102 Der Name Sakko und Sakyo stammt zugleich von 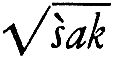 vermögen ab: die Sakyer, usprünglich s.v.a. Optimates, dann nom. pr. der gens. – Vergl. Mittlere Sammlung Anm. 429 und 321. Die neuerlich von FLEET im Journal of the Royal Asiatic Society 1906 auf Grund einer tausend Jahre späteren rührseligen Legende versuchte Umdeutung des Namens u.s.w. könnte als harmlose Spielerei gelten, a play to please the million, wenn unsere alten Urkunden dabei nicht allzu willkürlich verdreht und verstellt wären. – Nb noch unsere Quercus Robur, ital. bloß róvere genannt, wie DE LORENZO fein bemerkt, und auch daher das berühmte Geschlecht eines GIULIO II DELLA ROVERE.
vermögen ab: die Sakyer, usprünglich s.v.a. Optimates, dann nom. pr. der gens. – Vergl. Mittlere Sammlung Anm. 429 und 321. Die neuerlich von FLEET im Journal of the Royal Asiatic Society 1906 auf Grund einer tausend Jahre späteren rührseligen Legende versuchte Umdeutung des Namens u.s.w. könnte als harmlose Spielerei gelten, a play to please the million, wenn unsere alten Urkunden dabei nicht allzu willkürlich verdreht und verstellt wären. – Nb noch unsere Quercus Robur, ital. bloß róvere genannt, wie DE LORENZO fein bemerkt, und auch daher das berühmte Geschlecht eines GIULIO II DELLA ROVERE.
103 Mit S, C etc. Kaṇhaṃ nāma.
104 Mit S pavyāhāsi. Kṛṣnas pflegt mit Vorliebe laut aufzulachen; vergl. Krischnas Weltengang l.c. passim.
105 Mit S, C etc. Gotamo.
106 Mit S asmiṃ vacane.
107 Mit S, C etc. akāmā pi.
108 Zum feineren Verständnisse auch dieser nur innen vernehmbaren Geisterstimme dient v. 986 der Bruchstücke der Reden nebst Anmerkung; über die Drohung handelt ib. 984 der letzte Absatz. – Der unsichtbar sichtbar zu Häupten schwebende Geist im Dienste der Wahrheit ist übrigens, von außen betrachtet, bloß ein [636] Hypergeion oder adbhutam der satyakriyā, während sie selbst und ihre eigentliche Wirkensart zumal in der 86. Rede der Mittleren Sammlung wundervoll anschaulich dargestellt ist: nicht minder gewaltig als bei uns einmal TACITUS dergleichen Orakelworte einer geistigen Botschaft mit ehernen glühenden Hammerschlägen der Erinnerung eingeprägt hat: nam culpa quam poena tempore prior, emendari quam peccare posterius est.
109 Mit S uḷāro ca so; dann auch mit C etc. brahmamante.
110 Maddharūpī, wie auch S hat, s.v.a. Wunderschön.
111 Mit S N'eva re mayhaṃ dāsiputto, C re ayam mayham etc.
112 khurappo, der geschweifte Dolch, scharf wie ein Schermesser, auch jetzt noch getragen, rechts im Gürtel, an welchem khaḍgas, khaggo, der richtige gladius, links hängt. – Nebenbei sei hier bemerkt, daß ersterer heute khukri heißt und man für letzteres, das kurze Schwert, oft khang' an nordbengalischen Orten hören kann, bis nach Nepāl, der uralten, übrigens immer noch klassischen Heimstätte des auch von Asoko beschützten Schwerthorns; woher ich es dem Klange nach behalten und überliefert habe, Bruchstücke der Reden, Anm. zu v. 75: obschon dies nur in einer De anāgarī und nicht in der Devanāgarī zulässig ist, wo freilich khaḍgaḥ allein durchgeht.
113 Vergl. den kräftigen Regenzauber in der Ṛksaṃhitā X 98 10 um die neunundneunzigtausend himmlischen Regenladungen.
114 Bei der allmonatlichen Opferspende und Feier zum treuen Gedächtnis an Väter und Vorfahren. Eine ältere Stufe solcher wohl bei jedem der Völker je bodenständigen Sitte findet man als Ahnengabe zur Abwehr gespenstiger Umtriebe in OLDENBERGS freilich mehr feuilletonistischer Religion des Veda S. 553-556 vortrefflich dargestellt.
115 Nach der richtigen Auslegung der Ṛksaṃhitā X, 109, wo die Priesterfrau zurückgewiesen wird, mit der echt überlieferten Begründung in v. 3:
tathā rāṣṭraṃ gupitaṃ kṣatriyasya:
so kann das Reich gesichert sein dem Krieger.
116 bhassapuṭena mit S zu lesen. Vergl. Manus IX, 236-239.
117 paramanihīnatappatto älter und feiner mit S zu lesen. – Zum folgenden Spruche und der anschließenden Auslegung cf. Mittlere Sammlung, 53. Rede; auch die Chāndogyā VII.: Skandaḥ-Sanatkumāras.
118 Es folgen nun im Text alle die entsprechenden Hauptstücke der ersten und zweiten Rede: oben von hier an nur nach den Hauptteilen wiederholt. – Der Beginn ist noch im Divyāvadānam p. 504 i.f. erhalten: ...loka utpannas tathāgato 'rhan saṃyaksaṃ buddho vidyācaraṇasaṃpannaḥ sugato lokavid anuttaraḥ puruṣadamyasārathiḥ āstā devānāṃ ca manuṣyāṇāṃ ca buddho bhagavān.
119 Dieser berühmte Topus ist, wie schon SENART bemerkt hat, im Mahāvastu III 50 teilweise erhalten; es heißt da, freilich nach etwas drunter und drüber Hörensagen überliefert: saṃbādho punar ayaṃ gṛhāvāso rajasām āvāso, abhyavakā aṃ pravrajyā. taṃ na labhyaṃ agāram adhyāvasantena ekāntasaṃlikhitam ekāntamanavadyaṃ pari uddhaṃ ekāntaparyavadātaṃ brahmacaryaṃ carituṃ. yannūnāhaṃ agārasyānagāriyaṃ pravrajeyaṃ. Sogleich aber bricht nun, ähnlich wie ib. II 117, das kurze Stück ab.
120 khārividham zu lesen.
121 Aus den vier Weltgegenden, oder auch nur: aus den Weltgegenden, heißt soviel als: von überall her; di ābhis, di āsu, dikṣu in ruti und Smṛti, desgleichen bei Asoko auf seiner letzten Säuleninschrift, Delhi-Sivālik (II) Zeile 6, hida ceva disāsu ca: »hier sowohl als überall.«
[637] 122 Vergl. Mittlere Sammlung, 24. Rede gegen Ende. – Der König sitzt bei der Rechtsprechung, umgeben von seinen Räten und Priestern, verhüllten Hauptes auf dem Richterstuhl um unversucht von irgendwie trügender Miene sein Erkenntnis zu bilden, Urteil zu fällen, dharmāsanam adhiṣṭhāya saṃvītāngaḥ (Komm. ācchāditadeho 'nanyamanā, pracchāditāngo 'vaguṇṭhita irā) kāryadar anam ārabhet: Manusaṃhitā 8 23. Er zeigt also insofern dem beratenden Priester kein vollkommenes Vertrauen.
123 So mit S.
124 Mit S rājamahāmatto.
125 Vergl. Mittlere Sammlung Anm. 288.
126 Wie Theragāthā 842 noch suci-maṃsūpasecanam zu lesen.
127 Zu veṭhakanatao cf. das verwandte, aber in anderer Richtung entwickelte nantakam, Mittlere Sammlung Anm. 146. – Vergl. die nachasokischen Reliefe, in Sāñci, Barāhat, Amarāvati u.a.O., obzwar da, wie bei den Griechen, die Darstellung des nackten geschmeidigen Körpers bevorzugt wird. Im täglichen Leben ist die Bekleidung der indischen Frau heute noch wie damals der hellenischen ungemein ähnlich: faltenreiche Schleier und Gewänder, die je nach dem Stande nur an Farbe und Feinheit der Gewebe, Linnen, Seide, zarter Kaschmir, sich unterscheiden, überall aber einen unverkennbar erlesenen Formensinn finden lassen, Stapelplätze wie Bombay oder Kalkutta natürlich mehrenteils ausgenommen.
128 Mit S ukkhittapalighāsu.
129 Mit S sodhissāmīti, – Die ganze Wendung ist in das Mahāvastu III 55 übergegangen; aber, merkwürdig genug, mit einer anders entsprechenden Ellipse: yasya punaḥ syāt mayi kāṃkṣā vicikitsā vā, so pra naṃ pṛcchatu, ahaṃ pra nasya vyākaraṇena. Es folgt alsbald ein weiterer vernakulierter Brocken, dharmyā kathayā saṃdar ayitvā samādāpayitvādi, und die Überlieferung ist wieder zu Ende.
130 Lies samannesi. atha kho Ambaṭṭhassa māṇavassa etad ahosi: Samannāgato kho samaṇo etc.; vergl. Mittlere Sammlung Anm. 263. – Nb auch Bruchstücke der Reden Anm. 1022.
131 paṇḍitakā, bahussutakā, tevijjakā zu lesen.
132 Mit S Atha kho zu lesen.
134 Vergl. Mittlere Sammlung Anm. 258; auch Divyāvadānam p. 294.
135 bhavantaṃ mit S.
136 Vergl. Mittlere Sammlung Anm. 281. Ebenso mit S dann khalu bho immer zu lesen.
137 Zum accessorischen Begriffe der Tugend, wie Gotamo ihn als schlechthin selbstverständlich betrachtet, cf. die I. Rede oben S. 5 und 11; Bruchstücke der Reden Anm. 898. Das dort nachgewiesene gotamidische Merkwort sīlavā hoti no ca sīlamayo hat unser ECKHART identisch wiedergegeben, ed. JOSTES p. 92: »Man soll Tugend üben, nicht besitzen.« Und er fügt dann erklärend hinzu: »Das ist Vollkommenheit der Tugend, daß der Mensch ledig steh' der Tugend.« Auch PLATON hat diese tiefe Erkenntnis ausgesprochen, ουκ ουσιας οντος του αγαϑου, Rep. VI gegen Ende, p. 509. Mit feiner Empirie hat zumal ARISTOTELES das Verhältnis richtig angedeutet, indem er die αρετη εν πλειοσι darstellt, Topik V I 4. Natürlich ist hier wie dort Tugend immer = tüchtig sein, pariyāyena. Vergl. noch Mittlere Sammlung No. 47.
138 Anspielung auf das bekannte Dogma der Jainās vom ehedem getanen Bösen, das nur in bitterer Kasteiung abgebüßt werden kann: vergl. Mittlere Sammlung 780.
[638] 139 Cf. Mittlere Sammlung Anm. 283.
140 Cf. Mittlere Sammlung Anm. 284.
141 Mit siṇh. Mss bahū-d-eva manussā zu lesen. Cf. Bruchstücke der Reden Anm. 258.
142 Die letzten Worte Soṇadaṇḍos an die Priester enthalten einen arthāntaranyāsas, eine Anspielung auf den berühmten dritten Vers des Puruṣasūktam, Eingang:
Etāvān asya mahimā,
ato jyāyāṃ ca pūruṣaḥ.
143 api puṭaṃsenāpi ti zu lesen. – Vergl. Mittlere Sammlung S. 884.
144 adisvā va samaṇaṃ besser mit S.
145 etad eva bahulam mit S.
146 Cf. zu abbhunnāmetvā einen gleichen kausativen Gebrauch bei Asoko, Anm. 152.
147 S hat recht gut pūjam paggaṇhantānam: es wird pūgam zu lesen sein; cf. den ähnlichen Topus gaṇam pariharati, e.g. Majjhimanikāyo vol. I p. 165, passim.
148 Von dem hier in den Hauptzügen überlieferten vedischen Priestertypus mit den beiden vornehmlichen Merkmalen bahussuto ca kalyāṇavākkaraṇo ca spricht ebenso Asoko auf seiner 12. Felseninschrift, Girnār-Zeile 7: savapāsaṃdā bahusrutā ca asu kalāṇāgamā ca asu; wie denn auch das vorangehende aṃñamaṃñasa dhaṃmaṃ sruṇāru ca sususera ca unserem folgenden sahadhammena paṭivacanaṃ karoti gleich ist. – Was Gotamo unter bahussuto eigentlich verstanden hat, im höheren Sinne, lehrt v. 1027 der Lieder der Mönche nebst Anmerkung.
149 Diese gegenseitigen Doppelbegriffe hat ebenso auch Asoko als die letzterreichbaren, nicht weiter zu vereinfachenden beiden Haupteigenschaften aller Religion, sit venia verbo, zu Anfang seiner kurzen, prachtvollen siebenten Felseninschrift als sayamo = sīlam und bhāvasudhi = paññā aufgestellt und aus ihnen dann am Ende »Erkenntlichkeit und Rechtschaffenheit als immer gültig« weiter abgeleitet. Aber noch genauer hat der König sich schon gegen Schluß der letzten Säuleninschrift unserem obigen Wortlaut angeschlossen: »eben durch zwei Arten«, duvehi yeva ākālehi, sagt er am Delhi-Sivālik (II) Zeile 8, sei da die rechte Förderung der Menschen gefördert worden, dhaṃmaniyamena ca nijhatiyā ca, »durch rechte Tugend und durch tiefe Einsicht.«
150 Nebst vielen anderen kommt auch dieser Topus noch in der späten Aṣṭasāhasrikāprajñāpāramitā teilweise recht gut erhalten vor, im Anfang des dritten Kapitels: na ca tasya kulaputrasya vā kuladuhitur vā imāṃ prajñāpāramitām udgṛhṇato dhārayato vācayataḥ paryavāpnuvataḥ pravartayamānasyār aṇyagatasya vā vṛkṣamūlagatasya vā ūnyāgāragatasya vā abhyavakā agatasya vā, dann pathi gatasya vā utpathagatasya vā aṭavīgatasya vā mahāsamudragatasya vā, und dergleichen mehr, bhayaṃ vā bhaviṣyati, etc.
151 bhavantaṃ Gotamaṃ mit S zu lesen.
152 Zum Konjunktiv in futurer Bedeutung abbhunnameyyam cf. Asokos schön entsprechendes abhyuṃnāmayehaṃ, das Futurkausativ in konjunktiver Bedeutung abhyunnāmayiṣyam, auf der letzten Säuleninschrift, Delhi-Sivālik VII I 19, nebst BÜHLERS Anmerkung Epigraphia Indica II 273.
153 chattam mit S zu lesen. – Dieser Schirm dürfte soṇadaṇḍakam, an goldenem Stabe zu tragen, eine besondere, nur hohen Adeligen zukommende Auszeichnung, und daher Soṇadaṇḍo, »Der Goldstabene«, Ehrenname gewesen sein: wie Kanakadaṇḍas ebenso für Kṛṣṇas als königlichen Gebieter, vergl. Mittlere Sammlung Anm. 270. Cf. auch oben Anm. 94.
154 Vergl. Bruchstücke der Reden Anm. 978.
[639] 155 So S: tam ete bhavantam bho Gotamaṃ etc.
156 Vergl. No. 4, S. 78-80.
157 Vergl. Asokos innigen Gedenkspruch zu dieser Stelle, im Anfang der siebenten Säuleninschrift: Esa me huthā:
Atikaṃtaṃ ca aṃtalaṃ
h'evaṃ ichisu lājāne:
kathaṃ jane anulupāyā
dhaṃmavaḍhiyā vaḍheyā ti.
158 Einen solchen gänzlichen Steuererlaß hat Asoko dem Dorfe Luṃmini allerdings gegeben, Inschrift von Paḍeria Zeile 4: wo ubalike kaṭe unserem balim uddharati bestens entspricht, und zwar als udbalikas, im echt kaiserlich schönen piyadassischen Lapidarstil.
159 Mit S dassukhilam, i.e. dasyukhilam; cf. cetokhilam, Majjhimanikāyo No. 16. – Zu dasyus noch Vāyupurāṇam 49 54 dasyavaḥ santi, mlecchajātyādi.
160 teva mit S.
161 ye pana mit S.
162 tesaṃ rājā Mahāvijito mit S.
163 bho so mit S.
164 viharanti mit S. – Wie Asoko dieser Darstellung in seinem Wirken nachgefolgt ist, zeigt er auf der 13. Felseninschrift, wo er als Eroberer und Herrscher von ganz Indien bis über die Grenzen der Erben ALEXANDERS sich zu erkennen gibt, ohne aber so ungeheuerer Macht irgend eigentlichen Wert beizumessen, es sei denn um für das Rechte zu sorgen, das Rechte vorzukehren, sich und seine Nachkommen einzig darin zu bestärken, und neben anderen bewundernswerten Dingen nun auch ferner gar schlicht von sich berichtet, Ṣāhbāzgarhī Zeile 7: Ya pi ca aṭavi devanaṃ priyasa [vi]jite bhoti, ta pi anuneti anunij[h]apeti: anutape pi ca p[r]abhave devanaṃ priyasa; vucati teṣa, ki[ṃ]ti: avatrapeyu, na ca haṃñeyasu: »Die aber da als Wilde im Reiche des Königs leben, auch diesen steht er bei und läßt sie unterweisen: denn auch zur Bekehrung hat der König Macht; kundgetan wird ihnen, und zwar was? Zukehren mögen sie sich, und kein Leid soll ihnen geschehn.« – Zu avatrapeyu, anutape, anut[r]ape cf. ottappam, das, wie ROBERT L'ORANGE erkannt hat, zu trap vereri gehört als apatrapā apatrapaṇam, d.i. αποτρεπτικη im Sinne einer ταπεινωσις entwickelt, bis zum Kernbegriff unserer mhd. ôtmüete; anunijhapeti von dhyai, oder anunijapeti = anuniñāpeti, anunijā[nā]peti.
165 anuyantā mit S.
166 tapati mit S.
167 Mit S pāṇātipātā pi paṭiviratā etc.; C pāṇātipātā paṭiviratā pi etc.
168 tasmiṃ kho pana mit S. – Vergl. Mittlere Sammlung S. 378f. Nach einem solchen idiopathischen Vorbilde wie oben hat übrigens Kumārilas in der Mīmāṃsā I 4 3 die citrā fein umgedeutet: cf. COLEBROOKE, Miscellaneous Essays1 I 319f.
169 abhisankhataṃ mit S, C etc.
170 pi kho mit S.
171 Genau nach dieser Darstellung hat Asoko sogleich schon seine erste Felseninschrift eröffnet: Idha na kiṃci jīvaṃ ārabhitpā prajūhitavyaṃ, na ca samājo katavyo. Und alsbald folgt nun die unserem ganzen Stücke so großartig entsprechende, wundersam ergreifende Entwicklung bis zu dem so pi mago na dhuvo. Cf. hier noch Bruchstücke der Reden, Anm. 303. – PLUTARCH, Numa, cap. 8.
[640] 172 Die sechzehn vedischen Erfordernisse zur Feier des sutyam etc., wie e.g. nach dem Aitareyabrāhmaṇam Kap. 16, haben hier eine ähnliche Vergeistigung erfahren wie der ṣoḍa aḥ stotrāṇām in den Bruchstücken der Reden, cf. Anm. zu v. 1123.
173 Auch diesen Ausdruck hat Asoko sich wohl gemerkt und auf der berühmten Bairāter Felseninschrift bejahend wiederholt, Zeile 2-3: keci bhaṃte bhagavatā budhena bhāsite, save se subhāsite vā.
174 uppajjitā ti mit S zu lesen: wodurch ahaṃ/yājetā, wie schon vorher durch vā/vā, zur Glosse wird. – Vergl. Mittlere Sammlung S. 946.
175 appatthataro besser mit S.
176 Mit S, C etc. nur appao.
177 Ist meisterhaft zusammengefaßt ein echt gotamidischer Hinweis für Kūṭadanto den Priester auf das 117. Lied im letzten Ṛkmaṇḍalam, zumal nach dem Thema der dritten Strophe: sa id bhojo yo gṛhave dadāti. Ebenso hat Gotamo einem anderen Priester gegenüber diese Strophen einmal angewandt, Bruchstücke der Reden v. 102 und 128-130, und dort wieder genau nach dem Ausklange der sechsten Strophe: kevalāgho bhavati kevalādī. Eine solche bis in die feinen, oft nur schwer noch hörbaren einzelnen Unterschiede der ruti reichende Kenntnis zeigt sich bei Gotamo immer wieder am geeigneten Orte; cf. l.c. Anm. 463. Es sind vielfach rhythmische Inversionen mit atichandas.
178 Ein Obdach für die Ordensbrüder aus den vier Weltgegenden, d.i. für jeden Pilger, jeden Mönch; ebenso auch vedisch, oben S. 69, für jeden Asketen oder Priester. Bei Gotamo gilt der vollendete Jünger als bhikkhu cātuddiso »Mönch der vier Weltgegenden«, Anguttaranikāyo V No. 109; auch als cātuddiso naro »Bürger der vier Weltgegenden«, d.i. Bürger in der ganzen Welt, wie Kassapo in den Liedern der Mönche v. 1057 berichtet. Vergl. die an letzterem Orte in der Anmerkung beigezogenen verwandten Begriffe des DIOGENES und des KRATES vom »Weltbürger«. – Wenn von den Ordensbrüdern, der Jüngerschaft schlechthin, gesprochen wird, ist immer stillschweigend »aus den vier Weltgegenden« mitzudenken: wie dies denn auch Asoko auf seiner schönen Inschrift zu Bairāt gezeigt hat, gleich in der ersten Zeile. Später wird dann auf Inschriften ausführlicher und mit stärkerer Betonung, aber eben darum schon weniger großartig, gesagt cāturdi a āryasaṃghaḥ oder cāturdi o bhikṣusaṃghaḥ: cf. die Nachweise Lieder der Mönche l.c. – Unter »ein Obdach errichten« hat man die Stiftung irgendeines geeigneten Aufenthaltortes zu verstehn: Asoko z.B. berichtet, auf der Inschrift von Paḍeria, Zeile 3, er habe ein steinernes Schutzhaus errichten lassen, silāvigaḍ abhī kālāpita; cf. Mittlere Sammlung Anm. 278, zu silāvigaḍ noch das ilāgṛhām auch ilāgṛhaḥ der Smṛti wie e.g. Vāyupurāṇe 45 36. Auf einer anderen Inschrift wieder berichtet Asoko von Felsengrotten, die er in der Umgebung von Gayā für Asketen hatte herrichten lassen: Mittlere Sammlung l.c. Es ist dann im allgemeinen ein jeder Wohnort, vihāro, gemeint, der den aus den vier Weltgegenden herankommenden und alsbald wieder in die vier Weltgegenden dahinwandernden Ordensbrüdern zugänglich gemacht ist: sei es eine Felsenkammer, wie der König sie stiftet, oder auch nur eine Hütte, kuṭī, wie der Bürger sie schenkt, z.B. Lieder der Mönche v. 56; oder aber auch eine größere Klause, ein geräumiges Wohnhaus, ein Saal, eine Halle, eine Terrasse, ein Garten, ein Park, ein Hain, eine Waldung, ein Werder, wie namentlich der reich begüterte Bürger Sudatto, genannt Anāthapiṇḍiko, dergleichen in großartiger Weise für den Meister und die Jünger vorgesehn hat, anderer königlicher, priesterlicher und bürgerlicher Almosenspender zu geschweigen. Vergl. Mittlere Sammlung Anm. 521 und S. 567.
[641] 179 Die abschließenden Worte des nun heilsam bekehrten Priesters spielen fein auf einen bekannnten Spruch aus dem letzten Ṛkmaṇḍalam an, 137 3 und 186 1:
vāta ā vātu bheṣajam.
180 pi mit S, C etc.
181 Vorname Oṭṭhaddhos.
182 Nomen gentile Nāgitos.
183 Mit S, C etc. Oṭṭhaddho pi und janatā bhagavantaṃ dassanāyāti.
184 Cf. Mittlere Sammlung Anm. 497.
185 Wie hier allgemein von dibbānaṃ rūpānaṃ dassanāya die Rede ist, vom Wahrnehmen himmlischer Erscheinungen, himmlischer Abbilder, d.h., nach den genau eingehenden Ausführungen des Gegenstandes in der 128. Rede der Mittleren Sammlung, vom Anblick der Umrisse: ebenso auch hat Asoko auf seiner 4. Felseninschrift, und zwar mit denselben Worten, darauf hingewiesen, divyāni rūpāni dasayitpā. Vergl. Anm. 80.
186 nu kho mit S, nicht pana.
187 So mit S; desgl. dann mayā saddhiṃ und auch mit C te dve.
188 Mit S immer na kallaṃ; wird als āṇā mā oder lapis Heraclius durchprobiert.
189 Vergl. Mittlere Sammlung No. 90.
190 'pare hier avagrahisch zu lesen, nach ROBERT L'ORANGE, und dann erst pare. – Zum ganzen Absatz, der gewisse feinere Ordensgepflogenheiten darstellt, cf. der Mittleren Sammlung 103. und 104. Rede; dann auch die 101 ste.
191 Der hier und überall der gotamidischen und, wie ROBERT L'ORANGE erkannt hat, jeder echt illuministischen Rede eigentümliche Topus vom Weiterschreiten auf dem Wege, Schritt um Schritt, ist ebenso von Asoko auf seinen Inschriften wiederholt worden, und zwar als paṭipajati Felseninschrift 14, als anupaṭipajati Säuleninschrift 2 und 7 (hier fünfmal), und schon als saṃpaṭipādayati Säuleninschrift 1 und 7; passim, e.g. Dhauli 2 i.f.
192 rajojalladharo mit S, C etc.
193 Zu all diesen Bußübungen cf. die vedischen Nachweise in der Mittleren Sammlung Anm. 275. – Eine dankenswerte Vergleichung verwandter Stellen aus dem Lalitavistaras und ähnlichen Werken hat DUTOIT gegeben, Die duṣkaracaryā etc., Straßburg 1905, doch mit etwas kühnlichen und ernstlichen Verschlimmbesserungen, die das Verständnis erschweren. So könnte z.B. bei sāmākao = mūlakao vielleicht auch an schwarzbraune Rettigwurzeln gedacht werden, keinesfalls aber an die allzu billig bei BÖHTLINGK eingekaufte Hirse, da diese bekanntlich nicht zu den wild wachsenden Pflanzen gehört, von denen jene Büßer strengster Observanz ihr Leben fristen.
Die kommentariellen Küster und Kirchmeier geben uns bei dergleichen Dingen wie sonst ihre gewohnten zuverlässigen Aufschlüsse nach der Regel: Je je, seggt dei Bur, denn weit hei nicks mihr.
194 avyābajjham zu lesen.
195 karuṇā- und dann muditācittam nach L'ORANGE zu lesen. – Zu dem hier dargestellten brahmavihāro, der heiligen Heimkehr in Liebe, Erbarmen und Freude, cf. Bruchstücke der Reden v. 151 und Anmerkung. Auch der Kommentar, den L'ORANGE dazu gegeben, wird das Verständnis erleichtern. Er sagte: »Die erste Regung zum Besseren zeigt sich in dem augenblicklichen Mitleid beim Anblick eines bemitleidenswerten Wesens. Es ist das die gröbste Reizung des moralischen Nerven, daher nur [642] ganz Stumpfe darauf nicht reagieren. Man spricht von einem ›menschlichen Rühren‹ bei Tyrannen usw. – die Weiber –. Es ist, glaube ich, ein Sichrühren des innersten Gewissens, und die dadurch bewirkte Tat ein Tribut, eine Abfindung der inneren Stimme. Nennt man aber die dauernde, uninteressierte Hingabe an andere Moral, so fängt sie, glaube ich, mit der mettā, dem Wohlwollen, der Philanthropie, deren meist nur die Männer fähig sind, an. Dieses uninteressierte, nicht bloß natürliche, d.h. tierische, Wohlwollen erstreckt sich zunächst auf die eigenen Angehörigen, und sein Merkmal ist Ausübung auch wenn der Sohn z.B. ›aus der Art schlägt‹. Dies Wohlwollen sickert dann immer mehr durch, bis es zuletzt keinen innerlichen Unter schied mehr kennt zwischen nichtfremd und fremd, bis es keinen ›Feind‹ mehr aus seinem gocaro ausschließt, bis es die ganze Welt in abstracto mit Wohlwollen betrachtet. Steigt nun ein Mensch höher, so, daß er eine gewisse Leidlosigkeit erlangt und zugleich das dauernde, fortwährende Leiden aller Wesen erkennt, so wird sich in ihm ein dauerndes Erbarmen (karuṇā, SCHOPENHAUERS Mitleid ist bloß anukampā) mit allen Wesen einnisten. Steigt er noch höher, und erkennt die Möglichkeit der Rettung für jedes Wesen, so wird die Freude, muditā, eintreten. So wenigstens denke ich mir die ersten Anfänge der lokuttaradhammā brahmavihārā.«
Die vierte und letzte Stufe des brahmavihāro, der Gleichmut oder das unbewegte Gemüt, ist hier nicht genannt: wohl aber, wie sonst, gegen Ende der 13. Rede.
196 Ganz im gleichen Ton, dukkaraṃ sāmaññam, mit einem ebensolchen »Gemeinplatz« am Anfang, hat Asoko seine fünfte Felseninschrift eröffnet, kalāṇaṃ dukaraṃ, Girnār Zeile 1. Den Ausdruck pakati, Gemeinplatz, gebraucht er als pakitī auf der zweiten iddāpurer Felseninschrift gegen Ende, I Zeile 12, II 19, III 9. Vergl. noch die schöne Beglaubigung unserer pakati schon durch MEGASTHENES in dessen wörtlicher Umschreibung des Ausspruchs, angegeben Mittlere Sammlung Anm. 205.
197 Vergl. Bruchstücke der Reden v. 406 Anm.; MERSWIN sagt Mistlache. Dasselbe, aber freilich ganz anders, besagt der akusmatische Ausspruch: Τι δε αληϑεστατον λεγεται; ότι πονηροι οἱ ανϑρωποι, von IAMBLICHOS in seinem pythagorischen Leben Kap. 18 überliefert.
198 yadidam adhivimutti mit S.
199 no ca suññāgāre nadatīti noch mit S. – Zu sīhanādaṃ nadati cf. Bruchstücke der Reden, Anm. 1015; auch im Mahāvastu III 55 erhalten: osiṃhanādaṃ nadāmi.
200 Mit S Tatra mam aññataro te sabrahmacārī Nigrodho nāma paribbājako adhijegucche pañham pucchi.
201 Zur folgenden richtigen Textfassung cf. Bruchstücke der Reden Anm. 5471. Der Topus ist in das zweite Divyāvadānam, p. 49, übergegangen: labheyāhaṃ bhadanta svākhyāte dharmavinaye pravrajyām upasaṃpadaṃ bhikṣubhāvam, und im neunzehnten, p. 281, weiter ergänzt: careyam ahaṃ bhagavato 'ntike brahmacaryam.
202 Zum Titel dieses Stückes cf. der Mittleren Sammlung II. Rede, auch Lieder der Mönche v. 177 und Anm.; zur früheren Lebensgeschichte des Nackten Büßers Kassapo dessen Begegnung mit Bakkulo, Mittlere Sammlung Nr. 124. – Die ekavūpakaṭṭhā ist prabhutvam der gotamidischen Nachfolger, durchaus; wenn auch bei bakkulischen Geistern schärfer geprägt, denen zumal der Nashornstempel aus den Bruchstücken der Reden zukommt. Wie kräftig diese Erkenntnis bis in das spätere Vaipulyam erhalten war, zeigt z.B. Divyāvadānam p. 294, wo eben der echte ekacārī khaḍgaviṣāṇakalpaḥ gleich von Anfang an genau überliefert ist, zeigt ferner die Kunde von unserem Bakkulo auch im chinesischen Kanon, BEALS Catena p. 378. Nb noch Bruchstücke der Reden, Anm. 5473: da endlich geht das so schwer lösbare diogeneische [643] und dann makarische Exempel σπουδαζειν λανϑανειν ανϑρωπους urasketentümlich auf.
203 Mittlere Sammlung Anm. 158.
204 surākathaṃ mit S; vergl. Anm. 7. Zum ganzen Topus noch Mittlere Sammlung Anm. 171; auch unseres VINTLER Blumen der Tugend, v. 8576/9:
So sol man mit narren eben
alzeit von narrenwerch reden:
wan chainem narren gevellet nicht,
wann man von weishait mit im spricht.
205 Der altvedische Glaube an die Zauberkraft überlegener Geister ist bekanntlich neuerdings bei uns unter dem Titel Hypnose und Suggestion wieder zu Ansehn gekommen; und zwar auf zwei Doppelgebieten, auf dem der Pathologie und der Therapie, sowie auf dem des Somnambulismus und des Spiritismus, mit der bequemen Spaltung in subjektives und objektives Ego: freilich bei oft noch gröberer, wilderer Spekulation als in den Traumgebilden unserer Vorfahren.
206 Mit S yo imesaṃ dhammānaṃ sukusalo ti. bhagavā bhante kusalo, bhagavā pakataññū abhisaññānirodhassa.
207 Mit S ādito va nesam; C ādito va tesam.
208 Mit S besser uppajjati pi, nirujjhati pi.
209 Mit S ayam pi sikkhā ti bhagavā avoca, passim.
210 ākāsānañcāyatanasukhumasaccasaññā mit S.
211 Mit S yan nūnāhaṃ na ceva ceteyyaṃ na ca abhisankhareyyan ti. Dann so na ceva ceteti na ca abhisankharoti. – Eine Zusammenfassung der wichtigen zur Unterscheidung gehörigen Stellen aus der Mittleren Sammlung habe ich in den Süddeutschen Monatsheften, Februar 1906, versucht. In gleicher Bedeutung ist sankhāro noch im Tārkyam nachzuweisen: saṃskāramātrajanyaṃ jñānaṃ smṛtiḥ, so Tarkasaṃgra hasūtram 34. Im Mahāyānam ist übrigens diese ganze Art der Betrachtung bis zur letzterreichbaren Stufe der Aussicht wiedergegeben und endlich phantasmasophisch reflektiert, zumal in der Aṣṭasāhasrikāprajñāpāramitā, wo schon in den ersten Abschnitten viele Stellen unseren Text behandeln und entwickeln, auch formal dieselben Wendungen gebrauchen, wie tat kiṃ manyase oder tena hi ṛṇu sādhu ca manasikuru u.s.w., u.s.w., während alsbald immer tiefere Fragen zur Sprache kommen, z.B. der tathāgato als apratiṣṭhitamānaso, der bodhisatto als asaktatāyāṃ ikṣate und sa nirvāṇam api na manyate erklärt wird, ed. RĀJENDRALĀLAMITRA p. 37, 18, 9; 16, 34: gute Belege für die streckenweise vortreffliche Überlieferung.
212 Mit S. api nu kho te. – Zum gegebenen Stempel cf. Mittlere Sammlung Anm. 504 i.f.; auch Bruchstücke der Reden v. 1115.
213 Mit S ekañ ceva nu kho. Zur Sache: Mittlere Sammlung S. 430.
214 iminā pi kho etam zu lesen; C iminā kho etam, S ca kho.
215 Vergl. Anm. 38; dann Anm. 39.
216 Vergl. Anm. 42 s.v. arūpajñaḥ. – Die drei Urstände oder selbstentwickelten Phasen, formhaft, geisthaft, unkörperlich, findet man bei ECKHART angegeben als Obsein aller Leiblichkeit, Entfremden aller Bildlichkeit und bloßes Verstehn ohne Mittel, ed. JOSTES p. 23.
217 Mit genauer Kenntnis und Anwendung obiger Stelle hat Asoko ebenso auch schon seine erste Säuleninschrift auf gleicher Grundlage begonnen, Mathia Zeile 2-3: ...aṃnata agāya dhaṃmakāmatāya, agāya palīkhāya, agāya susūsāya, agena bhayena, agena[644] usāhena; dasselbe dann auf den Felseninschriften dreimal wiederholt, cf. Mittlere Sammlung Anm. 173 und Lieder der Nonnen Anm. 517. – Zur Sache noch Mittlere Sammlung S. 792.
Für Begriff und Bedeutung der Geduld ist v. 188/189 der Bruchstücke der Reden nebst Anmerkung wichtig. Vergl. auch später Harṣacaritam, ed. Bombay 1897 p. 12:
kṣamā hi mūlaṃ sarvatapasām:
Geduld ist Wurzel aller Büßerschaft.
218 bhavam Poṭṭhapādo mit S, C etc.
219 viññū puriso mit S; zum topischen subhāsitam, das Asoko wiederholt, cf. Anm. 173. – Die Gründe der Ablehnung dünkelkluger Lehren sind vielleicht nie tiefer gesehn und aufgewiesen worden als in der 75. Rede der Mittleren Sammlung.
220 hatthisāri: hatthāroho cf. Mittlere Sammlung No. 51 im Anf.
221 te paribbājakā mit S.
222 dhammaniyāmataṃ mit S, viermal; ebenso besser dhammaṭṭhitataṃ. Vergl. Anguttaranikāyo, Tikanipāto No. 134.
223 Api ca pana mit S, passim.
224 sampajānathā ti S, C etc. sic passim.
225 Vergl. Mittlere Sammlung S. 588; zur Erklärung von pāṭihāriyam etc. ib. Anm. 150. – Die Antwort Poṭṭhapādos ist mit S zu lesen.
226 Zur janapadakalyāṇī des Gleichnisses cf. die konkrete Avantisundarī, in der Karpūramañjarī, I II, u.a.m.
227 majjho mit S.
228 Die hier bis zum letzten Grade durchgeführte Lehre vom Verlieren der Selbstentwickelung ist auf den Begriff von der Auflösung der Persönlichkeit gegründet, des sakkāyanirodho; cf. Bruchstücke der Reden, Anm. zu v. 231. Der kāyo oder Leib stellt nämlich zunächst die äußere Person dar: er ist aber zugleich der Ausdruck ihrer Natur und Eigentümlichkeit in geistiger Entwickelung, nach indischer Ansicht, wie ROBERT L'ORANGE richtig erkannt hat: vergl. BÖHTLINGK-ROTH Wörterbuch1 s.v. kāyao II No. 7. Die Entäußerung von aller natürlichen, eigentümlichen Beschränkung ist nun die Auflösung der Persönlichkeit bis zu den höchsten Geistesgraden; oder mit den Worten Meister ECKHARTS: Die Vermögenheit des Wesens ist, daß es sonder Persönlichkeit ist: ed. JOSTES p. 15. Die Auflösung der Persönlichkeit und Selbstentwickelung im letzten Grade kann also nur einer aller Fähigkeiten vollkommen mächtig gewordenen Persönlichkeit gelingen, die jede umschränkende Hemmung oder Verwickelung abgestreift (vergl. Anm. 277), auch das zarteste Vermeinen überwunden (Bruchstücke der Reden v. 588 Anm. gegen Ende), die unverbrüchliche, durchaus reine Armut errungen hat (Mittlere Sammlung 121. Rede). Vorstufen hierzu sind die aṭṭha vimokhā, aṭṭha abhibhāyatanāni, dasa kasiṇāyatanāni: die acht Freiungen, acht Grade der Überwindung, zehn Orte der Allheit, Mittlere Sammlung 77. Rede S. 568-570, vergl. auch die 137. Rede S. 1009f.: Staffeln, die bei uns erst SCHOPENHAUER in seiner Ästhetik der Kunst neu entdeckt hat; mag auch diese Entdeckung heute noch ziemlich ebenso behandelt werden wie zur Zeit des GALILEI die kopernikanische, die, nebenbei bemerkt, von unserem großen Sternenforscher Āryabhaṭas tausend Jahre früher schon mathematisch bewiesen war. Vergl. noch Anm. 1000 u. 1047.
229 Mit C etc. olāriko v'assa, oder mit S oḷāriko p'assa zu lesen.
230 Mit S so yeva te, dann so yeva me.
231 tasmiṃ samaye zu lesen.
[645] 232 Das Gleichnis führt eine volkstümliche Wendung der Upanischaden aus, z.B. nach der vetā vatarā 4 16; ghṛtāt paraṃ maṇḍam ivātisūkṣmaṃ jñātvā ivaṃ sarvabhūteṣu gūḍham, und dergl. mehr.
233 Vergl. Bruchstücke der Reden v. 588 nebst Anm. – Eine bei gar fern abkünftiger Entwickelung innig zuständige Erkenntnis hat der so tapfere als zarte GUTIERRE DE CETINA einmal ausgesprochen, in seinem großartigen Lied A la esperanza, gegen Ende:
No se dilate mas nuestra partida,
Que al que se ha de morir, muerte le es vida.
Dagegen beschäftigen sich mit dergl. mehr oder minder faulen und phantastischen Weltansagen, Weltauskünften u.s.w. recht eigentlich als kraulende Traumdeuter all die lokāyatās oder sog. Weltweisen, deren brodelnden Wissensqualm eben Gotamo am Ende der obigen Rede von sich gewiesen hat; und zwar wiederum nicht weniger fein bestimmt als wenn unser divus BERNARDUS gelegentlich von sich sagt: meum non est docere doctores.
234 Erloschen, parinibbuto, ein Ausdruck für das Ende des Heiligen; bei anderen andere Wendungen, wie kālaṃ karoti »die Zeit erfüllen« u.ä.m., vergl. Mittlere Sammlung 1033. Bei uns ein verwandter mhd. Begriff: menschlichez reht begên = sterben, im vollen Umfange des Wortes.
235 Über Subho und seinen Stamm unterrichtet die Anmerkung zu v. 1088 der Bruchstücke der Reden. Er war ein Todeyyer.
236 nivesanam: das wohlbekannte indische Landhaus, mit weiter Veranda, breiter Terrasse, geräumigem Garten; durch ein Wort kaum zu vermitteln, am besten etwa noch durch die spanische ubicacion. – Der begleitende Mönch ähnlich bei SAN FRANCESCO.
237 Dieser Angabe gemäß hat Gotamo selbst sich Wegweiser, Lenker, samādapetā, genannt, in der 107. Rede der Mittleren Sammlung; und wie eben Ānando oben vom unterweisen, lenken der Leute spricht, imaṃ janataṃ samādapayati: geradeso hat Asoko dann gleich auf seiner ersten Säuleninschrift Wort und Begriff ausgezeichnet wiedergegeben, Delhi-Sivālik Zeile 8: alaṃ capalaṃ samādapayitave, »imstande sein, Unbeständige zu lenken.« Die Anwendung dieses vollkräftigen, sonst nur in unseren Texten und da schlechthin als terminus technicus gern gebrauchten samādapayati ist für den königlichen Redner und seine Zeugenschaft ungemein bezeichnend.
238 Was hier unter Unmut, kukkuccam, im weiteren Begriffe zu merken sei, hat mir einmal ROBERT L'ORANGE recht genau erklärt. »Ich weiß jetzt«, sagte er, »was kukkuccam bedeutet: ku-kṛta-ya = Reue, ›hätte ich das doch anders gemacht‹, iti, lippennagende Scham, verzehrende, falsche, selbstsüchtige Reue, verletzte Eitelkeit, drückendes Gefühl (mortification) sich blamiert zu haben – die Kehrseite von uddhaccam, Hochmut, Stolz; die Probe stimmt: der Eitle, Hoffärtige sowohl wie der sich über Blamage Grämende sind Sklaven anderer: wer den Frieden gefunden hat, ist beider Dinge ledig.«
239 vāham zu lesen, wie früher; S und C cāham.
240 Nāḷandā mit S nach Mahāparinibbānasuttam p. 103-106 zu lesen; C immer, wie S hier, Nālandā.
241 So mit S und C.
242 Mit S besser ṭhapesim.
243 Auch mit S und C maṇikā nāma vijjā zu lesen: die Kunst aus dem Spiegel im [646] Wasserbecken wahrzusagen, nach den alltäglichen tausend einzelnen Lebensfratzen. – Vergl. S. 53.
244 idaṃ vuccati mit S. – Vergl. hier Asokos Wort von der Bekehrung, in der Anm. 164. Genau aber in der gleichen geläufigen Ausdrucksweise mit unserem obigen Satze ist idam pajahatha, idam upasampajja viharatha auf der sechsten Säuleninschrift vom Könige wiederholt worden, Delhi-Sivālik Zeile 3: se taṃ apahaṭā, taṃ taṃ dhaṃmavaḍhi pāpovā, d.h., in BÜHLERS schöner Übersetzung: saḥ tad apahṛtya, tāṃ tāṃ dharmavṛddhiṃ prāpnuyāt, Epigraphia Indica II 269. Es ist dieselbe tiefe Erfahrung, der auch DEMOKRIT wiederholten Ausdruck verliehn, so in No. 33 bei DIELS: ή φυσις και ή διδαχη παραπλησιον εστι και γαρ ή διδαχη μεταρυσμοι τον ανϑρωπον, μεταρυσμουσα δε φυσιοποιει: nach anderer, aber ebenso kräftiger Wendung in den Bruchstücken der Reden, Anm. 404; ein schönes Beispiel für das Verhältnis der ursprünglichen Gleichheit der Anschauung und Darstellung zweier Meister, deren einer oben anschlägt oder kulminiert: bei feinerer Betrachtung etwa durch die mantegnische Ma della Vittoria gegenüber der allegrischen Ma di San Francesco viel leicht am besten sich ohne große Mühe verständlich zu machen.
245 Mit S brahmuno h'etam pubbanimittam. – Vorher klingt sehr deutlich Ṛgvedas X 129 i.f. an: Iyaṃ visṛṣṭir yata ābabhūva ... so anga veda, yadi vā na veda. Damals gewiß noch ein alsbald erkannter Auftakt, ist das weitergeführte Motiv später bis nach Tibet etc. populär geworden, unctiori quasi modo loquendi, nach machiavellischer Melodie: Il timor di Dio facilita qualunque impresa ecc. Illuministen natürlich ist der ursprüngliche vedische Ton immer vernehmbar geblieben, so auch z.B. unserem JAKOB BÖHME, wenn er in seinen Drei Prinzipien göttlichen Wesens 4, 8 gar schön sagt: »Wo willst du Gott suchen? In der Tiefe über den Sternen? Da wirst du ihn nicht finden! Suche ihn in deinem Herzen, im Centro deiner Lebensgeburt: da wirst du ihn finden, u.s.w.« – Zum Dämmerglanze cf. Brahmā jyotsnā tanuḥ, Bhāgavatapurāṇam III 20 39 auch ivas als »Tänzer im Dämmerlicht«, saṃdhyānāṭī, mit den khiḍḍāpādosikā, oben S. 16f. u. Anm. 25.
246 S abhimuñcitvā, wodurch atisitvā auch Anguttare III No. 38 klar wird.
247 Mit S te atīradassiniyā nāvāya tīradassiṃ sakuṇam muñcanti. – Über die Inder als Seefahrer s. Mittlere Sammlung Anm. 267.
248 tathā pakkanto va hoti mit S.
249 Mit S evam eva kho tvam bhikkhu yato yāva brahmalokā pariyesamāno imassa pañhassa veyyākaraṇena ajjhagamā, atha kho mayham eva santike paccāgato.
250 Vergl. Bruchstücke der Reden v. 1037 Anm. und 1114; zur richtigen echten Form paham = pajaham cf. paheyya = pajaheyya, e.g. Anguttaram IV 5 2. Die kommentariösen Schwulitäten sind in der Mittleren Sammlung, p. XXIX angezeichnet. Dagegen hat Yājñavalkyas den gleichen Standpunkt eingenommen, Bṛhadāraṇyakā III 8; und bei uns ist Meister ECKHART der obigen Erkenntnis auch in der Ausdrucksweise recht nahe gekommen, indem er sagt, »daz die sele in disem obersten bild nie creatur in bekante alz creatur, noch nie inbesaz zeit noch stat: wann in disem bild sein alleu dink got, sa r und s ezz, gůt und boz und klein und groz, di sein all geleich in disem bild«: ed. JOSTES p. 90. Dies Bild ist aber nach p. 89 = »diz oberst lieht«.
251 Ein solches Schauen von Angesicht ist ähnlich von unserem ECKHART u.d.T. »lichtes Anstarren« gepriesen und erklärt worden, wo er Maria Magdalena selig sagen läßt: »Herre, sprich fürbaß, lass' die Unbekannten klaffen«: ed JOSTES p. 62. Es ist unverblümt ein zart westöstliches caniṣṭham.
252 So auch S und C.
[647] 253 Avocumhā kho mayam mit S. Dann: adhivuṭṭhañ ca.
254 ajjhāvasasīti mit S, C etc.
255 Mit S besser micchādiṭṭhikassa. – Vergl. Mittlere Sammlung 836.
256 Kāsi, die wohlbekannte reiche Landschaft der mittleren Gangesebene, mit Benāres; Kosalo im Nordwesten, mit weitem Waldgürtel, prächtigen Waldgehägen zumal bei Sāvatthī und um Sāketam. Vergl. Bruchstücke der Reden Anm. 1012.
257 visesam mit S, C etc. zu lesen. – Vergl. Mittlere Sammlung No. 89 gegen Ende.
258 Mit S osakkantiyā vā u]s]sakkeyya; zu parammukhī cf. parānmukhībhavati. Ein Gleichnis verwandter Art in der Mittleren Sammlung S. 784f. – Vergl. TRENCKNER, Pāli Miscellany p. 60 zur etymologischen Entwickelung von osakkati.
259 Der hier, wie oft in der Mittleren Sammlung, gegebene Topus: Idaṃ vo hitāya, idaṃ vo sukhāya, ist auch wieder bei Asoko zu finden: Idaṃ sādhu, idaṃ katavyaṃ, und zwar ebenso als Ausspruch angewandt, beispielsweise angeführt; so auf der neunten Felseninschrift, Girnār Zeile 6, und wiederum Zeile 8, desgleichen auf der elften gegen Ende, ib. 3. – Am erstgenannten Orte ist dann maṃgalaṃ āva weiterzulesen: »heilsam ist es um« etc.
260 Mit S ayaṃ kho, passim. – Zur anakoluthen Wendung cf. Bruchstücke der Reden Anm. 7232.
261 kesesu vā gahetvā mit S und dann evam evāham auch mit C, wo vorher die Alternative narakapapāte patantaṃ nebenbei recht annehmbar klingt. – Zu narako cf. Jātakam No. 483, p. 268/9, narako = Sumpf.
262 Lies Manasākhātam; S okatam.
263 Bhāradvājo pi mit S.
264 addhariyā brāhmaṇā-tittiriyā brāhmaṇā, chandokā brāhmaṇā, bavharicā brāhmaṇā zu lesen. Es sind die stets im kurzen Trichord insgesamt überlieferten vielfachen ṛksāmayajurvedinas: die trayīmukhās, traividās, Dreivedenpriester; die je nach ihrem Amt bei der vedischen heiligen Handlung als Altar-und als Opferpriester adhvaryus und hotā, als Sangespriester udgātā und viertens als überwachender Spruchpriester bahvṛcabrahmā angegeben, zusammen den Inbegriff der Priesterschaft ausmachen, wie die ruti sagt, atapathabrāhmaṇam XIII 4, 1, 4, gemäß dem schönen Liede der Ṛksaṃhitā X, 71 i.f.
265 Recht in Beziehung auf maggakkhāyī, Mittlere Sammlung, No. 107 i.f., stehn hier die kollektiven nānāmaggāni gegen nānāmagge vorher; maggāmaggo ist, nebenbei gesagt, als āmreḍitam nach dem Muster gāmā gāmam, TRENCKNERS Pāli Miscellany p. 74 zu erklären. – Vāseṭṭho spricht genau nach der vedischen Überlieferung, z.B. Bṛhaddevatā 2 21:
Adhyāpayannadhīyāno
mantraṃ caivānukīrtayan,
sthānaṃ sālokyaṃ sāyujyam
eteṣām eva gacchati.
Vergl. noch brahmaṇah sāyujyaṃ salokatām āpnoti in der Mahānārāyaṇopaniṣat 12 3 und die weiteren Nachweise bis zur Chāndogyā und Bṛhadāraṇyakā bei JACOB, Upaniṣadvākyako as s.v. salokatā.
266 Vergl. Mittlere Sammlung Anm. 288.
267 te va mit S.
268 So besser mit S.
269 Mit S aññe vāpi bahū janā.
[648] 270 Mit S tesam pi pahonti tevijjā brāhmaṇā.
271 samatitthikā richtig mit den barmanischen Handschriften zu lesen, gemäß der Anschauung; z.B. bei Benāres, wo ich einmal zur Regenzeit den Ganges herabgefahren bin, der dann bis zur obersten Stufe der Badeplätze heranreicht, schon den zahllosen Krähen dort am Rande schlürfbar geworden.
272 ehi pārāpāram, ehi pārāpāran ti zu lesen, d.i. pāra apāram. – Vergl. Pra nopaniṣat i.f.
273 Die verkörperten Titel oder indices gloriosi als nom. pr. sind: Indra-Soma-Varuṇa-Ī āna-Prajāpati-Brahma-Maharddhi-Yamas. – Lies dann te ca mit S.
Die beste, auf eigene Anschauung und Erfahrung gegründete Darstellung dieser ebenso heute noch mit unendlicher Sorgsamkeit vollzogenen Priestergepflogenheiten gibt COLEBROOKE in seinen Miscellaneous Essays1 I No. IV, I-III, prachtvoll sinngemäß verarbeitet.
274 kāmachandabandhā S, lies kāmacchandabaddhā.
275 āvaraṇā nīvaraṇā onahanā pariyonahanā zu lesen; dann besser mit S āvuṭā nivuṭā und nach Majjhimanikāyo III p. (siam.) 247 ovuṭā.
276 kinti mit S, C etc.; vergl. S. 71.
277 Umschränkt: nämlich von Haus und Hof, Weib und Kind, Knecht und Magd u.s.w. Vergl. Bruchstücke der Reden v. 769, 770 mit 779.
278 vijjati mit S, C etc.
279 sukhataram mit S.
280 Mit S yathā paṭipanno ca brahmā brahmalokam upapanno. – Vergl. die erste Rede, S. 15.
281 Diesem Topus ime pañca nīvaraṇe pahīne sive pahāya zieht die Mittlere Sammlung immer cetaso upakkilese noch erklärend hinzu; und der letztere Begriff ist auch in einigen der jüngeren Upanischaden gegeben, wie etwa in der vetā vatarā I, 11: kṣīṇaiḥ kle air janmamṛtyuprahāṇiḥ: nebst anderem da zusammengestückten Gute unverkennbar übernommen.
282 Den wohlbekannten Wahlplatz vom liebevollen Gemüte zur ganzen Welt, der den Schwerpunkt dieser letzten Rede anzeigt, hat Asoko in der zweiten Hälfte seiner sechsten Felseninschrift in dreimaliger Verstärkung begangen. Erst für sich: »Denn ich muß zu wirken bedacht sein auf das Wohl der ganzen Welt«: katavyamate hi me sarvalokahitaṃ; »dafür aber ist das die Grundlage: Emsigkeit und Pflichterfüllung«: tasa ca puna esa mūle, uṣtānaṃ ca athasaṃtīraṇā ca. Dann folgt die zweite Wiederholung unseres Topus, und zwar diesmal als Denkspruch, nach den vier Fassungen auf den Felsen zu Girnār, Ṣāhbāzgarhī, Mansehra und Kālsī in gleicher Strophe überliefert:
Nāsti hi kaṃmataraṃ
sarvalokahitatpā.
Das heißt, ein paar Jahrtausende später, ebenso bündig gesprochen:
Und das Wohl der ganzen Welt
Ist's, worauf ich ziele.
Nun erklärt es uns der König: Ya ca kiṃci parākramāmi ahaṃ, kiṃti bhūtānaṃ ānaṃṇaṃ gacheyaṃ: »Was ich aber irgend auch zu erreichen trachte, es ist um vielleicht der Wesen leidiges Los mindern zu können«, idha ca nāni sukhāpayāmi, »hienieden schon manche zu beglücken, und daß sie«, ganz wie die Rede an Vāseṭṭho lautet, »nach dem Tode in himmlische Welt eingehn sollen«, paratrā ca svagaṃ ārādhayaṃtu. »Eben zu [649] solchem Zweck ist die Satzung dieser Inschrift eingemeißelt worden«: Ta etāya athāya ayaṃ dhaṃmalipī lekhāpitā, kiṃti: »und warum? Auf daß sie lange bestehe, und meine Söhne und Enkel und Urenkel danach sich richten mögen, der ganzen Welt zum Heile«, wie nun Asoko zum drittenmal unsere Losung wiederholt: ciraṃ tisṭeya iti, tathā ca me putrā potrā ca prapotrā ca anuvata rāṃ sarvalokahitāya. Dann endlich siegelt er seine Inschrift mit dem Schlußworte: Dukaraṃ tu kho idaṃ añata agena pārākramena: »Schwer aber kann das gelingen, es sei denn mit höchster Beharrlichkeit.« – Saxa locuta sunt aruṇāṃ anayena, cf. Anm. 195, quis redarguerit?
283 Stets iti pi mit S. – Die Hollunderkapper ist wohlbekannt als eine weißblühende mächtig hohe Kapparide, die Staude Capparis trifoliata, der Kareri-Baum. Solche und andere Laubenterrassen, mit dahinterliegender Halle und Einsiedelei, waren von Anāthapiṇḍiko, dem begüterten Gildemeister und Almosenspender, in seiner Gartenstiftung für die Jünger aus den vier Weltgegenden errichtet worden, für die kommenden und gehenden, für die angelangten und für die künftigen Pilger und Ordensbrüder. Vergl. Die Letzten Tage Gotamo Buddhos, I. Auflage, München 1911, Beigabe V. Zum Namen oder vielmehr Titel Anāthapiṇḍiko cf. Mittlere Sammlung Anm. 521; ähnlich Anāthanātas, der Schützer der Schutzlosen, in v. 25 von Vatsabhaṭṭis Inschrift zu Mandasor, auf einem Sonnentempel, den die Gilde der Seidenweber daselbst errichten hatte lassen: S. FLEET, Gupta Inscriptions p. 81 nebst Tafel, Corpus Inscriptionum Indicarum vol. III.
284 Die obigen Zahlenperioden, aus mythischer Vorzeit überkommen, betrachten den Menschen aus einem sozusagen geologischen Augenwinkel, wo die Einheit immer einer Tausendheit entspricht. Eine derartige Anschauung, so ungeheuerlich sie uns auch erscheinen muß, mag indessen bei anderen Erden und Planeten, die – wie etwa Jupiter oder Bṛhaspatis – tausendmal größer sind, virtuell möglich sein. Da nämlich alle Raum- und Zeitverhältnisse relativ gelten, würde auch dort der Lebensinhalt quantitativ derselbe sein; wie er es der Qualität nach – Entstehn und Vergehn – sicher ist. Vergl. noch Mittlere Sammlung Anm. 200. Übrigens sind dergleichen Ausführungen, obzwar gut indisch, Gotamo nur in den Mund gelegt: der Meister selbst hat ja solche »Weltansagen, Weltauskünfte«, als unberührsam für ihn, abgewiesen: 9. Rede S. 143. Zur Dauer der Weltperioden selbst cf. Mitte des ersten Abschnitts der 23. Rede. Ferner das sehr alte Gleichnis der Kaṭhopaniṣat VI I vom immerwährenden Lebensbaum, gegenüber unserem Baum der Zeit Yggdrasil, beide mit Trillionen wogender Lebensblätterträume belaubt und wurzelnd im einigen Nunc stans. Jener unermeßliche Daseinsbaum ist von aṃkaras bei Erklärung der Upanischadenstelle schlechthin Baum der Wandelwelt, saṃsāravṛkṣas, genannt worden, mundi semper revolventis esse imaginem, wie A.W. VON SCHLEGEL sagt, Bhagavadgītā p. 237; worauf neuerdings, in umfassender Darstellung, ERNST KUHN hingewiesen hat, im Festgruß an BÖHTLINGK S. 70. Mit der folgenden Angabe, daß jetzt das Leben des Menschen, wenn er lange lebt, hundert Jahre betrage, oder etwas darüber, ist Mittlere Sammlung S. 691 zu vergleichen, wo bei einem Vedenpriester hundertzwanzig Jahre überliefert sind; eine Zahl, die auch dem geschichtlich beglaubigten Alter mancher koptischen Einsiedler entspricht, s. ebenda Absatz 2 der Anm. 239, während der Erste der ägyptischen Eremiten, PAULOS, »Eremitarum auctor et magister«, wie er in den Acta Sanctorum genannt wird, im hundertdreizehnten Jahre gestorben ist. Auch viel später noch hat man ein solches kanonische Lebensalter aufstellen mögen: so berichtet LEOPARDI von einem Buche, das ein Arzt aus Ravenna, TOMMASO GIANNOTTI, dem Papst JULIUS III. gewidmet hat, De vita hominis ultra CXX annos protrahenda, im [650] Dialogo di un fisico e di un metafisico n. 2; und sogar bei MOLIÈRE heißt es noch: Vous passerez les six-vingts, L'avare II 6. – Über das Verhältnis zu den Naturgesetzen im allgemeinen bei einer möglichen Lebensdauer eines Menschenwesens, dessen Altersgrenze je nach 40 Minuten oder 80000 Jahren und mehr zu bestimmen wäre, hat der altberühmte Zootom und Biologe K.E. VON BAER in seinen »Reden« 1864 eine Studie vorgetragen, von MAUTHNER im Wörterbuch der Philosophie eben jetzt (1910) wieder besprochen, II 603 s.v. Zeit resümiert und mit einer sehr berechtigten Folgerung abgeschlossen. BAER stellt die Hypothese auf, daß jener Minutenmensch mit seinem millionenmal rascheren Pulsschlag in seinem Leben dieselbe Anzahl von Sinneseindrücken und Erfahrungen wie wir hätte und, wie MAUTHNER nun des weiteren ausgezeichnet zusammenfaßt, »die Natur für unveränderlich halten, die Veränderungen an einer Pflanze oder einem Tier nicht bemerken würde, daß er ferner unsere 80-Jahre-Menschen-Töne gar nicht vernehmen, dafür aber vielleicht das Licht hören würde. Ob gewisse kurzlebige Insekten dieser Phantasie nicht entsprechen? Manche Erscheinung wäre dadurch erklärt. Nun hat BAER seine Phantasie in entgegengesetztem Sinne weitergeführt. Der Mensch lebt 80000 Jahre und empfindet mit tausendfach verlangsamtem Pulsschlag tausendfach langsamer. Er würde dann die Ereignisse eines Jahres in einer Zeit durchempfinden, die seinem Gefühle nach acht unserer Stunden entspräche, würde die Pflanzen wachsen und die Sonne über den Himmel jagen sehen. Noch einmal tausendfach verlangsamt, würde er den Unterschied von Tag und Nacht nicht mehr wahrnehmen, die umlaufende Sonne nur als glänzenden Ring sehen und den Wechsel der Jahreszeiten als Gebilde von der Dauer weniger unserer Sekunden empfinden. BAER benutzt seine gewaltige Phantasie, um zuerst das Scheinhafte des Individuums und aller irdischen Veränderungen, dagegen das Dauernde und Feste der Naturgesetze anschaulich zu machen und um schließlich mit einem Aufschrei mehr als mit Beweisführung gegen den Materialismus der Naturwissenschaft aufzutreten. Denkt man sich aber recht tief in seinen Traum hinein, so erfährt man, daß das Tempo des menschlichen Lebens, so wie es wirklich abläuft, eigentlich nur ein Spezialfall unter allen möglichen Fällen ist und daß die Sprache der Minutenmenschen, sowie die Sprache der Äonenmenschen, wenn sie beide unsere Sprache sprächen, doch nicht die gleiche sein könnte, daß die Sprache zuletzt von unserem Pulsschlag, von der Schnelligkeit unserer Sinneseindrücke abhängig ist. Und ich muß nicht erst meine Lehre bemühen, daß selbst die Entwicklung unserer Sinnesorgane eine Zufallsgeschichte ist, um jetzt mit Nachdruck zu wiederholen: alle unsere Erkenntnis der Wirklichkeit ist nur relativ.« Im Lichte dieser Ausführungen K.E. VON BAERS und F. MAUTHNERS können wir heute einigermaßen absehn, was für erstaunlich geläuterte hohe Naturanschauungen jene alten Inder mit ihrem Mythos von den Äonenmenschen vorausgeahnt hatten: als das einzige Volk, dessen Denker, einer reichen und großartigen Welt und Entwicklung entsprossen und darin gediehen zu Söhnen einer unvergleichlichen Zeit und Kultur, schon vor Jahrtausenden imstande waren sich über das gewöhnliche egozentrische Knabengefasel mit seiner kleinlichen Eintagseinsicht und Ephemeridenapokalyptik wie Adler über Sümpfe und Mücken zu erheben.
285 Der Trompetenbaum, pāṭalī, Bignonia suaveolens; der Lotusmango, puṇḍarīko, Artemisia Indica; der Kronbaum, sālo, Vatica robusta; die Akazie, sirīso, Acacia sirisa; die Doldenfeige, udumbaro, Ficus glomerata; die Luftwurzelfeige, nigrodho, Ficus Indica; die Pappelfeige, assattho, Ficus religiosa. Das Blatt je eines dieser Bäume ist in der Skulptur und Malerei zum Wappen oder Emblem geworden, zu Häupten je eines [651] dieser Meister angebracht, wodurch eine jede der sieben Gestalten bestimmt und gekennzeichnet ist. Sinn und Bedeutung des gotamidischen Wappens, des Blattes von der Pappelfeige, ist in den Bruchstücken der Reden Anm. 5 erklärt, Blatt und Baum auf Tafel IX und X der »Letzten Tage etc.« (München 1911) nach photographischen Aufnahmen wiedergegeben. Gotamo und die sechs Meister der Vorzeit mit dem künftigen achten, dem bodhisatto Metteyyo, erscheinen, noch leidlich erhalten, auf einem Freskogemälde zu Ajaṇṭā, über dem Eingang zur siebzehnten Felsenkammer. Künstlerisch wertvoller sind jedoch die acht kleinen Kupferbildnisse aus der Ruine des Kuppelmals bei Sopārā, im rein indischen Stil edel und anmutig, und ungemein sauber und fein ausgeführt, bis zu den auch botanisch genau nachgebildeten Blättern ober jedem der in asketischer Ruhe thronenden schlanken Meister, von deren Antlitz ein überirdisch unerschütterlicher Abglanz ausstrahlt; bei Metteyyo symbolisch in der Richtung nach Westen, in die Zukunft. Diese kleinen acht Antiken, je 8-10 cm hoch, stammen aus dem 2. Jahrhundert nach Chr. und sind jetzt im Empfangssaal der Asiatischen Gesellschaft in Bombay aufgestellt. Das Verdienst ihrer Entdeckung gebührt dem ausgezeichneten Forscher und Archäologen BHAGVĀNLĀL INDRAJI, der im Februar 1882 den Plan ausführte, in das noch 300 Jahre ältere, seit 17 Jahrhunderten wieder vermauerte Adyton des Kuppelmals bei Sopārā vorzudringen. Sopārā, wenige Stunden nördlich von Bombay in entzückender Lage, ist heute ein Dorf von etwa 600 Häusern mit einer Bevölkerung, die zu einem großen Bruchteil noch aus alten, rasseechten, aber ganz unwissenden Brāhmanengeschlechtern besteht. Zur Zeit Asokos, von dem auch hier ein Inschriftenstück auf Basalt gefunden wurde, muß aber Sopārā, das auch den Griechen als Σουπαρα wohlbekannt war, nach PTOLEMAEUS VII I, 6, eine mächtige blühende Stadt gewesen sein, wie dies insbesondere die großartigen Trümmer der alten Wasser- und Teichanlagen in der Umgebung deutlich anzeigen. Unser Kuppelmal nun, westlich vom Dorfe gelegen, wurde von BHAGVĀNLĀL INDRAJI zuerst oben aufgebrochen. Nachdem man durch den festgemauerten Ziegelwall bis nahe auf den Grund gekommen war, fand man dort eine glatte, polierte, gelbe Trachyttruhe eingebettet, bei 44 cm Höhe, 60 cm Durchmesser, hermetisch verschlossen, von bester alter Steinmetzarbeit. Bei der Eröffnung sah man in der Mitte eine kupferne Büchse in Eiform, rings umgeben von den kleinen acht kupfernen Gestalten. Das kupferne Ei, etwa 13 cm hoch, enthielt einen silbernen Tiegel, dieser eine Urne aus Sandstein, dann kam ein Kelch aus Kristall zum Vorschein, und dieser barg endlich als Kern eine Phiole aus feinstem ziselierten Golde, angefüllt mit einer Anzahl winziger Tonscherben, den Resten der einstigen Almosenschale Gotamo Buddhos. Diese vermeintliche Reliquie zu ehren hatte der Erbauer das Kuppelmal, ungefähr achtzig Jahre nach Asoko, errichten lassen, als Wahrzeichen der Andacht. Die fünf Gefäße, vom Ei an, waren innen mit 13 kostbaren Steinchen von siebenerlei Art und 295 aus Gold getriebenen zierlichen Blüten- und Blumensternen aller Gattungen, gleichsam zur Huldigung, beschüttet; in der letzten Phiole, die 4 cm hoch, wie das Modell eines gedoppelten Almosennapfes aussieht, lagen auf den Tonscherben, neben einem Glas- und Diamantsplitter, zehn goldene Blütensterne, »so glänzend«, wie BHAGVĀNLĀL INDRAJI sagt, »als ob sie eben erst hineingelegt worden.« Bei den Blumen, zwischen dem kupfernen und dem silbernen Behälter, befand sich noch eine Blattgoldscheibe, 3 x 2 cm, mit dem aufgeprägten sehr schönen Bildnisse Gotamos, auf dem Lotussitze, als lehrender Meister, den Lichtschein um das Haupt. Die Abbildungen aller dieser Gegenstände (nur schematisch) findet man auf den 21 Tafeln, die der Pandit seinem Bericht beigegeben hat, Journal [652] of the Bombay Branch of the Royal Asiatic Society 1883. Noch ältere Darstellungen der Bäume, bez. der Wappen Gotamos und der früheren Meister waren im Relief auf dem Kuppelmal zu Barāhat zu sehn, der Epoche Asokos ganz nahe; in CUNNINGHAMS Stūpa of Bharhut (1879) Tafel XIII, XXIX, XXX, LIII, LIV: jetzt sämtlich im Indischen Museum zu Kalkutta.
286 Cf. Bruchstücke der Reden Anm. 996.
287 Siehe Bruchstücke der Reden Anm. 5473. Hierin scheint die Angabe zu liegen, daß der Orden bei Lebzeiten des Meisters überhaupt nur soviel Jünger gezählt habe: entgegen den immer weiter geschichteten Übertreibungen des Vinayapiṭakam, das mit seinen so spärlich versprengten älteren Trümmern im ganzen sich nur als ein verwittertes und verkalktes Konglomerat kundgibt; vergl. z.B. Mahāvaggo, I, 21 Ende, den Bericht über die tausend Jünger mit der entsprechenden Stelle am Ende der 148. Rede der Mittleren Sammlung, wo es bei sechzig Jünger sind. Die Anzahl zwölfhundertfünfzig oder zwölfeinhalbhundert Mönche, aḍḍhateḷasāni bhikkhusatāni, ist sonst noch einmal zu Beginn unserer 2. Rede erwähnt, S. 36. D.J. GOGERLY, um 1839ff. Missionar in Kolombo, hatte da bereits, als der erste Übersetzer, richtig »1250 priests« wiedergegeben, BURNOUF jedoch, etwas später, fälschlich »treize cent cinquante Religieux«: bei GRIMBLOT, Sept Suttas pâlis, Paris 1876, p. 166, 189. In OLDENBERGS Übersetzung der Stelle, Buddha, 5. Aufl. S. 169, heißt es (nachdem vorher S. 164 am Ende der Anmerkung – am Anfang spuken immer noch jene »hunderttausend« statt tausend, wie längst Bruchstücke Anm. 5473 gezeigt – schon die wahre Zahl stand) recht flüchtig: »mit drei Hunderten von Mönchen«; wie auch noch letzthin WINDISCH die nichts weniger als unklare Ziffer wieder auf die ältere Weise mißdeutet hat, indem er sagt: »Er hatte nur eine Schar von Anhängern, der Zahl nach dreizehn und ein halbes Hundert«, bei Behandlung dieser Stelle aus unserer obigen Rede, Abhandlungen der königl. sächs. Gesellsch. d. Wissenschaften, phil.-hist. Kl. Bd. 26, Leipzig 1909, S. 97 des 2. Stückes »Buddha's Geburt«. Dankenswert ist dagegen der von dem verdienstvollen Gelehrten eben da gebrachte Hinweis auf die Analogie der sieben buddhistischen Meister mit den sieben vedischen Weisen, schon aus asokischer Zeit beglaubigt, durch die Denksäule des Königs bei Niglīva, die er Koṇāgamano wie auch wahrscheinlich anderwärts den anderen errichtet hatte, und insbesondere noch durch die Reliefe und Inschriften auf dem Kuppelmal von Barāhat, aus dem dritten vorchristlichen Jahrhundert. S. die Anm. 3 gegen Ende, und Epigraphia Indica V 4-6, wo BÜHLER sehr schön gezeigt hat, wie der Name Koṇāgamano bei Asoko nach dem Pāli-Kanon getreu überliefert ist: also selbst da oben in Nepāl die verderbte nördliche Tradition, die man neuerdings wieder gern der südlichen echten gegenüber hervorkehrt, gänzlich unbekannt war. Es läßt sich an der Reihe unserer alten reichlichen Inschriften mit Sicherheit verfolgen, wie erst um die Zeit Kaṇiṣkas, etwa 200 Jahre nach Asoko, der Verfall des Ordens im Norden so weit gediehen war, daß man dort nur mehr die allerdings unzerstörbaren Ecksteine, Pfeiler und Reste verwenden konnte, um diese nunmehr einem neuen mehr und mehr phantastischen Bauwerk einzufügen, so gut oder schlecht es eben anging. Ja man kann sogar sehr genau bestimmen: von der Zeit an, wo auf den Inschriften der nach altem Sprachgefühl und -gebrauch unmögliche Begriff des bodhisattvas erscheint, an Stelle des philologisch so klaren und einzig denkbaren bodhisatta = bodhisaktas, wie er z.B. Mittlere Sammlung, Anm. 5, erwiesen ist, von dieser Zeit an – und das ist eben die Epoche Kaṇiṣkas – zeigt sich auch schon das Barocco des Mahāyānam fertig aufgeführt, nach dem neuen Plan seiner Baumeister errichtet, nach deren Schraubenkunst und deren Tantum ergo:
[653] Et antiquum documentum
Novo cedat ritui:
Praestet fides supplementum
Sensuum defectui.
Und so waren denn auch aus unseren alten zwölfeinhalbhundert Jüngern alsbald die Millionen bodhisattvās geworden.
288 Vergl. Zehnte Rede S. 145; Nāgito als Aufwärter in der 6. Rede S. 105.
289 Vergl. Mittlere Sammlung Anm. 179.
290 suddhodano ist sauberer Milchreis, die sauber gekochte Speise: der Name, als nom. propr., wäre demnach schwerlich durch »Reinreis« wiederzugeben, wie noch OLDENBERG, Buddha 5. Aufl., S. 117, Anm. 3, meint, vielmehr genau zu übersetzen als Der saubere Milchreis, nämlich -spender, yena saḥ, wie dies bei zahlreichen ähnlichen und anderen Beinamen als auszeichnendes Merkmal der Fall ist. Vergl. auch pañc audanas, einer der fünferlei Mus von Reis, Korn usw. hat (nicht etwa ist), yasya saḥ, in einem Spruche der Atharvasaṃhitā IX 5 8: pañcaudanaḥ pañcadhā vi kramatām. Bei dem bekannten Ehrennamen Anāthapiṇḍiko wäre desgleichen die rein mechanische Wortwiedergabe »Der herrenlose Bissen« ein Gegenstück zu »Reinreis«: auch hier hat eben der Mann die Bissen vorrätig, die er an Herrenlose, Bedürftige austeilt, ist also, richtig vorgestellt, ein Almosenspender. – Der Name Māyā, s.v.a. die Wundersam(schön)e, kommt in solcher Form sonst nie wieder vor, was recht merkwürdig ist: offenbar wollte man aus feinem Taktgefühl oder einem ähnlichen Beweggrunde kein anderes Weib damit bezeichnen; sehr verschieden von der christlichen Gepflogenheit und ihrer Marialatrie, bei welcher der Name alsbald zum allergewöhnlichsten wurde und es geblieben ist.
291 anussarissati wieder mit S, auch C etc.
292 udapādi. Atha kho zu lesen. Selige Gestalt, im Reiche der lichten Vorwelt, und erwachsam, bodhisatto, ist Mittlere Sammlung Anm. 430, auf die Grundbedeutung zurückgeführt. Zur richtigen Erklärung des letzteren Begriffs nach echt indischer Art, und nicht nach barbarischem Mißverständnisse, reicht uns übrigens die ältere wie auch noch die spätere Überlieferung eine Fülle unzweideutiger Beispiele und ganz analoger Bildungen dar. Sie sind nach den Vākyako ās, und schon aus BÖHTLINGKS Thesaurus, leicht beizubringen. Als überzeugende Beweise werden hier folgende genügen. Bṛhadāraṇyakam I 3 8, IV 4 6 (edit. Ind.): ya ittham asakta, tad eva saktaḥ; Bhagavadgītā III 25: tathāsaktaḥ; Manus II 13: arthakāmeṣvasaktaḥ; ferner aus dem Mahābhāratam, Rāmāyaṇam etc.: tapaḥsaktaḥ, saktamanaḥ, saktacittaḥ, ramaṇīsaktaḥ, sadāsaktaḥ; im Kathāsarit XIX 46: vivādasaktaḥ, im Raghuvaṃ aṃ I 21: sukham asaktaḥ. In diesen Sprachgebrauch, der ebenso bestimmt für unsere Pālitexte erwiesen ist (cf. oben Anm. 287 gegen Ende), war bodhisaktaḥ, bodhisatto von altersher vollkommen ungezwungen eingereiht, war eben daraus, dieser sprachlichen Entwicklung und Bedeutung nach, ursprünglich hervorgegangen, ohne Zweifel von Gotamo selbst angewandt worden: als der Erwachung angeschlossen, der Erwachung nachhängend, erwachsam.
293 Hierzu vedische und andere Nachweise in der Mittleren Sammlung, Anm. 431. Der indische Gedanke eines Weltbebens wird in der 555. Anmerkung erläutert: es ist ein geistiges Erschauern, das durch die ganze Natur geht und, wo auch immer rollende Sphären im Raume kreisen, überallhin ausstrahlt; wobei, ganz verschieden von gewöhnlichen Erdbeben, keinem der Wesen irgend Harm widerfährt, vielmehr sie alle sich wundersam ergriffen und entzückt fühlen, jedes in seiner Art. Die Stelle über [654] die beschränkte Macht von Mond und Sonne ist in die Purāṇen übergegangen, wie z.B. Bhāgavatam V 20 37: sūryādīnāṃ gabhastayo na kadācit parācīnā bhavitum utsahante. Vergl. übrigens noch die Metakosmien EPIKURS, die zahllosen Zwischenwelten im unendlichen Äther, deren jede von leuchtenden Göttern bewohnt ist: eine hypergeische, bez. teratoskopische Vorstellung, der indischen so einzig nahekommend, daß sie wohl damals schon dem EPIKUR oder seinen Vorgängern vermittelt worden sein mußte, und die aus dieser abgeleiteten Quelle durch BRUNO zuletzt auch bei uns wieder lebendig wurde – freilich erst nach der Feuertaufe, die der göttliche Nolaner in so bestimmter Art vorhergesehn, sein Vermächtnis eröffnend:
In den Hafen dahin dich flüchten, müde Seele, was säumst du?
Cf. den richtigen Text in WAGNERS Ausgabe, Leipzig 1830, vol. II p. 213, Ad portum properare etc., sowie das Vorbild hierzu in MICHELANGELOS berühmtem 56. Sonett, Giunto (è già 'l corso della vita mia) al comun porto etc.
294 anatikkamanīya 'va besser mit S. Dann: paricāreti, auch mit C. – Die berauschenden Getränke, die im vorangehenden Absatz erwähnt sind, zeigen in Indien seit dem uralten Somatrunk eine Gepflogenheit an, deren Bruch zwar immer ehrenvoller war als der Brauch, die aber selbst heute noch an Stärke der Erzeugnisse gebrannter Wässer alles im Westen gebraute weit übertrifft. Nähere Aufschlüsse, auch über die Abwehr von seiten der Smṛti usw., gibt BÜHLER in der Einleitung zu seiner Ausgabe des Vikramānkadevacaritam p. 41 n. 1, Bombay 1875.
295 upapajjati mit S zu lesen.
296 Wie hier das Sonnenkind zur Welt kommt, so geht auch, nach HOMER, die apollinische Geburt vor sich: cf. Mittlere Sammlung Anm. 436. Ebenda, Anm. 439, sind die Darstellungen dieser und der folgenden Szenen auf kostbaren Hochreliefen vom nordwestlichen Indien, aus dem 1. Jahrhundert vor Chr., einzeln angeführt.
297 Gleichsam geschichtlich überliefert ist ein ähnlicher Ausspruch der Pythia zu Delphi, als sie der edlen schönsten Frau von Samos verkündet: ihr künftiger Sproß werde an Schönheit und Weisheit alle je Dagewesenen weit übertreffen und dem menschlichen Geschlechte das ganze Leben hindurch zum höchsten Nutzen gereichen – daher denn der Sohn bei seiner Geburt PYTHAGORAS genannt wurde, nach JAMBLICHOS, De Pythagorica vita cap. 5.
298 Der Leib der Mutter, die den künftigen Heiland gebiert, wird Goldener Palast, kanakavimānam, genannt, im Avidūrenidānam p. 50: woher dann bekanntlich in der Lauretanischen Litanei die Muttergottes Domus aurea geheißen wird, Mater purissima, Vas spirituale etc. Und zwar ist dieses Dogma von der »anhamartesia S. Mariae« gleich zu Beginn der Christologie von den syrischen Kirchenvätern aus der buddhistischen Mythe nebst zahllosen anderen Zügen, freilich fast immer nur derb und plump äußerlich, übernommen worden, hier mit der sogar wörtlich aus dem Lalitavistarapurāṇam hergeholten Begründung: »Si fuisset in anima Mariae ulla macula aut defectus, aliam utique, eamque immaculatam matrem elegisset sibi Dominus.« Siehe den in der Mittleren Sammlung Anm. 438 von mir beigebrachten Quellennachweis, sowie auch die weiteren, noch wichtigeren Belege zur Fülle der Anleihen aus der ganzen 123. Rede daselbst. Fernere Angaben und Erklärungen solcher Art in den Liedern der Nonnen, Anm. 162. – Gewisse Querologen und Bäffchenhistoriker überspringen geflissentlich diese echten und ältesten Beziehungen zum entlehnenden Christentum, überschlagen sie, heute schon richtiger: unterschlagen sie, purzeln und schleichen darunter hinweg, und finden an den oft garstig und grausamlich an den Haaren herbeigezogenen [655] Vergleichen mit den späteren Märlein aus den »Vorgeburtsgeschichten« oder gar dem »Vorgeburtsgeschichtenkranz«, wie sie die Jātakamālā, d.i. »Geburtenlese«, nennen, bescheidenen Ersatz: auch eine Art Untersuchung, bei der es nicht eben selten scheinen möchte als ob diese lieben guten Leute mit ihren Sonntagnachmittagsvorträgen eine Lehrkanzel an einer Kleinkinderbewahranstalt der Loge zu den drei Weltkugeln anstrebten. Vergl. GARBES Aufsatz »Buddhistisches in der christlichen Legende«, Deutsche Rundschau Okt. 1911.
299 Die Teilnahme der ganzen Welt an dem großen Ereignis ist in einem alten Bardenlied, das in die Bruchstücke der Reden (v. 679-684) aufgenommen wurde, prachtvoll geschildert. Man sieht da die himmlischen Heerscharen der Dreiunddreißig Götter im Reigentanze glitzern, froh wie Sonnen dahinschweben und kreisen, strahlende Jubelchöre durchdringen im schwingenden Wonneschimmer die Räume, ein lustig Dröhnen, Singen, Klingen tönt herab, selig frohlockendes Preisen rauscht und erschallt immer weiter, tausendstimmig schwillt es an, fast überlaut um Lob zu singen, Gruß zu entbieten dem neugeborenen Kinde, das aller Wesen erstes, höchstes Oberhaupt einst werden wird. – Der Sänger dieses Bardenliedes, der vedische Seher Asito, ist auf einem herrlichen Relief aus dem 2. Jahrhundert vor Chr. dargestellt, bei GRÜNWEDEL-BURGESS, Buddhist Art in India, London 1901, Nr. 7; cf. hierzu noch Bruchstücke der Reden Anm. 691 das Nähere. Die Gedankenwelt aber des Liedes ist auf dem syrisch-alexandrinischen Weg im Lauf der Jahrhunderte immer weiter nach Westen gedrungen und hat späterhin ihren lebendigen künstlerischen Ausdruck in HÄNDELS Messias gefunden, in diesem tausendstimmigen Loblied mit dem eröffnenden Chor: »Uns ist zum Heil ein Kind geboren«, in immer steigender und gesteigerter Variation, »Uns zum Heil ein Kind geboren« usw. usw. usw.; wie das ZELTER an GOETHE unterm 20. März 1824 trefflich ausführt: »dann folgen andere (Chöre) auf die nämliche Art; dann die Dritten, dann die Vierten und endlich bei den Worten: Wunderbar, Herrlichkeit usw. stimmt alles ein: die Herden der Flur; das Heer der Gestirne des ganzen Himmels, alles erwacht und bewegt sich mutig und froh.« HÄNDEL hat uns also diese höchste Weihnacht aus Indien in seiner mächtigen Art wiedererschaffen, in unermeßlich heiterem Glanze, überstrahlend sogar der Götter göttliche Pracht. »Denn der Geist vermag aus fragmentarischen Elementen«, wie GOETHE an ZELTER zurückschreibt, »gar wohl einen Rogus aufzuschichten, den er denn zuletzt durch seine Flamme pyramidalisch gen Himmel zuzuspitzen weiß.« Asito war der erste Kommentator unseres obigen Textes; und ZELTER und GOETHE mochten sich ihm, durch HÄNDEL innig eingeweiht, ektypisch anschließen, zur Erklärung einer solchen zwar selten, aber immer doch wiederkehrenden Botschaft des Heils. Vergl. Lieder der Mönche, Anm. 490. Am schönsten veranschaulicht ist das strahlende Wunder, von dem alle, auch die Himmelsboten, wie geblendet umfangen werden, in CORREGGios Heiliger Nacht, wo der Erwachsame soeben aus dem Leibe der Mutter hervorgekehrt ist.
300 S als Variante parasenāpamaddanā. Dann: vivaṭacchado. – Das beste Land, cakkaratanam, bez. die Gewinnung der Oberherrschaft über dasselbe, ist in der 17. Rede dargestellt.
301 Vergl. Mittlere Sammlung Anm. 478, wo dieses Merkmal ebenso beim Söhnchen der akuntalā, dem künftigen König, aufgewiesen wird. Die Radlinien auf der Fußsohle sind als rīpādas in der Skulptur wohlbekannt: ib. Anm. 242.
302 Das ist die richtige Wiedergabe von kosohitavatthaguyho: ko ao = imbao Hülse, Hülle, Vorhaut. BURNOUF war in seiner ungemein sorgfältigen und umfassenden [656] Besprechung und Untersuchung unserer 32 Merkmale, nach dem Saddharmapuṇḍarīkam II v. 58, im Lotus de la bonne loi, Paris 1852, p. 553-616, der wahren Bedeutung dieses später scholastisch mißverstandenen Ausdrucks, mit seinem genau prüfenden Scharfsinn schon damals die kommentariellen Flausen durchschauend, sehr nahe gekommen, indem er übersetzt: »l'organe de la génération est rentré dans son étui.« Das Merkmal selbst ist, wie noch manche, ja eigentlich die meisten anderen oben, gewiß alles eher als befremdlich, gehört schlechthin dem natürlich schönen Menschen zu, und ist daher von den Griechen regelmäßig so dargestellt. Es galt und gilt auch in Indien beim Volke, fromm ausgelegt, als lucus a non lucendo, für ein Anzeichen durchaus gesunder, geistiger oder leiblicher, Schaffenskraft, da insbesondere der welterobernde Cakkavattī, der über tausend Helden zeugt, es aufweist. Merkwürdig stimmt hierzu der Bericht des Militärarztes HENRY nach NAPOLEONS Sektion, mit einem Befund eben wie bei apollinischen Statuen. Derselbe hatte bei der Autopsie auch festgestellt, daß die Haut am ganzen Leibe außerordentlich fein war, der Körper kaum behaart, die Haare seidig; was sich gleichfalls unserem obigen weiteren physiognomischen Kennzeichen anschließt. – Die langen Arme, als Merkmal eines Helden, sind Mittlere Sammlung Anm. 244 ausführlich behandelt.
303 Cf. Mittlere Sammlung Anm. 246. Ebenda auch die anderen Nachweise. Wie allgemein beliebt späterhin die Kennzeichnung eines hervorragend schönen und begabten Kindes durch gerade zweiunddreißig Merkmale geworden ist, erhellt z.B. aus Hitopade as III 7, in PETERSONS Bombayer Ausgabe von 1887 p. 114, wo dvātriṃ allakṣaṇopetas wörtlich wiederkehrt. – Das Mahāvastu gibt die zweiunddreißig Merkmale kurz an und bringt einen guten typischen Auszug der legendarischen Hauptstücke, wobei jedoch die Erzählung nicht von Vipassī sondern von einem Meister der Vorzeit, aus einer weit, weit früheren Äon, von Dīpaṃkaras ausgeht, der – der Annahme nach – in der 24. Unermeßlichen Zeitfolge vor der gegenwärtigen gelebt hat. Über ihn, wie nachher gleichlautend über Gotamo, ergehn sich die entsprechenden Schilderungen im Mahāvastu I 193-243 und II 1-48; von WINDISCH hervorgehoben, Buddha's Geburt S. 103-106. Die sagenhafte Behandlung Dīpaṃkaras ist überhaupt den nördlichen Texten eigentümlich und wurde von ihnen mit Vorliebe und sehr schön gepflegt. Die reichste Quelle bietet hier der Kāh-gyur, aus dem uns LÉON FEER das ganze in einer lebensvollen Übersetzung mitgeteilt hat, Annales du Musée Guimet, tome cinquième, Paris 1883, p. 302-361, das Dīpaṃkaravyākaraṇam. Eines der Reliefe vom kleinen Kuppelmal bei Sikri stellt die Szene dar, wie einst, vor unausdenklichen Zeitläufen, ein Jüngling mit einem Lotus in der Hand Dīpaṃkaras dem siegreichen Meister gehuldigt hat, voll Zuversicht dereinst selbst ein vollkommen Erwachter zu werden. Und eben jener Jüngling soll es gewesen sein, der dann, in unserer Zeitepoche, als Gotamo zur Meisterschaft gelangt ist. Vergl. FOUCHER, Journal asiatique, Sept.-Oct. 1903, Tafel II, zu p. 199-209, wo derselbe Gegenstand auf noch fünfzehn anderen Skulpturen nachgewiesen ist.
304 Zu citantaraṃso cf. das hierher gehörige vedische Gegenbild der vimṛṣṭāntarāṃsā.
305 āhatehi ist richtig erhalten; von den ahatehi vatthehi, z.B. der 16. Rede, wohl zu unterscheiden. Zur allgemein indischen Sitte eines goldenen Gabenschauers über die Priester von seiten des Königs bei der Geburt des Thronfolgers cf. z.B. noch Vikramānkadevacaritam, ed. BÜHLER 2, 61: Sa hemavṛṣṭiṃ mahatīm akārayaccakāra citrāṇyupayācitāni ca, stereotyp überliefert, wie oben. – Nb Manus 7, 85.
306 Vergl. Lieder der Mönche Anm. 299.
[657] 307 angen' eva angam hat Mandalay wieder richtig erhalten.
308 nippurisehi turiyehi paricāriyamāno, wörtlich: von menschenlosen Toninstrumenten, d.i. menschenloser Musik bedient, nur Kennzeichnung der letzteren, also ein verborgenes Orchester; die Bajaderen usw. waren schon vorher, indischem Begriffe gemäß, in die fünf Wunschgenüsse, pañca kāmaguṇāni, eingereiht. – Das Leben im Palast war in Skulptur und Malerei natürlich stets ganz besonders reich und mannigfach veranschaulicht, besonders auf den dramatisch bewegten Reliefen von Amarāvatī und den Fresken zu Ajaṇṭā, aus späterer Zeit. Einzelne gute Wiedergaben bei FERGUSSON und bei GRIFFITHS. Die Künstler haben es da weiterhin verstanden jenen Typus der Dauer im Wechsel zu gestalten, der Mauern und Paläste »mit andern Augen« ansieht, als es nämlich die Ārtasaṃhāraṇīyās oder Jahreszeitengenießer von Kāmos Gnaden zu tun pflegen.
309 Besser yojetvā mit S.
310 Kim pan' eso samma sārathi jiṇṇo nāmā ti mit S.
311 Mit S ito ca antepuram passim.
312 Der Grundton hierzu war bereits in der Atharvasaṃhitā deutlich erklungen, XVIII 4 50:
yauvane jīvān upapṛñcatī jarā:
In Jugend wer da lebt, ihn schleicht das Alter an.
Etwa tausend Jahre später heißt es dann unserem Texte gemäß im Mahāniddeso, dem alten Kommentar zum Suttanipāto, trefflich, ed. Siam. p. 387: sabbaṃ yobbaññaṃ jarāya ositam: alle Jugend ist vom Alter eingesäumt. Aus solchen jüngeren Quellen und ihrem verbreiterten Sagenspiegel, der zumal in SPENCE HARDYS Eastern Monachism (London 1850) noch lebendige Bilder zeigt, hatte SCHOPENHAUER unsere obige Szene mit bewundernswürdigem Scharfblick bis ins einzelne klar erschaut und dargestellt, im Gespräch mit KARL BÄHR, am 12. April 1856. »O sie ist schön«, sagte er da, »die Mythe, wie Buddha zum Heil geführt wurde! Ein Prinz aus königlichem Hause, ward er erzogen in einem glänzenden Harem, in Pracht und Reichtum, und als er zwanzig Jahre alt geworden, verließ er zum erstenmal das Schloß und trat mit seinem Gefolge hinaus in die herrliche indische Natur, die vor ihm ausgebreitet lag in ihrem Glanze. Da steht er staunend vor ihr und freut sich über die Schönheit des Daseins. Aber sieh! es kommt einer auf ihn zugegangen (hier machte Schopenhauer, heftig erregt, die Gebärde eines alten Mannes, der mit dem Kopfe wackelt), es kommt einer gegangen, der scheint zu sagen: Sieh mich an! Dies alles ist nichts, nichts!« – Bestürzt fragt der Prinz einen Begleiter, was diese Gestalt bedeute. »Es ist das Alter, Prinz; so wie dieser hier werden wir einst alle.« Der Zug geht weiter, und man sieht am Wege einen siechen Menschen, der sich mit seinem Leiden hinschleppt: und SCHOPENHAUER führt nun auch das Folgende mit lebhaftester Anschaulichkeit aus, unserem Text oben schon damals nahebei gekommen.
313 S stets vyādhiko.
314 Vergl. Kaṭhopaniṣat I 6: Anupa ya yathā pūrve, pratipa ya tathā pare etc. Der Wagenlenker gibt diesen Bericht naiv und als selbstverständliche Wahrheit; ganz wie etwa bei uns, ebenso bündig und trocken, ohne irgendein Pathos, STERNE gesagt hat: Labour, sorrow, grief, sickness, want, and woe, are the sauces of life: Tristram Shandy CXXI. So liegt es denn auch König Bandhumā als einem edlen Manne vollkommen fern das ehrliche Bekenntnis des Dieners zu tadeln oder es beschönigen zu lassen. Er denkt, der Prinz werde sich schon in das unvermeidliche Los, wie er meint, noch [658] fügen. Vipassī aber sinnt nun beim Kranken, wie vorher beim Alten, immer mehr und mehr darüber nach, in der Art wie es im Anguttaranikāyo vol. I p. 146 (besser ed. Siam. p. 186) von Gotamo ausgeführt ist: »›Ein unerfahrener, gewöhnlicher Mensch, selber der Krankheit unterworfen, der Krankheit nicht entrückt, wird beim Anblick eines anderen, der krank ist, betroffen, ergriffen, abgestoßen, weil er eben sich außer acht läßt: »Auch ich bin der Krankheit unterworfen, bin der Krankheit nicht entrückt.« Wenn ich nun ebenso, selber der Krankheit unterworfen, der Krankheit nicht entrückt, beim Anblick eines anderen, der krank ist, betroffen, ergriffen, abgestoßen würde, so stände mir das übel an.‹ Während ich da, ihr Mönche, auf solche Weise nachdachte, ist mir bei Gesundheit die Lust an Gesundheit ganz und gar vergangen.« An dieser Stelle zeigt sich fast übermenschlich klar und nüchtern die ungewöhnliche, tiefe Kraft des Mitgefühls, die ein Mittel auszukunden beginnt, tauglich um dem Reich der Natur auf immer zu entrinnen. (Zu atisitvā, von si sinoti + ati, s.v.a. atidhāvitvā, abhimuñcitvā, cf. Anm. 246; OLDENBERG, Buddha 5. Aufl. S. 123, hat die Stelle verkannt.)
315 Diese drei Begegnungen, sowie auch die folgende vierte, waren auf den Reliefen der Kuppelmale dargestellt: HIUEN-TSIANG hatte sie, um 630, noch betrachtet. In Indien selbst längst in Trümmer geschlagen, oder vielleicht in Schutt versunken, seit dem muhammedanischen Einbruch, sind sie, durch gandhārisch-turfānische Künstler einst treu überliefert, heute noch in China zu sehn, im nördlichen Schan-si, in der zweiten der aus dem fünften Jahrhundert nach Chr. stammenden berühmten Felsengrotten von Yün-Kang bei Ta-t'ong-fu, prachtvoll und ergreifend veranschaulicht. Vergl. PETRUCCI, Documents de la mission CHAVANNES, Revue de l'université de Bruxelles, Liège 1910, p. 500. Auch in Java, am Boro-Budur, sind die vier Ausfahrten sehr edel im Relief noch erhalten: S. PLEYTE, Die Buddhalegende in den Skulpturen des Tempels von Bôrô-Budur, Amsterdam 1901, Figur 56-59. – Unser Gespräch oben vor dem Toten ist ebenso groß und schlicht im Hamlet wiedergegeben, wo der Prinz am Grabe fragt: »Prithee, Horatio, tell me one thing.« – »What's that, mylord?« – »Dost thou think Alexander looked o' this fashion i' the earth?« – »E'en so.« – »And smelt so? pah!« – »E'en so, mylord.« – »To what base uses we may return, Horatio!« etc., V I 215-224. Kurz in einen Merkspruch zusammengefaßt am Ende von King John:
What surety of the world, what hope, what stay,
When this was now a king, and now is clay!
Vom Prinzen an der Leiche des Königs gesagt und – wie oben – auf sich selber bezogen: Even so must I run on, and even so stop, V 7 70. Der ganze Gedankengang ist vom heiligen BERNHARD mit glühenden Lettern in die eherne knappe Formel geprägt: Triplici morbo laborat genus humanum: principio, medio et fine; id est: nativitate, vita et morte. Opera ed. Par. 1621 fol. 491.
316 Mit S hier zweimal yathā pi. – Dann: subhūmiṃ dassanāya. – Auf die Stellen aus der Smṛti zum vorangehenden Topus »Wir alle sind dem Tode unterworfen« ist bei v. 578 der Bruchstücke der Reden hingewiesen, im Vergleich zum horazischen »Omnes eodem cogimur«: der offenbaren Wiedergabe des pythagoreischen Verses Αλλα γνωϑι μεν ὡς ϑανεειν πεπρωται άπασι, Aureum Carmen 15. Ebenso nahe, sowohl der Form als dem rein indischen Inhalt nach, kommt eine Redondilla des CRISTÓBAL DE CASTILLEJO, Mitte des ersten Buches:
[659] En esta guerra mortal
Soldados son los dolores,
Y el amor, con sus amores,
Es capitan general;
Puestos en un memorial
Tiene los que ha de herir.
Todos hemos de morir.
Die großartige bildnerische Gestaltung der Szene vor dem Toten am Camposanto zu Pisa, aus dem Quattrocento, die uns von Indien über die ägyptische Thebaïs vermittelt wurde, ist in den Bruchstücken der Reden erörtert, in der Anm. 590, auch im Hinblick auf die berühmte Legende von Barlaam und Joasaph. Zu letzterer cf. KUHNS Monographie 1893. Den einfachsten, innigsten und zugleich unserem obigen Text ähnlichsten Ausdruck hat wohl unser MATTHIAS CLAUDIUS gefunden, bei BERNSTORFFS Begräbnis:
Auch ihn haben sie bei den andern begraben,
Und er kommt nun nicht wieder zu uns.
317 Der Vorgang, wie der Prinz mit dem Schwerte sich das schöne lockige Haar abschneidet, während der Wagenlenker, das Roß mit dem Zügel wendend, tief ergriffen beiseite steht, und Götter huldigend herabschweben und zu Füßen knien, ist auf einem, verhältnismäßig noch gut erhaltenen, lebensgroßen Relief am Boro-Budur mit erstaunlicher Meisterschaft behandelt; so schlicht, würdig erhaben, besonnen in Anordnung und Ausdruck durchgeführt, daß die Erinnerung an die besten griechischen Bildner, trotz der rein indisch stilisierten Gestaltung, sogleich auch bei diesem Typus wach wird, den gründlich betrachtenden Kenner aber geradezu entzückt, wie es bei JOSEF STRZYGOWSKI der Fall war, nach Vorführung der Originalaufnahme GOLUBEWS am kunsthistorischen Institut der Wiener Universität im Juni 1912. Die schematische Zeichnung in PLEYTES Bôrô-Budur, Figur 67, ist derart willkürlich ergänzt und bis zur Unkenntlichkeit verschroben, daß sie wie alle seine übrigen zu feinerer Untersuchung unbrauchbar ist. Da es aber ein anderes Werk bisher nicht gibt, wäre eine streng mechanisch stereoskopierte Aufnahme und Veröffentlichung der kunstgeschichtlich so überaus wertvollen sechzehnhundert Reliefdarstellungen vom Boro-Budur der Förderung von seiten der Akademien oder irgendeines Milliardärs vielleicht besser zu empfehlen als die Wiederholung der oft schon gewährten reichlichen, doch immer ergebnisgleichen Stipendien zum Ausgraben altturkestanischer Trümmer und Schätze oder zur recht überflüssigen weiteren Anhäufung neuhinterindischer Fratzensammlungen: und womöglich bevor die Denkmale, die aus Blöcken einer nicht sehr widerstandsfähigen Trachytlava gemeißelt sind, noch weiter verwittern und zerfallen, ohne Schutz in Sonne und Regen.
318 Zu caturāsītipāṇasahassāni gehört der Obelos. Vorher mit S Vipassī hi nāma. – Die sogleich bewährte mächtige Wirkung, die von Vipassī ausging, wie er selbst sie vorher durch den Pilger erfahren, ist bei empfänglichen Geistern nicht allzu verwunderlich. Man braucht hier nur an die Bemerkung zu erinnern, die GOETHE am Abend des 1. März 1787 in Neapel niedergeschrieben: »Wer hat es nicht erfahren, daß die flüchtige Lesung eines Buchs, das ihn unwiderstehlich fortriß, auf sein ganzes Leben den größten Einfluß hatte und schon die Wirkung entschied, zu der Wiederlesen und [660] ernstliches Betrachten kaum in der Folge mehr hinzutun konnte. So ging es mir einst mit Sakontala; und geht es uns mit bedeutenden Menschen nicht gleicher Weise?«
319 na kho pana me tam aus S zu ergänzen. – Vipas sī kann nur so sein Ziel erreichen; in gloriosa quadam Solitudine degens, wie der ägyptische ANTONIOS in der Historia vitae et mortis von BACON treffend gekennzeichnet wird. Bruch und Trennung jedweder Gewohnheit und Rücksicht war ihm nun innere Notwendigkeit, zur höchsten Pflicht geworden. Hier um Haaresbreite schwanken – und es stände auch schon der Anton der Jobsiade da, wo füglich dann gilt, III 33 52:
Er hinterließ einen Sohn, der hieß Steffen,
Dieser blieb zu Mühldorf beim bekannten Treffen
Unter Seyfried Schweppermann als Offizier,
Weil er's Fieber hatte, ruhig im Quartier.
320 te pabbajitagaṇā zu lesen.
321 upapajjati ca mit S. – Eine sehr nahe anklingende Äußerung ist uns von PRODIKOS überliefert: sie zeigt wie tief man schon vor PLATON die Wurzel der Weltkunde erfaßt hatte, und beginnt mit der Frage: Τι μερος της ἡλικιας αμοιρον των ανιαρων; »Gibt es einen Zustand, der nicht leidvoll wäre?« Was dann mit kräftiger Begründung sowie Denksprüchen nach der apollinischen Sage (Agamedes und Trophonios), aus der Ilias (24, 525/6 und 17, 446/7), Odyssee (15, 245/6) und einer Antwort aus dem Kresphontes des EURIPIDES verneint wird. Cf. MULLACH, Fragmenta philos. Graec., Paris 1867 (vol. II) p. 138/9. So hat denn auch der vortreffliche, vielerfahrene Komöde als Beobachter des Lebens, MENANDER, mit all seiner Heiterkeit es gar wohl verstanden:
Ανϑρωπος xκανη προφασις εις το δυστυχειν.
Mensch sein ist schon genug zur Gewähr der Unseligkeit.
322 bhavo Dasein, Werden, von bhū, bhavati sein, werden, ist das Punctum saliens der Zeit, als immer werdender und alsbald gewesener Augenblick, nie ein seiender Zustand; also PLATONS γιγνομενον και απολλυμενον, oder mit der Norne der Gegenwart Werdandi genannt. Diese Gegenwart als fortwährendes Werden ist es, von der SCHOPENHAUER sagt, daß sie ihre Quelle in uns hat, und daß zunächst und unmittelbar sie allein die Form des Lebens, oder der Erscheinung des Willens mit Bewußtsein, ist. Auf dem drehenden Kreise mit der stets sinkenden Vergangenheit und stets steigenden Zukunft ist sie der unteilbare Punkt, der die Tangente berührt, WWV I § 54 passim. Nicht anders betrachtet oben Vipassī der Erwachsame das Entstehn aus dem Werden der Gegenwart, an der Scheidelinie oder Schattengrenze stehend, wo er die Geburt beleuchtet und das Werden im Schatten sieht, wie beide Zustände am selben Dinge bestehn, d.i. erscheinen und verschwinden; und ebenso in der übrigen Reihe.
323 Das sechsfache Reich oder Gebiet umfaßt die fünf Sinne mit dem Denken als sechstem Sinn. Vergl. Bruchstücke der Reden v. 171 (nebst Anm.):
Fünf Wunschgebiete kennt die Welt,
Gedenken noch als sechstes dann:
Den Willen wer da von sich weist,
Der Leiden ledig wird er so.
Der fünf ersten mag wohl auch ein unerfahrener, gewöhnlicher Mensch überdrüssig werden: was aber da bezeichnet wird als »Denken« oder als »Geist« oder als »Bewußtsein«, [661] davon kann der unerfahrene, gewöhnliche Mensch nicht genug haben, nicht ablassen, nicht loskommen; und warum nicht? Lange hindurch hat ja der unerfahrene, gewöhnliche Mensch sich darangeschlossen, es gehegt und gepflegt: ›Das gehört mir, das bin ich, das ist mein Selbst.‹ Darum kann der unerfahrene, gewöhnliche Mensch davon nicht genug haben, nicht ablassen, nicht loskommen: Saṃyuttakanikāyo vol. II p. 94. Es ist hiermit das feinste und zäheste Willensband, der Geist des Menschen, als Fessel erkannt und verworfen. – Das sechsfache Reich, oder wie man für salāyatanam auch sagen kann: der Sechssinnensitz, ist das, was SCHOPENHAUER als den Verstand aufzeigt, der nach Sinnesempfindungen das Gesetz der Kausalität sogleich wirkend anwendet und so allererst die Anschauung der Außenwelt schafft, das Gehirnphänomen der gegenständlichen Welt zustande bringt: meisterhaft klar und unserem obigen Texte gemäß entwickelt in § 21 des Satzes vom zureichenden Grunde, schon anno 1813.
324 Mit C susambudho richtig; cf. Majjhimanikāyo ed. Siam. vol. II p. 452 und auch TRENCKNERS Majjhimanikāyo p. 168.
325 appossukkatāya mit S etc.
326 Zur Stelle Atha kho so bhikkhave mahābrahmā cf. Mittlere Sammlung Anm. 215. – Die gleichnisweise Schnelligkeit entspricht unserem Ausdruck »im Handumdrehn«.
327 Mit S apissudam brahme und pubbe me assutapubbā.
328 Cf. Mittlere Sammlung Anm. 216. – Zum folgenden Gleichnisse gehört auch jene andere bildliche Darstellung im Parisāvaggo des Anguttaranikāyo II 5 5 (vol. I p. 72), wo die Jünger als herb und als mild bezeichnet werden: die herben sind mit Gier versetzt, mit Haß versetzt, mit Irre und Angst versetzt, es ist die schwere untere Schicht, der sauere Bodensatz, die gesammelte Hefe, parisakasaṭo; die milden sind frei von Gier, frei von Haß, frei von Irre und Angst geworden, es ist die feine obere Schicht, der süße Rahm, die gesammelte Blume, parisamaṇḍo. Hefe und Sahne der Gesellschaft scheidet sich hier aus der mittleren Molke nach unten und nach oben hin. Ein weiteres Gleichnis der Art, ebenso anschaulich, naturgemäß, noch im Anguttaranikāyo X No. 104, wiedergegeben bei v. 790 der Bruchstücke der Reden. Die Menschen als nach dreierlei Art entwickelt zu betrachten spiegelt auch sozusagen das allgemein indische immer wandelnde wechselnde Universum der Dreiwelt wider, das Trailokyam, d.i. das dreifache Reich von Himmel, Erde und Unterpferch: die Bewohner des letzteren haben ihr Heim in der Tiefe, bestehn im Sumpf und sumpfigen Abgrund, narako, narakapapāto (Lohiccasuttam Ende, 483. Jātakam Anfang), in der Hölle; die Bewohner des Mittelreichs dringen bis an die Oberfläche, ihr Gebiet ist die Erde; die Bewohner der oberen Gefilde sind emporgestiegen aus den Dünsten der Niederung, über die Wolken hinauf. Diese kosmologische Dreiwelt wird dann zugleich wieder ethisch unterschieden nach den drei je eigentümlichen Hauptkreisen Kāmāvacaro, Rūpāvacaro, Arūpāvacaro, Geschlechtliche Sphäre, Formhafte Sphäre, Formlose Sphäre. So auch Mittlere Sammlung S. 54. Unser obiges Gleichnis war bei der schlichten Anschauung geblieben. Hieraus ist offenbar späterhin die Lehre von den drei Grundeigenschaften der Wesen hervorgegangen, den drei guṇās, die je als tamas, rajas oder sattvam den Grad einer bestimmten Entwicklung anzeigen: das dumpfe tamas läßt die Wesen im Dunkel gedeihen, das rohe rajas im Reich der Reize, das stete sattvam in der Welt der Wahrheit. Manus, bei dem diese Lehre zuerst vorgetragen wird, erklärt denn auch unserer Überlieferung entsprechend als Kennzeichen der dunklen Sphäre den Geschlechtstrieb, der reizvollen Sphäre die Sucht nach Reichtum, der wahrhaften Sphäre das Streben nach Tugend, XII 38: wobei diese drei Grundeigenschaften [662] oder Grundkräfte, wie beim Lotus oben, sehr wohl auch an ein und derselben Person sich entwickeln können, je nach der erstrebten Richtung. In der Bhagavadgītā wird diese Ansicht dann mit aller Ausführlichkeit behandelt, zumal im 14. Abschnitt, und ist allmählich Purāṇengut und somit volkstümlich geworden, zugleich auch, seit der Sāṃkhyakārikā, als fester Bestand in die Erzeugnisse gelehrter Muße übergegangen. Dieselbe dreifache Einteilung der Menschen nach ihren guṇās hat PLATON erkannt, wie Bruchstücke der Reden Anm. 3151 gezeigt ist; sicher nach dem indischen Vorbild sind die gnostischen drei Arten der Menschen wiedergegeben als ὑλικοι, ψυχικοι, πνευματικοι, worauf schon AL BRECHT WEBER hingewiesen hat, Indische Skizzen, Berlin 1857, S. 91.
329 Mit S richtig apārutā te amatassa dvārā; cf. Anm. 549. Der Mythos von Brahmās bittender Aufforderung ist in der Mittleren Sammlung besprochen, Anm. 215, letzter Absatz, wo auch der Nachschein im Mahāvastu angegeben wird. Er ist recht durchsichtig, dieser Schleier der himmlischen Dichtung, woraus sich der Weltgeist so deutlich vernehmen läßt und mit Gedanken und Worten wie SENECA in seinem berühmten 79. Briefe, gegen Ende: Multa annorum millia, multa populorum supervenient: ad illa respice!
330 Khemo, ›Sorgenfrei‹, s.v.a. Sanssouci, Buitenzorg, Posilipo. Den gleichen Namen hat in der purānischen Geographie einer der sieben Weltteile. Dieselben Namen für verschiedene Örtlichkeiten kommen, wie bei uns, auch für Städte gelegentlich vor; cf. das Register s.v. Pāvā. Besonders lehrreich und interessant ist aber Kābul-Kambojā, Mittlere Sammlung Anm. 267.
331 S nikkhame als varia lectio zu nekkhamme.
332 Dieser berühmte Spruch faßt die Summe der Lehre zusammen. Er ist dann in die nördliche Überlieferung wörtlich übergegangen, so Divyāvadānam p. 294, und allmählich der bekannteste Gemeinplatz der Smṛti überhaupt geworden: vergl. die Nachweise in der Mittleren Sammlung Anm. 258. Bei uns hat SALLUST gesagt: Ut initium sic finis est, omniaque orta occidunt, De bello Jugurthino cap. 2; schön auch MANILIUS Astronom. IV 16 (s. unten Anm. 618); ähnlich PUBLILIUS, Sententia 379; Nil proprium ducas, quidquid mutari potest (vergl. Mittlere Sammlung Anm. 361 das pythagoreische Vorbild); und späterhin BOETIUS, Consol. philos. II 3 am Ende:
Constat, aeterna positumque lege est,
Ut constet genitum nihil.
333 Die purimāni caturāsīti-Glosse ist nach S. 202 Anm. 318 mit dem Obelos zu versehn: als atacchavādo puttamatāya Sumangalavilāsinīputtaṭṭhakathānayena veditabbo.
334 Mss iterant.
335 Die reine Zucht, s.v.a. die Grundregel des Ordens, pātimokkham, d.i. prātimaukhyam, Regula princeps, sogar von Buddhaghoso richtig erkannt und erklärt als atimokkham, atiseṭṭham; immer genau mündlich überliefert, wie oben angegeben, bis zur späteren Abfassung in den disziplinaren Leitfaden des Pātimokkham. Vergl. übrigens Bruchstücke der Reden v. 340 nebst Anmerkung und weiteren Nach weisen.
336 Dieser Denkspruch, einer der meist berühmten und verbreiteten aus dem Dhammapadam (v. 183), auch bei den buddhistischen Fremdvölkern von Zeilon und Kaschmir bis nach Japan und Java mit am allerbekanntesten, ist mit mächtig großen Lautzeichen aus der Zeit der sog. nordwestl. Guptās (1. Jahrh. v. Chr.) in eine natürliche Steinplatte am »Wasserfelsen«, Obaghat, oberhalb einer köstlich klaren Bergquelle, die dort entspringt, weithin sichtbar eingegraben, wortgetreu [663] nach dem Pāli in gutes Saṃskṛt übersetzt, von einem ausgezeichneten Kenner, der nach BÜHLERS Urteil auch einem A vaghoṣas nicht nachstand. Der Felsen steht, einen Säulentempel überschattend, in anmutiger Gebirgsgegend, im Flußgebiet des Swāt, eine Tagesfahrt nördlich von Peschāwar, an den Grenzen des Reichs. Ein mustergültiger Abklatsch der Inschrift wurde 1895 von Colonel DEANE genommen und im vierten Bande der Epigraphia Indica, S. 133-135, von BÜHLER besprochen, ausgesteckt und erklärt, nebst zwei anderen dazugehörigen, nicht minder bedeutenden Felseninschriften aus der gleichen Gegend und Zeit. Hierzu Anm. 563. – Mit S kusalassūpasampadā.
337 Vergl. Mittlere Sammlung S. 92. Nach Anguttaranikāyo I No. 18 i.f. ist ein auch bis zum kleinsten Rest gebrachtes Dasein als solches eben noch immer von Übel, gleichwie auch nur ein Restchen Kot oder Eiter immer noch übelriecht. Bei den Reinen Göttern ist jener Daseinsrest so weit als möglich verflüchtigt: wobei auch sie jedoch dem Asketen natürlich nur so erscheinen wie der unermeßlich gestirnte Himmel mit seinen goldenen Feuern dem Prinzen von Dänemark, nämlich als »no other thing than a foul and pestilent congregation of vapours«, II 2 313; kein Ding zum »velle reverti«, außer für Unsinnige, wie Vater Anchises meint, Aen. VI 750/1.
338 Die Akaniṭṭhā devā, Altvordersten Götter, in der höchsten Sphäre, streifen schon die Tangente der Ewigkeit. Sie erinnern an den faustischen Vers, II 3, letzter Chorgesang I, 7 (9998):
Und, wie vor den ersten Göttern, bückt sich alles um uns her.
Ein indischer Abglanz, der ohne Zweifel durch den platonischen Götterhimmel dem Olympier zugestrahlt war. Jene hohen, zur letzten Warte gelangten Phänomenoiden können in ihrem wirklichen Verhältnis zur Welt am besten durch ein mathematisches Gleichnis bestimmt werden, nach log 0 = – ~. In der Smṛti heißen sie Ādidevās, Urständige Götter, wie die Kreise Brahmās, Dhanvantaris usw., äonenfern von den zwei übrigen Arten, die da bezeichnet werden als Karmadevās, Götter der Tat, wie die Gestalten Indras, Agnis usw., und als Prayojanadevās, Götter der Nutzanwendung, das sind Helden und Heilige. Vergl. noch zwei ältere, bedeutsame Einteilungen, Anm. 1063 der Bruchstücke der Reden.
339 Diese doppelte Erfahrung, durch eigene Kenntnis und göttliche Anzeige, gleichsam als himmlischer Widerhall, ist ein stehender Satz, ein Axiom unserer Texte: z.B. in der 31. Rede der Mittleren Sammlung, S. 237f., ganz ebenso von einem Jünger, dem ehrwürdigen Anuruddho, ausgesagt. Ein prästabiliertes Echo der Art, vom geistigen Umkreis wie von einer Kuppel nach innen zurückgesandt, kommt in Ermanglung so feinen Gehöres sonst nirgend vor; es sei denn, daß man den deutenden Dämon im Innern des SOKRATES, mit dem er gar wohl vertraut war – ή ειωϑυια μοι μαντικη ή του δαιμονιου – etwa mit dazurechnen darf. Mehr nach außen gewandt, wird man der sinnigen Vorstellung KERNERS, Ende des ersten Teils der Seherin von Prevorst, auch hier eine Stätte nicht versagen mögen, insofern ja damit ein allgemein zutreffendes Gesetz, nur lichter gesehn, sich erschließt. »Der Tumult auf dem Markte des Lebens«, sagt er, »ist zu groß, als daß er nicht Schwerhörenden den zarten, liebenden Ruf der Natur, unser Aller Mutter, übertäubte. Aber nicht bleibt die Zeit aus, wo wir einst alle wieder dieser liebenden Mutter Rufen in vollen Akkorden vernehmen, die Zeit wo unser Herz ausgepocht und das klappernde Rad der Außenwelt stille steht. Dann vernehmen wir auch liebende Brüder wieder, die wir sonst nicht vernahmen, alle Verwirrung ist gelöst, und wir stehen erstaunt, wie es gekommen, [664] daß ein ganzes Menschenleben hindurch ein Himmel geistiger Akkorde, uns immer freundlich rufend und mahnend, um uns erklingen konnte, ohne daß wir ihn vernahmen.« Es ist dieselbe Ansicht, die GOETHE, so kurz als beredt, ECKERMANN gegenüber ausgesprochen hat, am 7. Oktober 1827: »Wir sind von einer Atmosphäre umgeben, von der wir noch gar nicht wissen, was sich alles in ihr regt und wie es mit unserem Geiste in Verbindung steht.« Als Merkspruch ist der Gedanke wohl am besten in das alte Druidenwort gefaßt, das LUCANUS bewahrt hat, Pharsalia I 456/7:
regit idem spiritus artus
Orbe alio.
Einen fernen Widerhall unseres obigen Wortes »und auch Gottheiten haben diesen Gegenstand angezeigt«, devatā pi etam attham ārocesum, geben die Acta Sanctorum an: Daemones mihi ostenderunt: Jan. II fol. 144 No. 25.
340 Name u. Bedeutung der Stadt wird in Anm. 689 erörtert.
341 Der merkwürdige Ausdruck ayam pajā tantākulakajātā, »dieses Geschlecht als Garn verflochten« usw., ist von Gotamo wörtlich nach der Atharvasaṃhitā X 8 37 angewandt, yo vidyāt sūtraṃ vitataṃ yasminnotāḥ prajā imāḥ etc.; cf. ebenso Bruchstücke der Reden v. 1040 den Spruch von der Spindel, sibbanī, die den unendlichen Faden des Daseins spinnt und verwebt, wo sibbanī als taṇhāgaddalam, Kette des Durstes, vom Kommentar gut erklärt wird. Bild und Begriff ist von hier aus in die Yoga ruti übergegangen: s.a.a.O. Anm., wo auch andere verwandte Stellen, zumal aus Hamlet nachgewiesen sind; bei letzterem, nach der Konjektur SCHOPENHAUERS »shuttled off this mortal coil« im Monolog (III I 67) zu lesen, ist dieser Ausdruck sichergestellt durch die Parallele in den Merry Wives, Act V, Anfang: »Life is a shuttle«, wenn auch MURRAY immer noch, s.v. coil, bloß shufflel'd (so der Foliant) gibt. Die Metapher mag von SHAKESPEARE neu entwickelt oder auch nur übernommen sein, da sie schon lange vor ihm bekannt und beliebt war. So heißt es z.B. in einer berühmten Dominikanerpredigt des 14. Jahrhunderts, angeblich der 2. des HEINRICH SEUSE: »Der geistliche Mensch möchte sterben und verwerden und schneiden das Garn entzwei.« Ein altes Weberlied schließt ab:
Des Webers Werk währt immer fort,
Kein Mensch kann es ergründen.
Vergl. noch Br. d.R., Register II s.v. Garn. Verschieden davon ist das Gleichnis in den Upanischaden entwickelt, wie z.B. in der Bṛhadāraṇyakā IV (VI) 4 4: yathā pe askārī pe aso mātrām upādāya.
342 In anderen Reden, wie oben S. 203 oder Mittlere Sammlung 872, ist vor der Berührung noch das sechsfache Reich (die fünf Sinne mit dem Denken als sechstem Sinn) zur näheren Vermittlung eingereiht: dieses Kettenglied ist hier als schon innerhalb der Berührung mit eingeschlossen angenommen und daher nicht ausdrücklich genannt. Vergl. das ähnliche Verhältnis S. 218f. und die folgende Anmerkung. Es ist ein saṃyuttavyavahārasādhāraṇapariyāyo; oder wie wir sagen: quidquid est causa causae, est etiam causa causati.
343 Über Bild und Begriff als Erkenntnisgrund kann die dianoiologische Erklärung nicht hinausgehn. Denn obwohl in anderen Reden, z.B. in der 115. der Mittleren Sammlung (S. 872), Bild und Begriff auf Bewußtsein und Unterscheidungen und diese auf das Nicht wissen zurückgeführt werden, so ist das nur ein weiteres verdeutlichendes Aufrollen von Bild und Begriff selbst, worin ebendiese letzteren Glieder [665] schon gegeben, schon enthalten waren: über Bild und Begriff aber kann die Erkenntnisreihe, bez. das Verständnis der Bedingten Entstehung, nicht hinauskommen, weil alles Denken Bild und Begriff zur Form hat, gerade bis dahin und nicht weiter reicht. – Zu einem ganz ähnlichen erkenntnistheoretischen Ergebnis ist SCHOPENHAUER gelangt, gleich in seiner ersten Abhandlung über die vierfache Wurzel des Satzes vom zureichenden Grunde, wo er in § 50 ungemein klar, und in genauer Übereinstimmung mit unserer obigen Stelle, nachweist, daß bei einer Kette von Urteilen, wenn sie zuletzt auf einem Satz von transszendentaler, oder metalogischer Wahrheit beruht, und man fährt fort zu fragen Warum, es darauf keine Antwort gibt, »weil die Frage keinen Sinn hat, nämlich nicht weiß, was für einen Grund sie fordert. Denn der Satz vom Grunde ist das Princip aller Erklärung: eine Sache erklären heißt ihren gegebenen Bestand, oder Zusammenhang, zurückführen auf irgend eine Gestaltung des Satzes vom Grunde, der gemäß er seyn muß, wie er ist. Diesem gemäß ist der Satz vom Grunde selbst, d.h. der Zusammenhang, den er, in irgend einer Gestalt, ausdrückt, nicht weiter erklärbar; weil es kein Princip giebt, das Princip aller Erklärung zu erklären, – oder wie das Auge Alles sieht, nur sich selbst nicht.« Man kann hier sozusagen mit Händen greifen, wie Bild und Begriff den letzterreichbaren Grund und Boden für die erkenntnistheoretische Untersuchung abgibt. Zur praktischen Folgerung daraus Anm. 349.
344 pakkhīnaṃ vā pakkhittāya richtig mit S.
345 Zu nidānam = Abkunft, Abstammung cf. Bruchstücke der Reden v. 865. Ich verdanke diesen Hinweis einem Freunde, der als Kenner unserer Texte die Unzulässigkeit der bisher üblichen Übersetzung durch Ursache, Ursprung, Grundlage usw. erkannt hat, da der Wortschatz unseres Kanons bei allem sonstigen Reichtum keinerlei Begriff und Ausdruck für Prinzip, Urgrund und dergleichen enthält, sondern eben nur anschaulich belegbare Bezeichnungen für Verhältnisse und Umstände.
347 Es ist im obigen nicht etwa eine Art Embryologie gegeben, nach der gangbar gewöhnlichen Ansicht, sondern, kraft alles Vorangehenden schon klar gekennzeichnet, lediglich eine dianoiologische Entwicklungsgeschichte, d.h. wie dem Bewußtsein ein Objekt als zur Erscheinung gekommen sich anzeigt. Dies wird durch ein faßliches und folgenreiches Beispiel, die Empfängnis, dem geistigen Auge wie zum vergleichen vorgeführt: freilich durch das treffendste und daher am leichtesten verständliche Beispiel. Eine solche erkenntnistheoretische Untersuchung wird aber ein andermal auch anders erläutert, und zwar durch das Gleichnis vom großen Baum, dessen mancherlei Wurzeln den Saft emportreiben, und der, nur dadurch ernährt, leben und bestehn kann; ebenso auch steigt und wächst bei hanghaften Dingen dem Befriedigung Suchenden der Durst empor, aus dem Durste das Anhangen, aus dem Anhangen das Werden, und es geht aus Bewußtsein und (geistiger) Nahrung Bild und Begriff als Gezweige auf, mit Wiedergeburt, Alter und Tod: also kommt dieses gesamten Leidensstückes Entwicklung zustande. Saṃyuttakanikāyo vol. II p. 92/3 und Nettipakaraṇam p. 163; zum doppelten Sinn der Nahrung Bruchstücke der Reden v. 747.
348 upapajjetha mit S etc.
349 vaṭṭaṃ vattati mit S zu lesen; am Ende aññamaññam paccayatāya vattati. – Zu diesem Abschnitt cf. den Schluß der II. Rede, I57f., sowie Bruchstücke der Reden, Stellenlese s.v. Bewußtsein. Eine vorzügliche Untersuchung der historisch einschlägigen Fragen verdanken wir OLDENBERG, Zeitschrift der deutschen morgenl. Gesellsch. [666] Bd. 52 S. 681-694, wo gebührend gezeigt wird, daß die Annahme einer Entlehnung oder Abhängigkeit der buddhistischen Erkenntnislehre vom Sāṃkhyam durchaus nichtig ist. Die gotamidische Erkenntnislehre ist eigene Gedankenarbeit, auf dem Boden der altvedischen Anschauung zur Reife gediehen. Gotamo hat den Stoff der älteren ruti, zumal von Yājñavalkyas her, ganz nach seiner Art gestaltet. So ist auch nāmarūpam übernommen, nāma- im weiteren Sinne als (Namens-) Begriff, -rūpam als (körperliches) Bild; wobei das zweite Glied, wie etwa bei candimasuriyā, nach indischem Sprachgebrauch abschließt, im deutschen aber mit der näheren Anschauung anfängt. Beide sind schlechthin gleichwertig als das subjektiv Objektive, oder als objektiv-subjektiv; keins geht vor oder nach: sie stehn und fallen miteinander wie zwei Rohrbündel, die sich gegenseitig stützen – gemäß einem bekannten Gleichnisse Sāriputtos, das er, die beiden letzten Glieder der bedingten Entstehung als einschließendes Beispiel für alle vorangehenden zusammenziehend und damit dieselbe Geltung des Verhältnisses auch innerhalb des Kreises je paarweise bei den übrigen und insbesondere nun im verjüngten Maßstabe zwischen dem subjektiv-objektiven Gliede vollkommen klar nach sämtlichen möglichen Beziehungen andeutend, gebraucht hat, Saṃyuttakanikāyo vol. II p. 113/4. Auf nāmarūpam in Rücksicht auf die frühen Upanischaden hat OLDENBERG, Buddha 5. Aufl. S. 262 Anm. 2, hingewiesen: nur scheint es mir allzu gewagt, in der Blütezeit unserer ernsten Spekulation und Dialektik, welch letztere ja insofern auch im Buddhismus zu finden ist, noch an animistisch totemistische Vorstellungsreste anknüpfen zu sollen; und anderseits gewiß ebenso wenig an quasi physiologische. Die nüchtern verständliche Sprache unserer Texte läßt dies kaum zu. – Die Erkenntnislehre Gotamos ist Bruchstücke der Reden S. 166f. mit einem einzigen Satz umspannt: »›Was irgend an Leiden sich entwickelt ist alles aus Nichtwissen entstanden‹: das ist der eine Anblick; ›Ebendieses Nichtwissen vollkommen restlos vernichten läßt kein Leiden entwickeln‹: das ist der andere Anblick.« Wenn man diesen Satz mit unserem obigen Text und den dazugehörigen Darlegungen der 9., 18. und 75. Rede der Mittleren Sammlung vergleicht, kann man folgenden Grundriß aufstellen. Die Welt der inneren wie äußeren Erfahrung ist ein Wahngebilde des Dursts nach Dasein, der aus blindem Drange ein Objektsein für ein Subjekt schafft und somit Bild und Begriff einer unermeßlichen Vielheit und Sonderheit von Unterscheidungen erzeugt, auseinanderzieht auf der Bahn der Benennung in die Erscheinungen der Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft, die sämtlich zugleich mit der Spaltung des Objektseins für ein Subjekt als Bewußtsein aufgehn: daher ist mit der Empfängnis, die sich als Zeugungsakt sowie überhaupt als jeder empfangene Sinnes- und Denkakt anzeigt, immer je sogleich die Wahrnehmbarkeit der Welt gegeben, und zwar eben nur in der einzig möglichen Form von Entstehn und Vergehn, als zusammengesetzt, bedingt bestanden, vergänglich, wehe, wandelbar. Diese Verbindung, Verknüpfung, Leidensverkettung steht und fällt aber mit dem Bewußtsein, weil sie nur im Bewußtsein zur Erscheinung kommt. Nun ist, bei solcher Erkenntnis, bewußt sein siech sein, irre sein, nichtwissend sein, weil ja aus diesem, einzig möglichen, Bewußtsein Leiden sich entwickelt. So geht aus dem Nichtwissenswahn das Bewußtsein auf, wie eine wahrgenommene Pestbeule: das ist der eine Anblick; die Heilung davon, das Bewußtsein durch planmäßige Wahnversiegung vollkommen schwinden zu lassen, eingehn zu lassen, aufzuheben, und damit alle Weltmöglichkeit: das ist der andere Anblick.
350 Vergl. die entsprechende Darstellung im Priesternetz, I. Rede. S. 25/27. – S hat paññapento etc.
[667] 351 attato mit S und G. Die folgende Ausführung ist ein scharf umrissenes Vorbild der Philosophie HUMES, der sie selbst in Kürze so zusammenfaßt: »When I turn my reflection on myself, I can never perceive this self without some one or more perceptions; nor can I ever perceive any thing but the perceptions. 'Tis the composition of these, therefore, which forms the self.« A Treatise of (sic) Human Nature, London 1740, vol. III Appendix: in der Ausgabe von 1874 vol. I p. 558. In neuer Zeit ist diese Art der Betrachtung zumal von E. MACH, dem nach seinem ausdrücklichen Bekenntnisse HUME am nächsten stehenden Naturforscher, mit all den reichen Hilfsmitteln der modernen Experimentalphysik und Psychometrie erweitert angewandt und erläutert worden, in der Analyse der Empfindungen, 6. Auflage 1911. Der Vater der Versuchskritik weist da exakt und unwiderlegbar nach, wie der Begriff von Seele oder Ich nur dem rohen Verstande als wirklich erscheint; ohne zu verkennen, daß für diesen sicherlich die gemeine ererbte Anschauung und Gewohnheit von praktischer Bedeutung ist. »Alle diese egoistischen Anschauungen«, sagt er S. 18, »reichen nur für praktische Zwecke aus.« Und er fügt, recht erfahren, hinzu: »Natürlich kann der Gewohnheit auch der Forscher unterliegen. Die kleinen gelehrten Lumpereien, das schlaue Benützen und das perfide Verschweigen, die Schlingbeschwerden bei dem unvermeidlichen Worte der Anerkennung und die schiefe Beleuchtung der fremden Leistung bei dieser Gelegenheit zeigen hinlänglich, daß auch der Forscher den Kampf ums Dasein kämpft« usw. – Ähnlich erörtert das Sāṃkhyam und das Yaugam den Wahn der Ichheit als erst durch Empfindungen und nur durch Empfindungen hervor gebracht; er ist gleich dem roten Schein, in welchem der Bergkristall, an sich farblos, vor einer purpurnen Malvenrose leuchtet, kusumavacca maṇiḥ, II 35, VI 28, Yogasūtram I 41. Das Gleichnis ist aus der ruti zwar nicht vor der vetā vataropaniṣat nachzuweisen, wo es II II gegeben wird, war aber schon zu Gotamos Zeiten wohlbekannt, ja volkstümlich, da es in der 79. Rede der Mittleren Sammlung (S. 588-589) bei einem Gespräche mit Pilgern bis auf die letzten Grundlagen untersucht und geprüft und somit als ergänzende Nachprobe unserer obigen Ausführungen dargeboten wird.
352 attānam sich selbst; attā = Selbst und Seele. – Zur vorangehenden Abweisung einer ewig angenommenen Seele bei indischen Pastoralphilosophen und Psychologiekanonikern cf. noch die sehr wichtige 148. Rede der Mittleren Sammlung. Analog hat DEMONAX auf die Frage, ob er glaube, daß seine Seele unsterblich sei, geantwortet: unsterblich, und zwar wie alles – αϑανατος, αλλ' ὡς παντα, nach LUKIAN, Kap. 32. Im übrigen haben freilich die griechischen Philosophenmeister, ähnlich den verwandten indischen Häuptern der Schulen, ohne Richtschnur, ja bloße Ahnung der Möglichkeit eines so strengen Kritizismus, wie zuerst Gotamo und seither nur noch KANT ihn durchgeführt haben, immer und überall auf irgendeine Weise jenen bequemen Begriff aus den Flegeljahren der Spekulation beibehalten, von einer Seele als dem einheitlichen Substrat und real-immateriellen Träger der psychischen Phänomene und Prozesse eines Idealatoms, oder einer Monade, oder der Ichvorstellung, erschlossen aus den Tatsachen der Erfahrung: wobei nun alle oben zurückgewiesenen Annahmen regelmäßig der Reihe nach auftauchen und mehr oder minder fein geltend gemacht werden, von der Unendlichkeit oder Endlichkeit des Ātmās, der Seele, oder des Seelenwesens, von seiner Ewigkeit oder Zeitlichkeit, Untrennbarkeit oder Zusammengesetztheit, Unfühlbarkeit oder Mitfühlbarkeit, von der leiblichen Entelechie und der transzendentalen Geistigkeit, und was dergleichen dogmatische Ansichten, Meinungen, Lehrsätze, Thesen, Antithesen und Antinomien mehr sein mögen, wie sie [668] besonders im Tārkyam und im Sāṃkhyam massenhaft gegeben sind, und kaum minder reichhaltig in der vedāntischen Apologetik. Eine kurze Zusammenfassung solcher Seelenkunde und Seelenauskünfte von seiten der lokāyatās oder sogenannten Weltweisen, die da dünsten wenn sie denken, zwar aus späteren Quellen aber sicher nach alter Überlieferung, gibt bekanntlich der Sarvadar anasaṃgrahas des Mādhavācāryas, der dabei fast schon so oberflächlich wie unsere modernen Energetiker usw. gegen die Lehren des »ollen Buddhismus« loszieht, in rührender Unkenntnis. Vergl. noch Bruchstücke der Reden v. 209; zum weiteren Verständnisse v. 884 nebst Anmerkung, mit dem dazu stimmenden Kanon BEETHOVENS vom 5. Dezember 1826: »Wir irren allesamt, nur jeder irret anderst.«
353 Mit S richtig iti sā diṭṭhīti tad akallam zu lesen.
354 Mit S, G und C taṃ kissa hetu.
355 Mit S tāvatā vaṭṭaṃ vattati.
356 Das Reich des Nichtdaseins, ākiñcaññāyatanam, s.v.a. Sphäre der Abwesenheit jedweden Verlangens nach irgend etwas; vergl. Mittlere Sammlung S. 816: nāhaṃ kvacani kassaci kiñcanatasmiṃ, na ca mama kvacani kismiñci: kiñcanaṃ nātthi, »Nicht gehör' ich irgend wo irgend wem irgend zu, noch gehört mir irgend wo irgend was an: da gibt es nichts.« So wie bei nāddasa, nāgghati, nāñño, nāssa ist hier das nachdrückliche nātthi möglich und vorzuziehn; die Norm ist freilich der lahumatto akkharo, der verkürzte Laut natthi, d.i. na 'tthi, wie TRENCKNER richtig zerlegt nach na 'sti, na 'stu. In der Smṛti heißt es später, nur kurz vermerkt, z.B. im Yogavāsiṣṭhasāras, bei BÖHTLINGK Indische Sprüche 25042,
Nakiṃcidapisaṃkalpāt
sukham akṣayam a nute:
Wer nicht mehr irgend was erstrebt,
Hat unzerstörbar Heil erlangt.
Solche zwar sehr feine aber durchaus nicht unvorstellbare Lehren haben bekanntlich die Gnostiker in ihre Theorien eingewoben, die insbesondere bei den Markosiern in bewußter Verknüpfung mit indischen Gedanken zu stehn scheinen, nach ERNST KUHNS Belegen und Ausführungen in der Gurupūjākaumudī S. 118, mit dem Dogma des MARKOS, der Urgrund des Alls sei ανουσιος, nichtseiend: wo also, nach gotamidischer Anschauung, ein haltloser Übertritt auf metaphysisches Gebiet stattgefunden hat, der freilich alsbald zu leeren Phantasiegebilden wenn nicht gar zum üppigen Wahnwitz führen mußte und bei dem ziemlich gleichzeitig emporblühenden Mahāyānam der ebenso verkehrt übersinnlich beflissenen atasāhasrikāprajñāpāramitā-Meister endlich jenen Gipfel dialektischer Spitzfindigkeit ersteigen mochte, der in müßige Skeptik und mathematische Spielerei ausläuft und im Äther des Unsinns verschwindet. Das klassische Beispiel für einen solchen vikkhepo ist übrigens schon in vorbuddhistischer Zeit zu finden, s. unsere 2. Rede S. 42. Vollkommen gemäß der obigen gotamidischen Darstellung ist dagegen der nach HEINRICH SEUSES sogenannter 2. Predigt überlieferte Ausspruch: »Es muß ein Sterben und ein Verwerden und ein Vernichten hier geschehn, es muß sein Non sum. – Ein ordentlicher geistlicher Mensch sollte so willenlos sein, daß man nichts mehr an ihm gewahrwürde als Non sum.« Dies entspricht denn auch prachtvoll dem so erst im Siegelabdruck richtig umgestanzten kartesianischen Stempel der Bruchstücke der Reden in v. 916:
»Ich bin's, der denkt«, muß gänzlich sein entrodet.
[669] Da erlöschen dann »die höchsten Sonnengipfel des Bewußtseins«, nach SCHILLERS Ausdruck in seiner letzten Dichtung, v. 232.
357 Auch die Betrachtung der Schönheit ist Mittel und Weg zur Läuterung des Geistes: erst an sich um den Sinn von hemmenden Schlacken, von Häßlichem und Widerwärtigem zu reinigen; sodann aber um auch das Schöne zu durchschauen, wie Bruchstücke der Reden v. 199 etc., ähnlich wie SECUNDUS dem Kaiser HADRIAN es erklärt hat: Pulchritudo, naturalis captio, parvi temporis flos, error humanus, omnium cupiditas, dulcis morbus, amabile tormentum, bei MULLACH, Fragmenta philos. Graec., Paris 1860 p. 517. Nb. noch Mittlere Sammlung Anm. 458 den Hinweis auf PLATON (Symposion p. 210-212), und Anm. 502 den gleichen »desiderio della bellezza« in den Rime e Prose di MICHELANGELO BUONARROTI, Chieti 1847, p. 174.
358 Es ist die Stätte, die unser HEINRICH SEUSE »formlos und weiselos« genannt hat, und doch alles Entzückens voll, ohne Bilder und Formen, ohne species intelligibilis, ed. BIHLMEYER, Stuttgart 1907, p. 751, 342 etc. BERNHARD VON CLAIRVAUX hatte den Weg dahin gezeigt, als er lehrte: lectio scripturarum fatigat, non reficit teneriorem animum; docendus est a corporibus vel corporum imaginibus quantum potest recedere, De vita solitaria ad Fratres de Monte Dei epistola, fol. 1036 b der Pariser Ausgabe von 1621.
359 Über die Erlösung von beiden Seiten heißt es noch Mittlere Sammlung 511f.: »Was für einer, ihr Mönche, ist aber der Beiderseiterlöste? Da hat, ihr Mönche, einer jene heiligen Erlösungen, die, jenseit der Formen, keinerlei Form behalten, leibhaftig erfahren und gefunden, und des weise Sehenden Wahn ist aufgehoben. Den heißt man, ihr Mönche, einen Beiderseiterlösten. Und von einem solchen Mönche, ihr Mönche, sag' ich: ›Nicht muß er unermüdlich kämpfen.‹ Und warum nicht? Gekämpft hat er unermüdlich, er kann nicht mehr ermüden.« Zum Verständnis der beiden Seiten, ubhatobhāgā, dient der Stempel der Mittleren Sammlung S. 1050. »Kein hüben und kein drüben«, sowie Bruchstücke der Reden v. 1040-1042: der Denker ohne Hang ist von jeder weltlichen und von jeder überweltlichen Fessel und Form frei; und ist so gleichsam der negative Pol, oder besser: der Vollender geworden gegenüber dem redlich Beflissenen, der auf beiden Seiten das Beste sucht und erlangt, ubhayasa ladhaṃ bhoti, wie Asoko, nach der 60. Rede der Mittleren Sammlung zunächst nur eine Kritik der praktischen Vernunft anwendend, es darstellt, Ende des 9. Felsenedikts, Ṣāhbāzgarhī Zeile 20.
360 Die Vajjīner werden von Asoko auf seinem 13. Felsenedikt, Kālsī Zeile 9, mit als Vasallen aufgezählt, selbständige Fürsten auf ihrem Gebiet, hidalājā, zu den Königen seiner Umgebung gehörig, die Heeresfolge zu leisten hatten: »the kings about here«, wie es mit glücklicher Anschauung RAMKRISHNA GOPAL BHANDARKAR wiedergibt, Journal of the Royal Asiatic Society, Bombay Branch 1902 vol. XX p. 365. Ajātasattu hatte also das selbe im Sinn, was Asoko später erreicht hat.
361 Vassakāro wird als Eigenname angesehn, ist aber in Wirklichkeit der Rang dieses Mannes, der aus altem Priestergeschlecht abstammte, gewesen: er war der Befehlshaber, va yakāras, der den königlichen Willen auszuführen hatte, der Generalissimus. TURNOUR nennt ihn »prime minister«, Journal Asiatic Society Bengal 1838 p. 992. Sein wahrer Name ist uns nicht überliefert. – Ajātasattu ist altvedischer Königsname, so im Bṛhadāraṇyakam und in der Kauṣītaki, als Vorname eines hochberühmten Fürsten, wörtlich: dem kein Feind gewachsen ist, entspricht also etwa dem Aniketos, wie ein Sohn des Herakles hieß, und war ebenso beliebt, auch späterhin; noch im letzten Jahrhundert hatte der Dichterfürst von Benāres Hari candras (1850 [670] bis 1885) den Ehrentitel Ajāta atrus erhalten. Der Name von Ajātasattus königlichem Vater, Bimbisāro, wird als wohlbekannt vorausgesetzt und daher gar nicht angeführt.
362 Genau so hat später Asoko als König von Magadhā der Jüngerschaft zuerst seinen Gruß entboten und Gesundheit und Wohlbefinden gewünscht, um sodann erst auf Wichtiges überzugehn, zu Beginn der prachtvollen Bairāter Inschrift; vergl. Mittlere Sammlung Anm. 298. Mit der Jüngerschaft hat Asoko natürlich die gegenwärtige und künftige aus den vier Weltgegenden gemeint und nicht etwa, ganz ungehörig, eine solche von Magadhā, wie FLEET erst neuerdings wieder im Journal of the Royal Asiatic Society 1908 p. 494 māgadhe irrtümlich bezogen: denn es gab keinen Māgadhasangho, nur einen Māgadharājā. Und eben als König von Magadhā oder Māgadher König hat Asoko sich auch dort oben in Bairāt, im fernen Nordwesten, ganz besonders kennzeichnen wollen, auf jenem mächtigen rötlich-grauen Granitfelsen, der 1500 km von Magadhā entfernt durch seine Inschrift von Magadhā Kunde geben sollte. Der Granitblock mit dem Edikt steht jetzt im Museum der Royal Asiatic Society zu Kalkutta. Eine ausführliche Beschreibung hat CUNNINGHAM beigebracht, Corpus Inscriptionum Indicarum vol. I, Calcutta 1877, p. 24, die beste Phototypie der Inschrift SENART, Journal asiatique 1887 zu p. 498.
363 Diese Art Eheschließung, der rākṣaso vidhiḥ, war, neben mancher anderen, bei Kriegerstämmen gern der Brauch: vergl. Manus III 24 u. 33.
364 Die Sarandadā ist die wohlbekannte wasserreiche aradaṇḍā der Smṛti.
365 maññatīti zu lesen.
366 Vergl. Mittlere Sammlung S. 836f.; die Ausführung ebenda 390-391, auch 655f.
367 Mittlere Sammlung 887-889 eingehend ausgeführt.
368 Mit S tatra pi sudam.
369 S bemerkt richtig gegen C: ito param pāyato diṭṭhāsavāti dissati, suttantanayena pana tayo āsavā ñātabbā. – Vergl. die Summe der Weisheit MICHELANGELOS, am Ende seines Lebens und Schaffens, im Vermächtnis an VASARI, Sonett 56, 2 i.f.:
Ch' errore è ciò che l'uom quaggiù desía.
370 Mit S iti pi.
371 Nach der Blüte des Trompetenbaums, pāṭalī, einer wohlriechenden Bignonie, benannt.
372 Ähnlich Mittlere Sammlung No. 53, Anfang.
373 Ebenso wie Mittlere Sammlung S. 389; desgleichen sind auch die zwei entsprechenden Stellen der Felseninschrift bei Nāsik zu erklären, Taf. II No. 3, in SENARTS Ausgabe Epigraphia Indica VIII p. 65: leṇasa paṭisa[ṃ]tharaṇe, die Stiftung für »eine Höhle, um sie mit Matten auszukleiden«, nach unserem Text āvasathāgāraṃ santharitvā, als ein geeigneter Aufenthalt für Einsiedler. Vergl. auch (sanghāṭiṃ) catugguṇaṃ santharati, den Mantel vierfach gefaltet aufspreiten, gegen Ende unseres vierten Berichtes, S. 276.
374 Die Fördernisse eines Tüchtigen durch sein Gewöhnen an Tugend sind hier wie stets als die erste Staffel zum Aufstieg für den denkenden Menschen allgemein gültig aufgewiesen. Vergl. damit Bruchstücke der Reden Anm. 898 die dort beigebrachte Stelle aus der Mittleren Sammlung: ferner die daselbst angeführte verwandte Erkenntnis ECKHARTS von der Tugend, die zwar im Menschen wesentlich geworden sein soll, jedoch so, daß der Mensch über ihr steht, d.h. daß sie nicht Zweck sondern Mittel sei. Dieser richtige Weg der praktischen Vernunft war, nach [671] PLATON und zumal nach ARISTOTELES (cf. die Belege in der Anm. 137), bei RAYMUNDUS LULLIUS der Grundlage nach gezeigt, in den einfachsten Grundriß gebracht; wobei zunächst ganz allgemein die spezifische Güte oder Eignung des Menschen, d.i. seine Tugend, eben wie bei uns oben der bestimmbaren Tüchtigkeit gleich gilt: In homine sua bonitas est ei ratio, quod agat bonum specificum: homo quidem id quod agit per suam speciem agit naturaliter, sive moraliter: Ars magna, De novem subiectis cap. XLIV. Während aber weder die Griechen noch die Scholastiker bei einer derartigen Untersuchung und Darlegung kaum je über das dürre Schema hinauskamen, war die gotamidische Begriffsfassung, knapp und modern im besten Sinne, dem Leben und der Erfahrung wirklich angepaßt.
375 Vergl. die merkwürdig ähnliche Werkführung Fausts, V. II III-II 126:
Wohl! ein Wunder ist's gewesen!
Läßt mich heut noch nicht in Ruh;
Denn es ging das ganze Wesen
Nicht mit rechten Dingen zu.
– – – – – – – – – – – – – – – – – –
Tags umsonst die Knechte lärmten,
Hark' und Schaufel, Schlag um Schlag;
Wo die Flämmchen nächtig schwärmten,
Stand ein Damm den andern Tag.
Cf. noch die von Poṭṭhapādo vorgetragene Ansicht über einflußreiche Geister, die da dem Menschen eine Wahrnehmung aufdrängen oder abdrängen: 9. Rede S. 128.
376 paccūsasamaye S.
377 Mit S zu lesen: devehi Tāvatiṃsehi saddhiṃ Sakko mantetvā. Vergl. Sakkos Kampf und Burgbau zum Trutze gegen die Dämonen, das himmlische Siegesbanner-Schloß des Götterkönigs, Mittlere Sammlung S. 281f.: als Sage der Vorzeit oben von Gotamo gleichnisweise berührt.
378 Pāṭaliputtam, heute Patna, wo Ganges und Gaṇḍakī in einen Gabelgrund einmünden, bot in größerem Maße, mit einst etwa 400000 Einwohnern, ein ähnlich anmutig reiches, prächtiges Stadtbild wie etwa Koblenz am Zusammenflusse von Rhein und Mosel; die Gaṇḍakī, von manchen, zumal Brāhmanen, heute auch noch Mahī »die Große« genannt, war damals Hiraṇyabāhā geheißen, auch Hiraṇyavatī, »die Goldführende«, so zu Beginn unseres 5. Berichtes. Den obigen Ausspruch Gotamos hat der ausgezeichnete Forscher und Beobachter MEGASTHENES 185 Jahre später an Ort und Stelle wörtlich genau, wie als Zitat aus unserem Text anzuhören, wiederholt: Μεγιστην δε πολιν εν Ινδοισιν ειναι Παλιμβοϑρα καλεομενην: bei ARRIAN, Indica 10 5; wo dann sogleich auch die anderen Angaben über das Landgebiet und die Stromgabel nachfolgen; Hiraṇyabāhā ist bei ihm Erannoboas. Die künftige Größe des Ortes anzudeuten war, angesichts der Lage, für Gotamo eben nicht schwer. Patna ist längst wieder unbedeutende Kreisstadt geworden, vom Delta abgerückt. Es pflegt jetzt den Besuchern mehr durch seine besondere Fülle an rein gelben, wundervoll duftenden Tschampaka-Blüten, die man im August dort überall sieht, in angenehmer kālidāsischer Erinnerung zu bleiben. Eine lehrreiche und anschauliche Darstellung des ganzen Gabelgrundes hat HOEY auf seiner Karte im Journal Royal Asiatic Society 1907 p. 47 gegeben. Vergl. auch die interessante Monographie WADDELLS Pāṭaliputra etc., Kalkutta 1903.
[672] 379 Zu dem Gleichnisse von der Mutter gehören die schönen tiefen Ausführungen in den Bruchstücken der Reden Anm. 149. – »Was an ihnen göttlich war«, yā tattha devatā āsuṃ, ist Hinweis auf die Wahnversiegung, cf. Bruchstücke Anm. 656 nebst den dort gegebenen Nachweisen, sowie auch DE LORENZO, India e Buddhismo antico, 2. Aufl. Bari 1911, p. 224.; lauter Andeutungen von leicht durchsichtiger symbolischer Art, die sich um den Kernspruch Gotamos über den »Mönch, der die heiligste Stätte der Welt ist«, diesen unübertrefflich scharf geprägten Stempel gleichsam umrahmend, entsprechend anreihen: cf. S. 128, Mittlere Sammlung 41, 481, 883, 934, Bruchstücke der Reden v. 486, Lieder der Mönche v. 566. Ein Vorklang zu Beginn der Kaṭhopaniṣat. In diesem Sinne ist auch das pythagoreische Wort zu verstehn, das uns OKELLOS der Lukanier überliefert hat: Ήμερωτατον γαρ παντων και βελτιστον ζωον ό ανϑρωπος (Mansuetissimum enim atque optimum animalium omnium est homo): zunächst freilich ein zu Lachtränen kitzelnder Ausspruch.
380 Von diesen beiden Marschällen Ajātasattus war Vassakāro der Befehlshaber und Sunīdho, in der Smṛti dafür Sunīthas, der Kanzler, der Diplomat: der Name besagt soviel als »wohlgewitzigt«. Amt und Würde solcher Marschälle, mahāmattā, wörtlich: Großwürdenträger, sind bei Asoko oft genannt. Auch bei ihm sind es königliche Minister als Vollstrecker seiner Aufträge und Verordnungen gewesen; mit der näheren Angabe, im 5. Felsenedikt, daß er Ende seines 13. Regierungsjahres insbesondere dhammamahāmattā eingesetzt habe, das sind Kultusminister, für die einzelnen Provinzen des gewaltigen Reichs, »eine Art Cultusdepartement«, wie BÜHLER treffend bemerkt hat, Zeitschr. d. deutschen morgenländ. Gesellsch. Bd. 48 S. 53, während Asoko selbst als oberster Herr und Leiter in Pāṭaliputtam residierte und von da aus, nach Empfang der Berichte, seine Edikte ausgehn ließ, über ganz Indien. Unser Text oben mit dem genau überlieferten Namenstitel der beiden Marschälle zeigt klar, daß schon dritthalbhundert Jahre vorher die militärischen und diplomatischen Agenden weise geteilt waren, eine Einrichtung, die heute wieder England in Indien ebenso erfolgreich durchgeführt hat.
381 Mit S besser anubandhā.
383 saddhim bhikkhusaṃghena ist Glosse, fehlt daher oben bei mahāmattā anubandhā.
384 Mit dem ausgezeichneten Mandalay-Ms nittiṇṇā zu lesen. Divyāvadānam hat entsprechend uttīrṇā, p. 56.
385 niṭṭhitam, C.
386 Hierzu eines der meistgegebenen Gleichnisse, Mittlere Sammlung S. 163, 279, 331, 363, 403, 499, 525, 527, 809, 1030. – Dīgham, sc. addhānam für »lange Laufbahn« ist von Asoko auf dem 10. Felsenedikt, Girnār Zeile I, in d[ī]ghāya angewandt.
387 Die Steinerne Einsiedelei, aus Backsteinen erbaut, der Giñjakāvasatho, gehört zur Klasse der selagharā, Steinhäuser, auch cetiyagharā, in Felsen eingebaute Kammern, wie man sie noch heute allenthalben aufsuchen kann. Von solchen älteren wohlbekannten Stätten erwähne ich nur den selaghara [ṃ] pariniṭhapita[ṃ] in Kārle, No. 1, und den cetiyagharaṃ niṭhapāpita[ṃ] in Nāsik, No. 19, ähnlich No. 18 etc., nach den von SENART im VII. und VIII. Bande der Epigraphia Indica erst gut herausgegebenen Inschriften der Felsengrotten von Kārle und Nāsik, aus dem I. Jahr. n. Chr., die alle dem cātudiso saṃgho, der Jüngerschaft der vier Weltgegenden, gewidmet waren. Von hier aus zurück ist auch das steinerne Schutzhaus, silāvigaḍabhīcā zu erklären, das Asoko an der Geburtstätte des Meisters errichten hat lassen; cf. Anm. 178, wozu ich noch bemerke, daß die richtige Auflösung folgende sein wird: [673] silā + vigaḍ gahane + abhīcā = abhītya, d.i. abhi itya abhicaraṇe wie adhītya adhicaraṇe. – Nādikā, unterhalb Koṭigāmo, Eckersdorf, in der Talmulde gelegen, bedeutet etwa Rauschenbach. Der Kommentar läßt ein Riedmoor in der Nähe sein und erklärt Eckersdorf dahin, daß der Eckstein des Palastes Mahāpanādos, eines Weltbeherrschers der Vorzeit (vergl. Lieder der Mönche v. 163f.), gerade an diesem Orte gegründet war: gewiß nicht weniger volkstümlich als bei uns etwa die Erklärung der Stadt Pößneck, wegen der vielen Raubburgen herum, als dem Bösen Eck; oder wie RABELAIS Paris als »par ris« verulkt.
388 Zu purisadammasārathi im Anklang an die ruti cf. Mittlere Sammlung Anm. 501. Bemerkenswert ist dem gegenüber auch das saṃsārasārathivākyam, einer der tausend Namen für ivas den göttlichen Asketen als den Leiter aus der Wandelwelt: offenbar später nachgebildet.
389 akāliko, wörtlich von Asoko wiederholt, gegen Ende des 9. Felsenedikts, als zeitlose Lehre: ein Begriff der bei Gotamo zuerst erscheint und in Indien sonst nirgend vorkommt. – Dieser und der vorangehende Satz unseres obigen Spiegels der Lehre ist in das erste der beiden goldenen Plattenbänder eingraviert, die 1898 bei Maunggun in der Provinz Prome, Barma, bei der Grundlegung eines neuen Tempels ausgegraben wurden. Sie waren in einen Backstein eingeschlossen, der tief im Schutte der alten Fundamente verborgen lag. M.T. NYEIN, der eine vorzügliche Kollotypie der beiden Goldbänder im V. Bande der Epigraphia Indica zu S. 101 veröffentlicht hat, gibt für das Alter der Schriftzeichen das 1. Jahrhundert nach Chr. an, als das Königreich Prome, wie er sagt, im Zenit seiner Macht stand, eine Schätzung, die ich für allzu früh halte: der Charakter der Schrift weist etwa auf das 4. Jahrhundert hin. Der Inhalt selbst ist in reinstem Pāli, Silbe um Silbe mit unserem obigen Texte gleichlautend, also mit immer gleicherprobter philologischer Genauigkeit überliefert, offenbar im Hinblick darauf, daß es besonders wichtige eigene Aussprüche des Meisters sind. Altbarma hat hier seine treue Kunde unvergänglich besiegelt. Auf der zweiten Goldplatte stehn jene Dinge verzeichnet, die Gotamo den Jüngern gegen Ende unseres dritten Berichtes empfohlen hat: s.S. 265 und Anm. 421 Ende. Das Plattenpaar wurde vom Gouverneur von Barma dem Britischen Museum in London überwiesen.
390 Die vier Paare der Menschen, acht Arten von Menschen, sind vorher, S. 246f., angegeben. Einem dieser Kreise von Jüngern oder Jüngerinnen gehören Nachfolger, die wirklich beigetreten sind, an. Der unterste oder erste Stand ist die erlangte Hörerschaft, der zweite Stand kehrt nur einmal noch wieder, der dritte Stand kehrt nicht mehr zurück, der vierte und höchste Stand ist bei Lebzeiten erlöst. Diese je vier Stufen oder Stände der Jünger und Jüngerinnen stellen natürlich keinen äußeren Kreis, sondern ein inneres Erlebnis dar, und alle vier Stände können von einer Person auch in einem Leben, ja in einer Woche oder noch kürzerer Frist durchlebt werden: siehe die Nachweise Lieder der Nonnen Anm. 41, und vergl. Mittlere Sammlung S. 656. Zum Begriffe der Hörerschaft cf. ib. Anm. 37, Lieder der Mönche Anm. 1027. Verwandte Stellen zum weiteren Verständnisse noch Mittlere Sammlung S. 499-503, sowie Bruchstücke der Reden v. 83-90. – Gotamos Ausdruck cattāri purisayugāni, vier Paare der Menschen, stellt, zum erstenmal in Indien, Mann und Weib, auf einer höheren Stufe, einander gleich; nämlich im gleichen niveau angelangt, nicht mehr und nicht weniger: für jenen fernen Osten eine unerhörte Neuheit, und eben nur durch die »zeitlose Lehre« überhaupt begreiflich. In Griechenland ist diese Ansicht erst etwa 100 Jahre später durch ANTISTHENES aufgekommen, ανδρος και γυναικος ή αυτη αρετη, bei DIOGENES LAERT. VI I 12.
[674] 391 Prima ballerina am Hofe der Fürsten von Vesālī; zu gaṇikā als etwa gleich ἑταιρα, courtisane, cf. Lieder der Nonnen Anm. 25. – TURNOUR in seiner ungemein sorgfältig ausgeführten, teils wörtlichen teils paraphrasierenden Übersetzung, die für die damalige Zeit bewundernswürdig ist, bemerkt zur obigen Stelle: »a female of high rank, one of the accomplished courtesans of Wésáli – a class of persons of great influence at that period from their wealth and mental accomplishments«: Journal of the Asiatic Society of Bengal, Calcutta 1838, p. 999 n. 3. Das beliebte Verschwistern mit der Maria von Magdala hat wenig äußere, bestenfalls innere Berechtigung.
392 Stammlinie der Vajjīner. Vergl. S. 231 nebst Anmerkung 360.
393 yuggena yuggam mit S zu lesen, dann te Licchavī. – Eine Darstellung des indischen Wagens, der dem griechischen gleicht, auf dem prächtigen Pfeilerrelief zu Buddhagayā, aus dem 3.-2. Jahrhundert v. Chr., wo der Sonnengott, Sūryas, mit vier Rossen emporfährt; in RĀJENDRALĀLAMITRAS Monographie, Tafel 50, am besten photographiert. – Kleidung und Schmuck in gleichen oder doch nur abgestuften Farben, bei strenger Vermeidung etwa auffälliger Übergänge, entspricht dem vornehmen indischen Geschmack, der sich hierin bis auf die Gegenwart erhalten hat. Erst jüngsthin wurde gelegentlich der Krönung zu Delhi, im Dezember 1911, berichtet: »Staunenerregend und an alte Märchen erinnernd war die Pracht, mit der die Maharadschas und anderen indischen Großen sich zur Kaiserkrönung ausgerüstet hatten: allen voran der junge Nizam von Hyderabad, der erst vor kurzem die Regierung seines Landes antrat und der Anführer der indischen Fürsten beim Krönungsfest war. Er hat nahe der Stadt für sein Gefolge ein ungeheueres Zeltlager mit Flaggen usw. aufschlagen lassen, und für sich selbst einen Palast errichten, der über und über mit Blumen geschmückt ist. Gelb ist die Farbe derer von Hyderabad. Und gelb leuchtet die ganze Zeltstadt. Gelb sind die Blumen, gelb sind die Teppiche und Flaggen, gelb sind die Automobile, gelb die seidenen Gewänder der Chauffeure, Diener usw. usw.« Analoges folgt dann über die Herrscher von Indore, Alwar, Bharatapur, Kolapur und die anderen, die also unseren versammelten Licchaviern nicht unähnlich gewesen sein mögen.
394 Mit S sace hi me und evam pi mahantam zu lesen. – Die Einnahmen der licchavischen Reichshauptstadt Vesālī beliefen sich jährlich auf Millionen, nach Manus weisem Gesetze größtenteils aus den hohen Steuerabgaben der Landbesitzer und Kaufleute zusammengebracht: cf. S. 44 u. Anm. 69; vergl. auch S. 97. Vortrefflich geprägte Goldmünzen mit einer anmutigen jungen Licchavī-Fürstin als Gemahlin Candraguptas I geschmückt und in der Umschrift entsprechend vorgestellt, wahrscheinlich aus Pāṭaliputtam stammend, zählt RAPSON mit Recht zu den schönsten Erzeugnissen echt indischer Kunst: Indian Coins, Plate IV Nr. 9, in BÜHLERS Encyclopedia of Indo-Aryan Research II 3 B § 90-91. Die Licchavier waren also noch zur Zeit der guptischen Herrschaft hochangesehn. Vergl. Bruchstücke der Reden Anm. 1013.
395 Tāvatiṃsasadisam S.
396 Die Szene dieser Schenkung des Mangohains durch Ambapālī ist auf einem Relief des kleinen Stūpas von Sikri an der nordöstlichen Gebirgsgrenze des Gebiets von Peschāwar, dem alten Puruṣapuram, sehr fein, mit innig ergreifendem Ausdruck, dargestellt worden, wie man es noch am erhaltenen Torso erkennen kann. Eine gute Phototypie davon hat FOUCHER veröffentlicht, Journal asiatique 1903, auf No. XI nach p. 330, und noch zwei ähnliche Darstellungen, heute im Museum zu Lahore, p. 290 besprochen. Das daselbst mit No. 1109 bezeichnete Relief ist künstlerisch minderwertig, das aus Nattu habe ich nicht gesehn; dagegen ist No. 191, ein viertes bei[675] GRÜNWEDEL-BURGESS, Buddhist Art, No. 97, überaus herrlich, ein Meisterwerk auch noch in seinen Trümmern: es stellt, meines Erachtens, die selbe Szene vor. – Über diese gandhārische Kunst im allgemeinen hat neuerdings J.H. MARSHALL, derzeit oberster Leiter der indischen Ausgrabungen, einige Bemerkungen gemacht, die mir wie aus dem Herzen geschrieben sind. Nachdem er die noch immer beliebte Ansicht, jene Skulptur sei nicht viel mehr als ein Abklatsch griechischer Vorbilder, als ein gröbliches Verkennen indischer Eigenart und Schöpferkraft gekennzeichnet hat, zeigt er gründlich, wie die begabten indischen Bildner sich allerdings griechische Form und Technik in Baktrien angeeignet hatten, also gewiß von den hellenistischen Lehrmeistern, die ja übrigens von alters her ihre Stammverwandten waren, tüchtig gelernt hatten und so ihr eigenes Ziel erst richtig ins Auge fassen konnten, um aber nunmehr ihren Weg selbständig zu beschreiten, mit heimischem Sinn und mit eigener Kraft auszugestalten: denn die Vergeistigung ihrer Typen ist eben das besondere Merkmal ihrer Kunst. Unter dem Einfluß hellenistischer Plastik haben sich die besten Muster buddhistischer Anschauung entwickelt, und den indischen Künstlern war es vorbehalten diese Bildwerke mit einheimischem Geist und Gehalt zu durchdringen. Man kann der indischen Kunst wahrhaftig keinen Vorwurf daraus machen, daß sie auf diese Weise imstande war griechische Form und Bildung sich anzueignen; ganz im Gegenteil war es ihr vorzügliches Verdienst, daß sie sich kräftig genug erwies, jene Form und Bildung derart vollkommen zum freien Gebrauch umzumodeln, ohne bei solcher Anpassung und Verquickung die natürliche Lebendigkeit und Eigenart zu verlieren: Journal of the Royal Asiatic Society 1911 S. 842f. Vergl. hiermit noch die Ausführungen, die ich vor mehr als zehn Jahren schon gegeben habe, Mittlere Sammlung Anm. 228, Anm. 467 u. 503, die mit den neugewonnenen Ergebnissen vollständig übereinstimmen.
397 Vergl. Mittlere Sammlung Anm. II; dann S. 385.
398 Diese Weisung entspricht genau der 17. Rede der Mittleren Sammlung; und zwar als Asketenregel nach dem Sāmavidhānabrāhmaṇam III 9: araṇye ucau de e maṭhaṃ kṛtvā tatra pravi et.
399 upaṭṭhākā die jeweilig Nahestehenden oder Aufwärter, wie etwa Ānando, Nāgito, Nāgasamālo, Upavāno u.a.m.: No. 6 Anfang, No. 29 Ende, Mittlere Sammlung No. 12 Ende.
400 Mystagogischer Hodegetik und scholastischer Stöchiometrie mag hier vielleicht ohne allzu große Kühnheit unsere zeitlos gemeinsame, oft besser erfahrene Menschenkunde mit GOETHE als Kommentator vorgezogen werden, der aus seinem eigenen Leben ein Faktum erzählt: »wo ich«, sagt er zu ECKERMANN am 7. April 1829, »bloß durch einen entschiedenen Willen die Krankheit von mir abwehrte. Es ist unglaublich, was in solchen Fällen der moralische Wille vermag. Er durchdringt gleichsam den Körper und setzt ihn in einen aktiven Zustand, der alle schädlichen Einflüsse zurückschlägt.«
401 Ein vedischer Meister pflegt erst vor dem Ende dem Hauptjünger das Beste zu sagen. So hat es z.B. auch Yājñavalkyas vor seinem Abschied von Maitreyī gehalten, in dem innig ergreifenden fünften Kapitel des vierten Buches der Bṛhadāraṇyakopaniṣat; eine Regel, die noch gegenwärtig von brāhmanischen Gurus als strenges Geheimnis eingehalten wird: cf. BURNELL, Vaṃ abrāhmaṇam, Mangalore 1873, p. XIV, s.v. upade as. – Vergl. den Hinweis Lieder der Mönche v. 86: »offen in der Hand.« Auch MERSWINS Wort, Neun Felsen, S. 143: Wer Rede will haben, der gehe und höre offene Lehre.
[676] 402 Mit dem Mandalay-Ms jajjarasakaṭaṃ zu lesen. – Vergl. Bṛhadāraṇyakā IV 3 42: Tad yathānaḥ susamāhitam utsarjaṃ yāyāt, evam evāyaṃ ārīrādi. Gotamo scheint hierauf anzuspielen; cf. Anm. 47. – Zur Erklärung von veghamissakena Lieder der Mönche Anm. 143, nebst vaighnami rakena: also veghana-veghao.
403 Mit Mandalay tamatagge p' ete zu lesen; tam at' agge = tad ato 'gre. – Ebenso hat achthundert Jahre später der Gründer der abendländischen Asketik, der große ANTONIOS, vor dem Verscheiden den Inbegriff seiner Lehre den Jüngern als Vermächtnis hinterlassen, mit den Worten: ζησατε προσεχοντες έαυτοις, και μνημονευοντες ὡν ηχουσατε παρ' εμου παραινεσεων: »Suchen sollt ihr Zuflucht in euch selbst, und eingedenk bleiben der Ratschläge, die ihr von mir gehört habt«, vom Augen- und Ohrenzeugen ATHANASIOS überliefert; cf. den Nachweis in der Mittleren Sammlung Anm. 347, wo noch der letzte Gruß des Heiligen als mit dem letzten Ausspruche Gotamos gleichlautend bezeugt ist.
404 S hat durchgängig Pāvālaṃ cetiyam; richtig erhalten, von Pāvā.
405 Der Hügel mit dem Vielblätterlaub, einer bekannten indischen Mimose, wird in den Sacred Books of the Buddhists vol. III p. 110 als »Shrine of Many Sons« wiedergegeben, obgleich schon ein Blick in BÖHTLINGKS Thesaurus aufgeklärt hätte. Solche, oft noch gelehrt übertünchte Taglöhnerarbeiten, die nicht nur bei dergleichen Scherzen sondern eben durchaus flüchtig und stümperhaft sich erweisen, stehn dem echten Wortlaut so fern, daß sie meist nur einen schrecklich falschen Nachhall vermitteln, und daher einer besseren Kenntnis unserer Urkunden kaum minder kräftig entgegenwirken als die meisten Flugschriften gewisser Liebhaber und Schreihälse: und das, nachdem kundige Forscher längst ein etwa mögliches Verständnis angebahnt haben. Freilich werden die letzteren hier auf erzieherische Absichten gern verzichten, da sie anders beschäftigt sind, auch wohl aus dem Tale of a Tub noch wissen, daß, as to be a true beggar, it will cost the richest candidate every groat he is worth: so, before one can commence a true critic, it will cost a man all the good qualities of his mind; which, perhaps for a less purchase, would be thought but an indifferent bargain.
406 Zum bösen Geiste, personifiziert als Māro, der Tod an sich, cf. Bruchstücke der Reden Anm. 449, wo er als von Gotamo selbst aus der Bṛhadāraṇyakopaniṣat in allegorischer Darstellung übernommen nachgewiesen ist. Die Anschauung ist in das Bṛhadāraṇyakam aus der ältesten vedischen Vergangenheit herabgedrungen, wie dies OLDENBERG in seinem »Buddha« vortrefflich geschildert und WINDISCH in seiner Studie »Māra und Buddha« an der Hand weiterer zahlreicher Belegstellen, S. 177-203, verständnisvoll dargetan hat. Bei uns hat ihr San Francesco eine sehr ähnliche Gestalt verliehen, mit dem Worte: Mors intrat ad animam. Vergl. Mittlere Sammlung Anm. 411. Māro der Tod wird sonst noch, an ein paar Stellen, Namuci genannt, der Nichtlöser, s.v.a. der Zwingherr, so Bruchstücke der Reden v. 426, Lieder der Mönche v. 336, auf welche Bezeichnung, entsprechend dem Bilde von der Umgarnung wie oben und sonst vielfach, denn wirklich die Strophe 440 der Bruchstücke mit muñcam deutlich genug anspielt: wo also, wenn nicht mit Namuci, der vedische Gürtel einmal nicht paßt, den man auch hier, allzu vertrauensvoll, als freilich auf den ersten Blick sehr verlockende muñjamekhalā dem Bösen zulegen und anlegen wollte. – Māro, als junger blühender Gott, im Gespräche mit Gotamo auf einem Relief des Tempels von Boro-Budur, bei PLEYTE Fig. 80. Māro und Kāmo, wie er sonst noch heißt, ist ja in der Tat die eine und selbe Person, Mors et Amor. Darum beginnt eben, lange vor unserem Isoldentristan, die Liebeshymne des Dichters in Moll:
[677] Fratelli, a un tempo stesso, Amore e Morte
Ingenerò la sorte.
Cose quaggiù sì belle
Altre il mondo non ha, non han le stelle. –
Ānandos Versäumnis der Bitte lehrt uns Parzivâls Unterlassung der Frage als verwandten Herzenszug, aus der fernen Vorzeit ererbt, in gleicher Art und Weise verstehn. Dies hat ROMAN WOERNER im »Tag« bemerkt, Berlin 3. März 1912, Beilage. Mit herein blickt die Sphinx.
407 Zu dhammānudhammapaṭipannā cf. Majjhimanikāyo No. 103 i.f. dhammassa cānuddhammaṃ vyākaroti; zu sappāṭihāriyaṃ dhammam ib. No. 77, ed. Siam. p. 322, nebst meiner Anmerkung dazu, Mittlere Sammlung Anm. 150, wo dieser Begriff als patiggaho analog nachgewiesen ist. Sappāṭihāriyam = satprātihāryam, wie satpratigrahādi. Vergl. auch appāṭihīrakatam bhāsitam, unerfaßbar gegebene Rede, d.i. unbergreifliche Antwort: der Gegensatz des obigen »gut erfaßbar«, 9. Rede S. 137.
408 bahujaññam mit S zu lesen; von Asoko als bahune janasi bestätigt, auf dem 7. Säulenedikt 2 1, wo unserem bahujaññam puthubhūtam ein bahune janasi āyatā genau nachkommt »unter vielem Volke eingesetzt«, wie Asoko seine Leute nennt, die er überallhin aussendet, auf daß auch sie die Lehre und ihr Gebot verkünden und verbreiten sollen, unter vielen hunderttausend Wesen. Denn was oben bei uns über die Verbreitung gesagt ist, über das mächtige Aufgedeihen, nach allen Seiten hin, unter vielem Volke, jedem zugänglich, gerade das hat Asoko im Sinne gehabt und sich zum Ziele gesetzt: und erst er, mit seiner imperatorischen Macht, hat durch seine Edikte eine offiziell allgemeine Kenntnis der Lehre über ganz Indien verwirklichen können, von Peschāwar bis Maisūr und von Girnār bis Dhauli, hat also der vor ihm auf das Gebiet zwischen Vindhyer-Bergen und Ganges-Ebene beschränkten Lehre einen etwa fünffach weiteren Umkreis geschaffen. Und insbesondere auf die Worte unseres obigen Textes vom mächtigen Aufgedeihen, iddhañ c'eva bhavissati phītañ ca vitthārikam, bezieht sich der Schluß der berühmten Paralleledikte von Sahasrām, Rūpnāth, Bairāt und iddāpur, die an den vier Angeln des Reichs gelegen einen Umkreis von 100 × 10000 km2 beherrschten, mit der Botschaft: iyaṃ ca aṭhe vaḍhisati vipulaṃ ca vaḍhi sati, »dieses Ziel aber wird gedeihen und zwar mächtig gedeihen.« Erst von hier aus kann man jetzt den Abschluß dieser vier Edikte, das Rätselphantom für scharfsinnige Untersuchungen, an dem von SENART bis FLEET auf die abenteuerlichste Art herumgeraten und herumgedoktert wurde, im Lichte unserer obigen Hauptstelle schon nach der kurzen Fassung in iddāpur befriedigend erklären: iyaṃ ca sāvaṇ[e] sāv[ā]p[i]te vyūthena 256 heißt nämlich: »Diese Verkündigung aber ist verkündet worden vom Ausgang an 256 (mal).« Der Ausgang ist nun nicht, wie auch ich einst vermeint hatte, der Ausgang des Vollendeten, sondern der Ausgang von Asokos Zentrale, von seiner Residenz Pāṭaliputtam: das war jedem, der es hörte oder las, damals sofort klar; von dort aus hat ja Asoko alle seine Kundmachungen erlassen, über sein gesamtes Weltreich, nach allen Richtungen hin, von Anfang an, dort hatte er begonnen seine Inschriften abzufassen und zu verbreiten, auszusenden bis an die äußersten Grenzen seiner Herrschaft. Nun zieht er die Summe, zählt sie alle zusammen und es sind ihrer 256. Vyūthena ist demnach Zeitbestimmung, »vom Ausgang an«, wie dīghena (= Girnar X 1 dighāya), niccena (= G. VII 3 nicā), cirena etc. In Sahasrām und Rūpnāth folgt auf die Zahl sogar noch vivuthā, bez. vivāsā, womit allerdeutlichst die einzelnen Ausgänge, nämlich die 256 einzeln aus der königlichen Kanzlei ergangenen Erlasse gekennzeichnet [678] sind. Das stimmt denn auch mit der in Rūpnāth vorangehenden Weisung an die königlichen Abgesandten trefflich zusammen: etinā ca v[i]yajanenā yāvataka tupaka ahāle savata vivasetavāya ti: vyuṭhenā sāvane kaṭe 200 50 6 sata vivāsā: »Nach dieser Bestimmung aber habt ihr, soweit euer Gebiet reicht, überall auszugehn [vorzugehn, die Sendung zu erfüllen]: vom Ausgang an wurden Edikte erlassen 256, sind ausgegangen [ausgegeben].« Hier ist sata vivāsā = satā vivāsā, wie die Parallelstelle in Sahasrām lehrt, wo satā vivuthā natürlich gleich saṃtā vivuthā ist, wörtlich: seiend ausgegangen; so ist ja auch auf dem achten Felsenedikt bei dasavasābhisito saṃto, wie Girnār hat, in Ṣāhbāzgarhī, wie auch sonst mehrfach, das nicht anusvārierte sato zu lesen. Mit sata vivāsā = sa[ṃ]tā vivuthā ist somit, ohne die mindeste Gewaltanwendung und einzig aus dem unangetasteten Texte selbst, das letzte Glied der Beweiskette gefunden. Welchen Nachdruck der König auf sa[ṃ]tā vivuthā, »seiend ausgegangen«, gelegt hat, zeigt Sahasrām vorzüglich dadurch an, daß da diese gewichtigen beiden Worte gleichsam doppelt behütet werden: zu Beginn durch die Zahl 256 in Worten, zu Ende durch die Zahl 256 in Ziffern. Mit Recht wollte der König über jeden Zweifel dartun, daß die Edikte von ihm selbst ausgegangen seien und daß es 256 gewesen: daher vivuthena vivuthā und Zweihundertsechsundfünfzig 256, so überaus eindringlich, »vom Ausgang an ausgegangen«, in der Felsengrotte von Sahasrām. Diese Zusammenfassung Asokos, wie er dazu kommt, hier das Fazit seiner Lebensaufgabe zu ziehn, wird aber erst ganz verständlich, wenn man die eröffnenden Worte des Paralleledikts von iddāpur und seinem Distrikt gebührend beachtet: der König entbietet den Großwürdenträgern der Stadt, wieder genau im selben Stil wie Ajātasattu oben bei uns S. 231 seinen Gruß, und zwar von wo? Weit oben von Nordosten, aus Magadhā her, vom Suvaṇṇagiri, dem Goldenen Felsen aus. FLEET hat nämlich in einem ungemein interessanten Aufsatz im Journal of the R. Asiatic Society 1908 p. 498 nachgewiesen, daß am Fuße ebendieses Suvaṇṇagiri, wie er heute noch heißt, Rajgir gelegen ist, das einstige Rājagaham, und daß der Suvaṇṇagiri eben der Berg ist, der das alte Giribbajam, die Felsenburg vor Rājagaham, umrahmte. Das also ist der Goldene Felsen des Königs gewesen, von dem aus er sein letztes Edikt, das alle anderen zusammenfaßte, erlassen hat. Nach einer 37jährigen Regierung hatte er das Weltreich seinen Erben dahingegeben und war selbst als buddhistischer Mönch auf den Goldenen Felsen gezogen, sicherlich in treuem Gedenken an das (27.) Bruchstück der Reden, das Pabbajjāsuttam, wo in der 4. Strophe ebendiese Felsenburg, Giribbajam, also der Goldene Felsen, als Aufenthalt des jungen Gotamo angegeben ist: dahin zog er sich zurück, und von dort aus sprach er das letzte Wort; von dort, wenige Stunden nur entfernt von Pāṭaliputtam der Residenz, von wo alle seine Edikte ausgegeben wurden, ist seine letzte Botschaft ausgegangen, am Ende so herrlich wie am ersten Tage des Ausgangs: vyuthena vivuthā, vielleicht arthāntaranyāsena, zugleich mit der tieferen Beziehung: »vom Ausgange an ausgegangen  vom Ausgegangenen ausgegangen«: aber dies nur nebenbei. Dort, am Goldenen Felsen (zum Namen vergl. unser Goldberg), hat Asoko, nach FLEETS sehr einleuchtender Annahme, in einer noch heute erhaltenen Felsenkammer, 12 m lang 4.5 m breit, seine letzten Lebensjahre oder Lebenstage – sein λαϑε βιωσας hat dem Historiker nichts mehr übrig gelassen – als Asket zurückgezogen, vollendet. – Die Berechnung der bisher wiedergefundenen Erlasse zeigt heute schon, wie genau die vom Herrscher selbst angegebene Zahl den wirklichen Verhältnissen entsprochen haben wird. In runder Summe sind jetzt etwa 200 Edikte aufgefunden, bez. nachgewiesen: 7 × 14 Felsen-E. + 6 × 7 Säulen-E. + 4 × 6 Letzte E. + ca. 30 Einzelne E. = 194; cf. V.A. SMITH in der Zeitschr. deutsch. morgenl. Ges. 1911 S. 221-240. Erst [679] später, lange nach Asoko, in den Zeiten des Divyāvadānam hat man dann die an sich so beredte wahre Anzahl der 256 Inschriften nach bekannter mahāyānischer Methode 530 mal übertrieben um die beliebte Normalziffer aller Pracht, rund 84000 zu erhalten: der Weltbeherrscher mußte ja 84000 Elefanten, 84000 Rosse, 84000 Frauen haben, er hatte also auch 84000 Inschriften-Caityās zu errichten gehabt. Ist nun auch diese Zahl des Mahāyānam falsch, so ist sie immerhin eine gute indirekte Bestätigung der Angabe Asokos. Wie er für sich wirklich etwa 250 Elefanten, 250 Rosse, 250 Frauen zu eigen gehabt hatte, so wird er wirklich auch etwa 250 Inschriften, oder wie er selbst eben genau angibt, 256 Erlasse zur Verkündung und Verbreitung der Lehre über ganz Indien auf Felsen, Säulen und Steintafeln ausführen haben lassen, von Anfang an in Pāṭaliputtam ausgegeben haben: seitdem er nämlich Ende des 12. Jahres seiner Königsweihe, wie er von sich auf dem 3. Felsenedikt berichtet, mit so außerordentlichem, umfassendem Eifer seine Botschaft begonnen hatte, nach allen Seiten hin, »auf daß sie lange bestehn könne«, ciraṭhitike siyā. – Die Zerlegung der Zahl 256, wie sie THOMAS gibt, Journal asiatique 1910 p. 520, scheint mir soweit richtig: duve sapaṃnā lāti, als lāti, rātri, bez. rātrī für kālaḥ = omal gebräuchlich und ohne weiters zulässig ist; doch muß man, wie FLEET es richtig getan, in den Faktor duve 100 einrechnen, Journal Royal Asiatic Society 1909 p. 1015 n. 3. Den Sinn der Zahl hatte schon RICE gemerkt, wenn auch auf falschem Wege, cf. FLEET ib. p. 985.
vom Ausgegangenen ausgegangen«: aber dies nur nebenbei. Dort, am Goldenen Felsen (zum Namen vergl. unser Goldberg), hat Asoko, nach FLEETS sehr einleuchtender Annahme, in einer noch heute erhaltenen Felsenkammer, 12 m lang 4.5 m breit, seine letzten Lebensjahre oder Lebenstage – sein λαϑε βιωσας hat dem Historiker nichts mehr übrig gelassen – als Asket zurückgezogen, vollendet. – Die Berechnung der bisher wiedergefundenen Erlasse zeigt heute schon, wie genau die vom Herrscher selbst angegebene Zahl den wirklichen Verhältnissen entsprochen haben wird. In runder Summe sind jetzt etwa 200 Edikte aufgefunden, bez. nachgewiesen: 7 × 14 Felsen-E. + 6 × 7 Säulen-E. + 4 × 6 Letzte E. + ca. 30 Einzelne E. = 194; cf. V.A. SMITH in der Zeitschr. deutsch. morgenl. Ges. 1911 S. 221-240. Erst [679] später, lange nach Asoko, in den Zeiten des Divyāvadānam hat man dann die an sich so beredte wahre Anzahl der 256 Inschriften nach bekannter mahāyānischer Methode 530 mal übertrieben um die beliebte Normalziffer aller Pracht, rund 84000 zu erhalten: der Weltbeherrscher mußte ja 84000 Elefanten, 84000 Rosse, 84000 Frauen haben, er hatte also auch 84000 Inschriften-Caityās zu errichten gehabt. Ist nun auch diese Zahl des Mahāyānam falsch, so ist sie immerhin eine gute indirekte Bestätigung der Angabe Asokos. Wie er für sich wirklich etwa 250 Elefanten, 250 Rosse, 250 Frauen zu eigen gehabt hatte, so wird er wirklich auch etwa 250 Inschriften, oder wie er selbst eben genau angibt, 256 Erlasse zur Verkündung und Verbreitung der Lehre über ganz Indien auf Felsen, Säulen und Steintafeln ausführen haben lassen, von Anfang an in Pāṭaliputtam ausgegeben haben: seitdem er nämlich Ende des 12. Jahres seiner Königsweihe, wie er von sich auf dem 3. Felsenedikt berichtet, mit so außerordentlichem, umfassendem Eifer seine Botschaft begonnen hatte, nach allen Seiten hin, »auf daß sie lange bestehn könne«, ciraṭhitike siyā. – Die Zerlegung der Zahl 256, wie sie THOMAS gibt, Journal asiatique 1910 p. 520, scheint mir soweit richtig: duve sapaṃnā lāti, als lāti, rātri, bez. rātrī für kālaḥ = omal gebräuchlich und ohne weiters zulässig ist; doch muß man, wie FLEET es richtig getan, in den Faktor duve 100 einrechnen, Journal Royal Asiatic Society 1909 p. 1015 n. 3. Den Sinn der Zahl hatte schon RICE gemerkt, wenn auch auf falschem Wege, cf. FLEET ib. p. 985.
409 Die Maschen des Panzerhemdes entsprechen den ähnlich vielfach zusammengesetzten Teilchen des Leibes, woraus sich eben erst der Selbstbestand ergibt. Das Gleichnis ist jenem berühmten anderen verwandt, wo das aus Ziegeln, Balken usw. erbaute Haus die Persönlichkeit darstellt, die der Mönch zerreißt, »mit Pfahl und Pfosten umstürzt«, Lieder der Mönche v. 184, cf. auch v. 57 nebst Anm.: einzeln genau ausgeführt in der Mittleren Sammlung S. 212 und hier mit der feinen erkenntnistheoretischen Untersuchung wunderbar an dasselbe Gleichnis bei KANT erinnernd, wo er sagt: »Nun ist aber ... das Haus gar kein Ding an sich selbst, sondern nur eine Erscheinung, d.i. Vorstellung, deren transszendentaler Gegenstand unbekannt ist«, K.R.V.1 190f. Beide Gleichnisse, das vom Hause sowie das vom Panzerhemd, veranschaulichen sehr gut den nur bedingten Selbstbestand, oder wie es bei GOETHE heißt: »Kein Lebendiges ist ein Eins, Immer ist's ein Vieles«, während hinsichtlich der Persönlichkeit beim Selbstbestande PASCAL trefflich erklärt: »c'est l'assemblage des qualités qui fait la personne«, Pensées I 8 18 i.f. In der nördlichen Überlieferung, z.B. in Nepāl, war ein Verständnis für solche Gleichnisse natürlich längst geschwunden, für so zarte Dinge war dort kein günstiger Boden: daher sehn wir, an Überraschungen gewohnt, im Divyāvadānam aus dem Panzerhemd eine – Eischale werden, p. 203: weil man nämlich mit dem Maschennetz nichts anzufangen wußte, griff man dafür einfach ergänzend nach dem Gleichnis in der 53. Rede der Mittleren Sammlung (S. 391f.), das nun freilich in einem recht anderen Zusammenhange steht. Es ist hier wieder an einem besonderen Falle BÜHLERS Urteil glänzend bestätigt, das er, sehr besonnen und mit vollem Recht, allgemein abgegeben hatte, als er sagte: »die nördlichen Buddhisten haben nur die disjecta membra einer alten Überlieferung aufbewahrt«, On the Origin of the Indian Brāhma Alphabet, 2. Aufl. S. 18 Anm. In seinen übrigen Teilen ist aber der Spruch auch im Norden tadellos erhalten. Zur buddhistischen Saṃskṛt-Bearbeitung und ihrer Art cf. noch Mittlere Sammlung Anm. 215 gegen Schluß. Der alten Pāli-Tradition, die TURNOUR in Kandy studierte, war das ursprüngliche Bild keineswegs entschwunden, jedoch so fern gerückt, daß nur mehr die gröberen äußeren Umrisse kenntlich blieben; so heißt es denn bei TURNOUR, Journal [680] Asiatic Society Bengal 1838 p. 1001: »like unto a victorious combatant who divests himself of his armour«: ein ausgezeichnetes Beispiel für viele andere, wie weit man diesen immerhin nahekommenden Führern folgen und nicht folgen darf. Heutzutage wird schon in Kolombo, das seit etwa 50 Jahren die Erbschaft von Kandy angetreten hat, ganz ebenso interpretiert. – Die obige Szene am Pāvāler Baumfrieden mit dem Entlassen des Dauergedankens, das āyuvossajanam, war auf den Reliefen am Großen Kuppelmal zu Anurādhapuram im Bilde beglaubigt, Mahāvaṃso 30 v. 84: wie sich's gebührt anschaulich geschildert, yathāraham adhikāre akāresi, ed. TURNOUR v. 78.
410 Vergl. die Angaben über ähnliche Wirkungen Mittlere Sammlung S. 411. – Die folgenden sechs Anlässe zu einem Erschauern der Erde stehn zu den ersten beiden Erschütterungen, nach indischer Erdbebenkunde, in verkehrter Proportion mit inkommensurablen Werten, Gedanke: Tat = Mechanik: Dynamik; vergl. später Anm. 488.
411 nibbānam steht hier natürlich ohne die Präposition pari: wobei sich also zeigt, daß diese, wie eben stets in dergleichen Verbindung, nur syntaktisch als »zu, bis, um« gebraucht werden konnte, nämlich auch in der Wendung parinibbānam »zur Erlöschung«; ein Ausdruck, der bald genug von den Hierophanten und Scholastikern dahin mißbegriffen wurde, daß sie aus ihrem eigenen derben Verstandesschnitzer feine systematische Schnörkel herausdrechseln zu müssen glaubten. – Des Vollendeten Erlöschung, nibbānam, war schon bei Lebzeiten diṭṭhe 'va dhamme, und zwar nach der Erwachung, sambodhi, ohne Hangen verblieben, anupādisesam: der Tod ändert daran nichts mehr, löst nur den Leib auf. Vergl. hiermit Ende der I. Rede S. 35. Aber die Erde erbebt noch einmal, bei dem letzten sichtbaren Ereignis, in einem geistigen Schauer. Die nun erst gänzlich genau übereinstimmende Fassung dieser wichtigen Stelle verdanke ich einer Anregung meines lieben Freundes ROMAN WOERNER.
412 Zur Gegend cf. Mittlere Sammlung Anm. 21; Baum und Blatt: Letzte Tage, 1. Aufl., Tafel IX und X.
413 dhammānudhammapaṭipannā ist von Asoko als dhaṃmānupaṭīpatī übernommen, Säulenedikt VII 2 3, wie denn der Begriff paṭipajjati vorschreiten, zumal in diesem Edikt, immer angewandt ist; vergl. Anm. 191.
414 Gomaṭanigrodhe zu lesen. Ein solcher Luftwurzelbaum Letzte Tage, 1. Aufl., Tafel XI.
415 Die Siebenblätterlaubgrotte, Sattapaṇṇaguhā, ist kürzlich im Gebirge bei Rājagaham wiederaufgefunden worden: cf. Archaeological Survey of India, Report for 1905-1906, Calcutta 1909, p. 100.
416 Vergl. Mittlere Sammlung No. 116.
417 Baden im Tapodo erwähnt Mittlere Sammlung No. 133.
418 Vergl. Mittlere Sammlung No. 55. – Die Gehäge, Haine und Gärten, die hier reichlich erwähnt werden, haben wohl nicht viel anders ausgesehn, als wie man sie noch heute auf dem indischen Flach- und Hügellande allenthalben aufsuchen kann: es sind meist uralte Mangohaine, mit Steinaltaren, moosbewachsen, oft auch von hohen Akazien umstanden, mit dem Ausblick in die weite, stille, fruchtbare Ebene, wie etwa bei Sārnāth, Benāres; auch wieder ein dichter Park mit hundertjährigen mächtigen Bäumen, im tiefen Schatten der Pappelfeigen, mit irgendeinem längst vergessenen Steinkegel im Grunde, so zumal in der Umgebung von Faizabad, einst Ayodhyā, noch immer der »Bunten Kuh« im Kreise der Städte; oder auch bewaldete Felsenhügel mit Terrassen und Stufen empor zu einem kleinen Säulengang und Tempel, der den Gipfel krönt, erheiternde Aussicht rings umher auf die Wiesen und [681] Felder gewährt, wie z.B. bei Gayā vom Rāmaselam aus, fern unten der glitzernde Fluß in der Talmulde, der die Landschaft belebt. Das alles gehört mit zum Begriffe caityam, cetiyam, Hain, Park, Altar, Hügel. Gotamo war so ein halbes Jahrhundert lang über ganz Mittelindien und weiter nach Norden immer von Ort zu Ort gewandert, nur während der drei bis vier Monate der Regenzeit an einem Platze verweilend. Zur sehr beträchtlichen Ausdehnung dieser Wanderungen, die ein Gebiet doppelt größer als Deutschland umfaßten, cf. Bruchstücke der Reden Anm. 1013. Auf Gotamo paßte der Titel, den er selbst geprägt hat, und der dann jedem seiner Jünger zukam: cātuddiso naro, Bürger der vier Weltgegenden; vergl. Anm. 178. – Das Vielblätterlaub ist bahuputtā, das Siebenblätterlaub sattapaṇṇā (so S): beides schlanke dichtbelaubte Mimosenbäume.
419 Der oben wiederholt vorgetragene mythische Gedanke, daß nämlich magischer Macht des Willens in der Natur unermeßliche Wirkung zukomme, ist altes vedisches Erbe aus dem Ṛk: vergl. Mittlere Sammlung Anm. 224, auch noch Kauṣītakyupaniṣat I 2, Chāndogyopaniṣat III II 2 tena satyenādi. Von Gotamo selbst ist er immer nur mittelbar, zum hohen asketischen Ziele hinleitend, angewandt worden; die Entwicklung magischer Kräfte soll da stets nur als fördernde Vorschule des Willens dienen, um diesen zu kräftigen, auszubilden, zu stählen und auch auf solche Art dahin zu bringen, die letzte Selbstvollendung und -Aufhebung zu erreichen: sehr klar dargelegt z.B. in der 77. Rede der Mittleren Sammlung, zu welcher die Ausführungen der 119. Rede den weiteren Aufschluß geben. Gotamo hatte als Meister die Gewißheit erfahren, daß der Wille, im Herzen wurzelnd, jeden Augenblick sich finden und fassen und, noch zwischen gut und böse unterscheidend, Schritt um Schritt allmählich zu einem anderen Pfade erziehen sich kann, entgegen einem gosālisch und auch neronisch freilich gültigen, allzumenschlichen velle non discitur. Diese veränderte Richtung, lehrt Gotamo, kann nun unvergleichlich besser in diesem Leben als durch lange Irr- und Umwege nach dem Tode erreicht werden, und die Erweckung der schlummernden Wunderkräfte, die Entwicklung der latenten gewaltigen Energien, von den unteren Graden der Atemübungen an immer höher je nach der Wirkensart, führt zu den tauglichen Stufen empor, wo man alsbald alle Fesseln und Schlacken persönlicher Beschränkung verlieren lernt, so daß der Mensch – natürlich nur der rüstige Kämpfer – noch hier und heute im hinfälligen Leben, mit diesem Körper da, der acht Spannen hoch ist, zur Freiheit, zur ethischen Allmacht gelangt. So ist denn Gotamo allerdings nicht an dem ja richtigen, nur zu komisch bequemen Sumpfergebnis »operari sequitur esse« schon stehn geblieben, hat vielmehr den Satz auf seiner hohen Warte umgekehrt betrachten und als wahr erweisen können, hat gezeigt, daß esse sequitur operari: was der Mensch betreibt, das wird er; der Schauplatz des Handelns und Werdens ist in diesem Leben gelegen und nicht jenseit. Darum spricht er oft wie Mittlere Sammlung 135: Was da ein Mönch lange erwägt und überlegt, dahin neigt sich der Sinn. – Jener nachwirkende vedische Gedanke hat die ursprüngliche Willenskraft auf das begrenzte Dasein mit anwenden wollen und darum dem Gespräch des Meisters mit seinem Jünger die obige, ohne Zweifel postume Wendung gegeben. Aber Gotamos Willenslehre war nie nach außen gekehrt, zur Anweisung wie etwa Mirakel, Warzen-, Lahmen- oder Blindenheilungen und dergl. mehr, gelingen könnten, mochten die auch noch so gewiß sein: der Wille, fern von jedem Wunsche in eine immer vergängliche, lächerlich unzulängliche, so durchaus trügerische und sieche Natur und Mortur zaubernd einzupfuschen, sollte vielmehr einzig die Entäußerung von seiner eigentümlichen Beschränkung und die Auflösung der Persönlichkeit auf dem höchsten [682] Geistesgipfel erschauen und verwirklichen lernen, wie dies Anm. 228 ausgeführt ist. Gotamo hatte so, praktisch geschult, den Willen gar wohl ergründet, ungleich tiefer und umfassender als der hier noch scholastische und auch bloß alltäglich prüfende SCHOPENHAUER, und erst bei ihm ist das vollkommen gelungene Verständnis zu JAKOB BÖHMES Wort zu finden: Wille ist der Vater alles Wesens, ed. 1846, Bd. 6, S. 691, oder zu JEAN PAULS Seherausspruch, in dessen Mutmaßungen über einige Wunder des organischen Magnetismus § 8: »Der Wille ist die dunkelste, einfachste, zeitloseste Urkraft der Seele, der geistige Abgrund der Natur; – Der Wille bedarf, um sich zu steigern, nichts Äußeres, sondern nur sich, eine wahre Schöpfertat.« Die Schöpfertat, ein Weltalter durchzubestehn, hat zwar Gotamo, der vedischen samayakriyā nicht entsprechend, abgelehnt, und wohl schon darum, weil eben seine Macht nicht imstande gewesen wäre, die zeitlose Lehre nicht bis zu Ende des Weltalters in dauernden Gedanken bestehn zu lassen; doch konnte er den seligen Scheidegruß San Francescos »Ego quod meum est feci« schon siebzehn Jahrhunderte vorher vollendet bei sich anwenden: kataṃ karaṇīyam, gewirkt ist das Werk. Es bedurfte daher keiner persönlichen Zauberkraft und -Betätigung.
420 paṭikacc'eva mit S zu lesen, von karoti, wie TRENCKNER erkannt hat; vergl. RHYS DAVIDS, Sacred Books of the East vol. XI p. 58 n.; der Begriff vinābhāvo, aus werden, ist im venir meno LEOPARDIS ebenso genau in der scharfen Prägung zutreffend wiedergegeben, Canto notturno, l. 65-68:
Che sia questo morir, questo supremo
Scolorar del sembiante,
E perir della terra, e venir meno
Ad ogni usata, amante compagnia.
Und es ist wohl merkwürdig, daß bei ihm dies gerade un pastore errante dell' Asia sagt – tiefe Intuition, angesichts der Zeit um 1827.
421 Einzeln angegeben und erklärt in der 77. Rede der Mittleren Sammlung S. 569-571, sowie oft. – Die chinesische Übersetzung und Bearbeitung unseres Textes, um 290-306 n. Chr. vom ehrwürdigen PE-FA-TSU ausgeführt, deren Kenntnis wir dem unermüdlich eifrigen PUINI verdanken, schmiegt sich auch hier, wie stets in allen wesentlichen Zügen, getreu der indischen Überlieferung an; so unterscheidet sie z.B. sehr genau die fünf Fähigkeiten von den fünf Vermögen, eine Feinheit, die einem neuen japanischen Forscher, nach dem Vorgange der Sacred Books of the East und anderer, als überflüssig erscheint: der gründliche PE-FA-TSU entwickelt aber vollkommen richtig die fünf Fähigkeiten, pañc' indriyāṇi, nach PUINI, als »le radici che producono il Bene; sono chiamati i mezzi che l'uomo possiede per produrre il bene«, und die fünf Vermögen, pañca balāni, als »le forze con le quali l'uomo puo resistere al male, che gli si oppone.« Er ist also, weit entfernt vom windigen Gleichinsblaueschwätzen, mit unseren Texten philologisch wohlvertraut geworden, und darum ist ihm seine so ungemein schwere Aufgabe schön gelungen. Vergl. PUINI, Mahāparinirvāṇa Sūtra nella traduzione cinese di PE-FA-TSU, parte prima, Giornale della Società Asiatica Italiana vol. XXII, Florenz 1909; soeben auch als Sonderausgabe erschienen, Lanciano 1911. – WINDISCH hat zu seiner Übersetzung des obigen Kapitels, Māra und Buddha, Leipzig 1895, S. 85, Anm. 1, die artige Bemerkung gemacht, daß die (sieben) Erweckungen (satta) bojjhangā, vielleicht im bewußten Gegensatze zum vedāngam stehn könnten. Ich würde mich dieser Anschauung gern anschließen, um so lieber als ich selbst eine Reihe sicherer Bezugnahmen auf vedische Vorlagen nachgewiesen habe, [683] bis zu mantram und brāhmaṇam hinauf, so im ṣoḍa aḥ stotrāṇām Bruchstücke der Reden Anm. 1123, im sāptaratnam oben Anm. 91, sutyam Anm. 172, und dergl. mehr: hier aber spricht der entscheidende Umstand dagegen, daß das vedāngam eben nur aus sechs Gliedern besteht. – Die obige Zusammenfassung der wichtigsten Dinge, von den vier Pfeilern der Einsicht, den vier gewaltigen Kämpfen, den vier Machtgebieten etc., ist auf der zweiten Goldplatte von Maunggun wiederholt: s. vorher Anm. 389.
422 Das Wort vom »lange bestehn« hat Asoko am Schlusse des 5. und 6. Felsen-, des 2. sowie des 7. Säulenedikts getreu angewandt, auch sonst noch zehnmal; und desgl. den Ausdruck »der Welt zum Wohle, zum Heile«, so zu Anfang der 6. Stelitie, z.B. Radhia 14f., in dieser kürzeren Fassung. Cf. den Index in SENARTS Ausgabe, Band II, Paris 1886, die sonst freilich, seit BÜHLERS Veröffentlichungen im II. Bande der Epigraphia Indica, schon so unbrauchbar wurde wie PRINSEPS Edito princeps von 1838.
423 Vergl. die ähnlichen Strophen in den Bruchstücken der Reden, v. 577-578.
424 Ein Elefantenblick ist ein voller Blick, im Gegensatz zu einem nur seitlichen Hinblicken. – Vergl. Mittlere Sammlung S. 367.
425 Mit S Vesāliyā dassanam zu lesen. Das Krämerdorf oder schlechthin Krämersdorf = Bhaṇḍagāmo. Ähnlich die alte Grenzburg Bhāṇḍāpuram.
426 Weitaus das schönste uns erhaltene Bildnis eines lehrenden Meisters, im strengen reinen altindischen Stil des Siegers, jino, dargestellt, wie er heiter erhaben dasitzt, mit verschränkten Beinen, wie von einem Throne herabblickend, ist der etwa 12 m hohe aus dem Felsen gemeißelte Buddho bei Ta-t'ong-fu in der Provinz Schan-si, aus dem 5. Jahrh. n. Chr.: eine Gestalt, die an ursprünglicher Herrlichkeit die an sich so bedeutenden kolossalen Dai-Butsu in Japan um soviel überstrahlt als sie älter und besser überliefert ist. Eine Wiedergabe bei FOUCHER, Journal asiatique, 1909 zu p. 54. In Indien selbst waren alle solchen Denkmale durch die muhammedanische Invasion längst in Trümmer gegangen. Siehe oben Anm. 315.
427 Bhoganagaram, die Bhoger-Burg; man könnte auch Bogenhausen sagen. Vergl. Bruchstücke der Reden Anm. 1013.
428 Zu Ānandeyacetiyam, dem Denkmal der Ānandiden, cf. die königliche Residenz īlādityas VII Ānandapuram, im Reich der Guptās, Corpus Inscriptionum Indicarum vol. III p. 173. Der Name der Stadt entspricht ungefähr unserem Wunsiedel, auch Wolmirstedt u.a.m. Ānando = Wohlmut, Mittlere Sammlung S. 686 u. Anm. 237. Das oben erwähnte Steinmal oder Denkmal der Ānandiden dürfte auf einen vedischen Meister der Vorzeit gleichen Namens zurückweisen, nach einer Inschrift des Königs Attivarmā, der seinen Stammbaum aus dem Geschlechte des großen Sehers Ānandas ableitet, als ein Ānandamaharṣivaṃ asamudbhūtas, cf. Indian Antiquary, Aprilheft 1880 zu p. 102 Tafel No. 1a Zeile 1, die vortreffliche Ausgabe von FLEET. Späterhin ist noch ein brāhmanischer Muni namens Ānandatīrthas überliefert, das hochgefeierte Oberhaupt der Viṣṇubhakti, jener Weltweisen, die Viṣṇus verehren: ein Mann, nicht minder berühmt als aṃkaras, der Gründer der Vedānta-Schule, wie KRISHNA SASTRI, der Herausgeber der betreffenden Inschrift, in der Epigraphia Indica vol. VI p. 261-265 des näheren nachweist. Aus älteren Zeiten ist der Name Ānando nicht weiter bekannt: es sei denn Girimānando, jener einsame Sänger, der sich auf Bergen wohlgemut fühlt, in den Liedern der Mönche v. 325-329.
429 Mit S osāretabbāni, osāriyamānāni, osaranti zu lesen.
430 mātikā, eigentlich Sammelbecken, Kanal, Wasserleitung; daher dann s.v.a. Überlieferung. In der Mahāvyutpatti, etwa tausend Jahre später, ist der Begriff zu [684] einem scholastischen Terminus für den Abhidhammo erstarrt, wie viele andere dergleichen.
431 Aus der Darstellung dieser vier Bezeugnisse geht hervor wie trefflich es eingerichtet wurde, das Meisterwort rein zu überliefern, in tief bedachter Vorsorge, daß jedem einzelnen Jünger die Freiheit zustehn könne und solle zu prüfen und nach erfolgter und bestandener Prüfung als echt überliefert weiterzugeben was eben gerade er selbst auf seiner mehr oder minder längeren Wanderschaft mit dem Meister oder mit wohlvertrauten Nachfolgern von Angesicht vernommen hatte. Nur auf solcher weitherzig dargebotenen Grundlage konnte jene sichere Übereinstimmung erreicht werden, die uns über die Jahrtausende hin noch heute als Kennzeichen der alten Texte gelten darf. Daher hat denn jeder Jünger seinen Bericht mit dem von ihm persönlich verbürgten Worte eröffnet: »Das hab' ich gehört.« Den vielen und mancherlei Jüngern war vieles und mancherlei gesagt worden, mitgeteilt worden, zu Ohren gekommen: die einen hatten Das gehört, die anderen Das. Jeder sagt nun was er selbst erfahren hat. Und die stets untersuchte Übereinstimmung aller mit allen, bei den einzelnen je nach Art und Anlaß unterschieden, doch im allgemeinen die eine und selbe; das ist die umfassende Lehre, die reiche gotamidische Satzung. Vergl. noch die Anmerkung 751 der Bruchstücke der Reden. Eine entsprechende Stelle hat OLDENBERG, Buddha, 5. Aufl. S. 401, sogar aus dem Vinayapiṭakam, dieser dürren späten Kasuistik, herangezogen, wenn auch recht unglücklich übersetzt; wo nach Cullavaggo XI 1 11 der Jünger Purāṇo die Berichte der anderen Ordensbrüder zwar billigt, dabei aber erklärt, daß ihm auch was er eben selbst vom Meister gehört, von Angesicht vernommen, als gleichwichtig zu gelten habe, tathevāhaṃ dhāressāmi. Kurz, wie schon gezeigt: andere haben das gehört, ich habe das gehört; stimmt es überein, ist beides echt.
432 Zu kammāraputto = Goldschmied cf. Suttanipāto v. 48 suvaṇṇassa pabhassarāni kammāraputtena suniṭṭhitāni; wozu der Cūḷaniddeso, ed. Siam. p. 268, bemerkt: kammāraputto vuccati suvaṇṇakāro. Vergl. auch die vielgepriesene Subhā, des Goldschmieds Töchterlein, kammāradhītaram, Lieder der Nonnen v. 338-365. Cundo der Goldschmied ist ein wohlhabender, wenn nicht reicher, Bürger gewesen. So kommt unter den Stiftern der alten Felsentempel im Mahārāṣṭram nebst Fürsten, Kaufherren, Werkmeistern eben auch ein solcher suvaṇṇakāro mit einer Spende vor, desgl. in den buddhistischen Felsengrotten von Kaṇheri, sowie in Junnar, Archaeolog. Survey of Western India IV p. 94 Nr. 13 T. XI, IX. Schon TURNOUR hatte übrigens den »goldsmith« richtig erkannt, was aber ganz unbeachtet blieb: Journal Asiatic Society Bengal 1838 p. 1003. TURNOUR ist auch, nebenbei gesagt, der Erste gewesen, der die korrekte Form Gotamo Buddho übernommen und konsequent beibehalten hat. Das ist aber längst vergessen, und überall spricht und schreibt einer dem andern den ungehörigen Vokativ auf -a nach, auch wenn er es wohl besser weiß. Hatte doch vor nun bald hundert Jahren A.W.V. SCHLEGEL die Wiedergabe der Eigennamen durch den Nominativ wissenschaftlich begründet und, wie er sagt, abweichend von der gewöhnlichen (d.i. falschen) Schreibung »geflissentlich durchgeführt«: s. die ausgezeichnete kurze Darlegung dieser nicht ganz unwichtigen Frage in seiner Indischen Bibliothek, 1. Bd. Bonn, 1820, S. 46-48. Während also vor dem großen Bahnbrecher auch auf unserem Gebiete ganz allgemein – und längst in beliebter Barbarei wieder überall – durch rein mechanischen Ersatz der bloßen Stammform an Stelle des wirklichen Nominativs bei den insgemein auf Vokale auslautenden Namen die männlichen nicht von den weiblichen und beide nicht von den sächlichen zu unterscheiden sind, hat SCHLEGEL dem Zeichen des Nominativs im Saṃskṛt, das meistens ein s ist, zu seinem Rechte verholfen [685] und sagt daher stets: Rāmas, Vischnus usw. Wenn sich nun freilich bei den äußerst vielseitigen und feinen Wohllautgesetzen des Saṃskṛt eine gewisse Schwerfälligkeit hierbei nicht vermeiden läßt, ist hingegen im Pāli die strenge Durchführung dieser Regel die einzig natürliche und angemessene, weil man nach dem Schema -o als nom. masc., -ā als nom. fem, und -am als nom. neutr. den ursprünglichen Textlaut und seine Form völlig unverkümmert wiedergeben kann und soll.
433 Die Ebermorchel, sūkaramaddavam, ist ein wohlschmeckender Pilz, der an den Vorbergen des Himālayo, wo Pāvā gelegen war, wohl zu unterscheiden von der gleichnamigen Stadt in Bihār, S. 238, auch heute noch, zusammen mit schwer unterscheidbaren giftigen Abarten, üppig gedeiht und von Keiler und Sau mit Vorliebe aufgesucht und vorzüglich ausgespürt wird, gleichwie auch die Keilertrüffel, varāhakandas, und dergleichen Erdfrüchte mehr, eben den Wildschweinen die Benennung verdanken; vergl. Mittlere Sammlung S. XXXf. der Vorrede. Maddavam ist also Morchel oder Maurache und keineswegs Sülze oder Pastete, da wir für letzteres Gericht die an sich recht genaue Bezeichnung sūkaramaṃsam haben, Eberfleisch, in der Angabe sampannakolakaṃ sūkaramaṃsam, in Pfeffer eingemachtes Eberfleisch, das bei anderer Gelegenheit, von anderer Seite dargereicht, gleichfalls unbesehn als Almosen angenommen wurde: Anguttaranikāyo, Pañcakanipāto No. 44. Der Meister und die Jünger bestimmen ja selbstverständlich nicht das mindeste über die Art der dargereichten Nahrung: Mittlere Sammlung 55. Rede. – Jenes »Eberfleisch« nun könnte allerdings, ganz wie unsere »Bärentatze«, zugleich auch wieder als Pilz und zwar geradezu als »Pfifferling« gelten, was um so wahrscheinlicher wird, als es dort in der Reihe der drei besten Gemüse namhaft gemacht ist; sūkaramaddavam dagegen bedarf keiner solchen inneren Auslegung, weil es nur eindeutig von mṛl gaudere, yassa tad, d.i. des Ebers, nicht vom Eber, als tatpuruṣam bestehn kann. Oben, in unserem Falle, gehört nun noch überdies Cundo, als Juwelier und Besitzer eines Landguts, dem reichen Handwerkerstande an: Wildbret, zumeist nur Speise der verachteten Jägerkaste, aufzutischen wäre ihm, dem vornehmen Bürger, wohl im Traume nicht eingefallen. In das reichliche Morchelgericht, das er als besonders erlesen noch hinzugetan hatte, waren eben nur leider schwer kennbare giftige Maurachen mithineingeraten. Gotamo hat die Gefährlichkeit der dargebotenen Schüssel, vielleicht durch feinen Geruch, sogleich gemerkt, die Gabe als solche aber nicht zurückgewiesen, nur entsprechende Anordnung getroffen. Er war übrigens lange schon vor dieser Mahlzeit sterbenskrank gewesen, wie es gegen Ende des zweiten Berichtes heißt, so daß die neuerliche Erkrankung überhaupt in keinem ursächlichen Zusammenhang mit der letzten Almosenspeise zu stehn braucht: wie dies ja auch die eigenen Äußerungen des Meisters klar anzeigen. – Die Entgegennahme der Speise war im Relief dargestellt worden, als sūkaramaddavagahanam, nach Mahāvaṃso 30 v. 85 nebst all den anderen Szenen der letzten Tage auf dem Großen Kuppelmal zu Anurādhapuram prächtig ausgeführt, im 2. Jahrh. vor Chr., auf Befehl des mächtigsten Imperators der Insel, des Königs Duṭṭhagāmini, der heute noch in der Erinnerung des Volkes unvergessen weiterlebt.
434 Mit S tā pi, vorher sabāḷhā zu lesen. Vergl. oben S. 252.
435 S bhuttassa ce.
436 S Kakudhanadī und acchodakā sātodakā sītodakā setodakā sowie sītīkarissati; gattāni pi als varia lectio. – Die folgende Darreichung des Wassertrunks war im Relief abgebildet: Mahāvaṃso 30 v. 85.
437 Mit S besser atikkantāni: vorher richtig mit S piṭṭhito piṭṭhito und divāvihāraṃ nisīdi.
[686] 438 Mit S zu lesen; kiṃ hi bhante karissanti und dasa vā sakaṭasatāni sahassaṃ vā sakaṭasatāni.
439 avidūre bhusāgārassa mit S.
440 So S, ohne mam abhivādetvā. – Vergl. Mahopaniṣat II ν. 62 (Bombay):
yas sacitto 'pi ni cittassa jīvanmukta ucyate.
441 Mit S yugamaṭṭham. Ein seidenartiger Batist aus Benāres (Komm.). Der Gebrauch echter, aus China bezogener Seide ist durch die jüngst erst erfolgte Auffindung des Kauṭilīyam für das 4. Jahrhundert vor Chr. verbürgt, wo sie II 11 ausdrücklich erwähnt wird, nach JACOBIS Angabe in den Sitzungsberichten der königl. preuß. Akademie der Wissenschaften, Berlin 1911 Nr. XLIV S. 961; ed. Shama Sastri, Mysore 1909.
442 Mit S idam bhante singivaṇṇaṃ yugamaṭṭham dhāraṇīyam bhagavato kāyam upanāmitaṃ hataccikaṃ viya khāyatīti.
443 S richtig: ativiya tathāgatassa kāyo parisuddho hoti chavivaṇṇo pariyodāto, ebenso wiederholt; dann: pacchime yāme, wie auch C hat, und antare.
444 Mit S alt und echt: somavaṇṇo asobhatha. Vor Mondesschimmer verblaßt Goldesglanz. – Die Szene wurde, nach Mahāvaṃso 30 v. 85, von der bildenden Kunst überliefert.
445 Mit S zu lesen:
Gantvāna buddho nadikaṃ Kakudham
acchodakaṃ sātodakaṃ vippasannam,
ogāhi satthā akilantarūpo,
tathāgato appaṭimo ca loke.
In der zweiten Strophe idha dhamme und in der letzten wieder akilantarūpo. Der Meister, der auf seinem letzten Gange den Scharen der Jünger noch rüstig voranschreitet, nach dem Bade in der Kakudhā, wie da berichtet wird, läßt keine Müdigkeit sehn, verbleibt ja so bis zum letzten Atemzug. Auch nach den barmanischen Handschriften richtig bewahrt. Erst spätere Scholiasten haben sukilantarūpo »schien sehr ermüdet« hineinbessern zu sollen gedacht.
446 Mit S paribhuñjitvā parinibbuto. Dann Cundassa kho; etc.
447 Mit S saṃyamato veraṃ na vīyati.
448 Die Wasserscheide der Hiraññavatī, Hiraṇyavatī ist in Anm. 378 skizziert; hier ist ihr Oberlauf gemeint, in den Vortälern des Himālayo.
449 Der Kronbaum ist Vatica robusta, sālo, dem Wuchse nach einer Pinie ähnlich, aber zur Klasse der Dipterokarpazeen gehörig. Es ist ein vierzig bis fünfzig Meter hoher Baum, gerade, stark, majestätisch emporgewachsen, mit zahllosen, etwa primelgroßen hellgelben Blüten. – Die zwei Kronbäume, mit der Bahre in der Mitte, sind auf einem Siegelabdruck aus der Zeit um 400 n. Chr. dargestellt, vor einigen Jahren bei Kasiā aufgefunden: vergl. später in der 496. Anmerkung den Nachweis. Es sind also keine Zwillingsbäume, oder gar »zwei Zwillingsbäume«, wie immer noch OLDENBERG, Buddha 5. Aufl. S. 232, allzu wohlmeinend übersetzt, sondern je ein Baum an der Seite: ein paar Kronbäume, yamakasālānam. Ist ālakṣyalakṣaṇe, als Hochwaldrelief zu betrachten.
450 Richtig mit S ettāvatā 'va tathāgato. – Die alsbald genannten vier Arten von Jüngern oder Versammlungen, 1) Mönche, 2) Nonnen, 3) Anhänger, 4) Anhängerinnen, sind desgleichen auf der ältesten bisher bekannten kuṣanischen Inschrift, aus [687] dem 3. Jahre Kaṇiṣkas, d.i. nach FLEET etwa 55 vor Ch., angegeben: Epigraphia Indica VIII zu p. 176; wo sich aber diese vierfache Gemeinde als Stifterin eines Standbildes in Benāres bekennt, die Hauptspender mit Namen anführt und, meines Wissens zum erstenmal, den Titel trepiṭako, Kenner des Dreikorbs, und trepiṭakā, Kennerin des Dreikorbs, für den Mönch Balo und die Nonne Buddhamitrā gebraucht, eine Bezeichnung, die also erst um diese Zeit, etwa 200 Jahre nach Asoko, aufgekommen ist, als die Kenntnis der Meisterworte in dem Grade abgenommen hatte, daß man als Ersatz dafür einen dritten scholastischen Korb aufstellen mochte. Der einstige Ehrentitel pañcanekāyiko, Kenner der fünf Sammlungen (des einen echten Korbes) war nun vergessen, und auch Nonnen konnten als Trägerinnen der hybriden drei Körbe gelten: sie, denen man in der klassischen Zeit kaum das Behalten einer einzigen Meisterrede zutraute, wie das die Mittlere Sammlung S. 1060 schön bezeugt. Man kann getrost sagen: der Verfall des Ordens beginnt um die Zeit, wo der Titel tripiṭakam auftaucht: der aber ist vor Kaṇiṣkas epigraphisch unbekannt. Dagegen entspricht unserem obigen Texte ganz vortrefflich ein Titel, der sich auf einer bedeutend späteren Inschrift noch erhalten hat, aus der Zeit Bhavadevas von Ratnapuram, 8. Jahrhundert n. Chr., weit unten in Mittelindien, östlich von Nāgpur: der ikṣāpadī, der der Regel Schritt um Schritt nachfolgt, āntaḥ, sakalajanahitābhyudyataḥ, von KIELHORN nachgewiesen Journal Royal Asiatic Society 1905 p. 628 l. 34. Auch hieran zeigt sich, daß der Verfall im Norden ungleich rascher gewesen sein muß, während der Süden die alte Überlieferung viel reiner bewahrt hat.
451 apasādeti; cf. dazu apasādanam Abrede, im Stempel der 139. Rede der Mittleren Sammlung.
452 Von hier aus wird auf dem langen syrisch-alexandrinischen Wege und später noch unter Beihilfe des areopagitischen DIONYSIOS die Nadel verdreht worden sein, mit der Spitze nach oben und den zahllosen Engeln darauf, wie sie die Summa des Doctor angelicus dann catholice sicherstellen wollte. Nicht so plump äußerlich verdreht, vielmehr in zarter geistiger Berührung mit unserer obigen Stelle steht die Ansicht des DIVUS BERNARDUS CLARAEVALLENSIS, die er über hundert Jahre vor dem Universalaquinaten sehr fein, wie indisch anmutend – κ' ουδεις οιδεν εξ ότου 'φανη – dargeboten hatte: Angelorum millia millium qui ad Christi sepulchrum convenerant, dulces ei ac devotas exequias et victoriam decantabant. Illi domino laudes canebant: sed Maria gemitus et suspiria emittebat: fol. 161/2 ed. Par. 1621. – Die tibetische Übersetzung scheint unseren Text hier wie in der Wiederholung durchaus richtig verstanden zu haben: cf. FOUCAUX in den Annales du Musée Guimet, tome VI Paris, 1884, p. 382.
453 chinnapādaṃ viya papatanti mit S.
454 Ebendieses Wort hat Asoko auf der berühmten Säuleninschrift von Paḍeria, und zwar als Zitat es kennzeichnend, wiederholt: hida budhe jāte, wo buddho dem tathāgato vollkommen gleichsteht, Epigraphia Indica vol. V Tafel 1 Zeile 2. Der große indische Imperator ist der obigen Anweisung innen und außen getreu nachgekommen: sie war ihm also wohlbekannt. Er hat dann am Ende dieser Weihinschrift das Zitat wiederholt, jedoch da hida bhagavaṃ jāte gesagt, unseren Texten gemäß auch diesen Ausdruck anwendend. Seine Angabe, daß er selbst gekommen sei um Verehrung zu bezeugen, ist vollkommen klar: denn mahīyite, mahīyitam heißt nur dies, und nicht etwa, wie FLEET p. 473-475 Journal Royal Asiatic Society 1908 meint, jemandem eine Auszeichnung erweisen; wie ja auch in unserem Berichte späterhin die Maller und die anderen Fürsten mahaṃ karonti, eine Feier bereiten, d.i. Verehrung [688] bezeugen. Ferner ist aṭhabhāgiye sicher gleich arthabhāgyas und nicht aṣṭabhāgyas, da das der König mit ubalike kaṭe schon gesagt hat und nun mit einer ganz besonders reichen Gabe abschließt. Das Divyāvadānam p. 390 hat also hier das Rechte getroffen. – Die vier Stätten sind von der buddhistischen Skulptur gern dargestellt worden, in der Gandhārer Kunst sowie in Amarāvatī, ebenso auf einer neuerlich ausgegrabenen Steinplatte im Hochrelief, die MARSHALL im Frühjahr 1907 in Sārnāth gefunden hat, wo zugleich noch vier weitere bedeutende Orte zu sehn sind: cf. die Tafel zu p. 1000 Royal Asiatic Society 1907; größer und deutlicher im Journal asiatique 1909 zu p. 44, mit den ausführlichen Erklärungen FOUCHERS, der auch auf eine wörtliche Parallele zu unserem Text im Divyāvadānam p. 244 – jātir abhisambodhir dharmacakrapravartanam parinirvāṇam – hinweist.
455 ālapante mit S.
456 Kaiserkönig, cakkavattī, s.v.a. Imperator, König Erderoberer; näher zu vergl. Bruchstücke der Reden Anm. 1002, wo dieser durchaus volks- und landestümliche Begriff bis hoch in die altvedische Kultur nachgewiesen ist. In späteren Zeiten war dann die Vorstellung eines solchen Gipfels höchster Machtfülle derart beliebt geworden, daß Kālidāsas, um 390 nach Chr., das kühne Bild giricakravartī anwenden konnte, der Kaiserkönig der Berge, für den Himālayo.
457 FLEET, der im Journal of the Royal Asiatic Society 1906 den obigen Text wiederholt ausführlich besprochen und übersetzt hat, glaubt, p. 661f., es sei an keine eherne oder eiserne Truhe zu denken, vielmehr an eine eisenfarbig gestrichene Holztruhe, weil nur letztere brennen könne. Man darf aber den Text nicht willkürlich ändern oder deuten, sondern muß ehern lassen was ehern angegeben ist. Wie die Technik bei der Verbrennung gewesen, wissen wir freilich nicht; es ist jedoch wohl anzunehmen, daß dieser metallene Sarkophag eben eigens zu dem Zweck eingerichtet war, etwa oben mit einem durchbrochenen Roste versehen. Ebenso wenig wissen wir, wie die Einbalsamierung während der sieben Tage vor der Verbrennung des Leichnams durchgeführt wurde. Der Text spricht auch dort nur von Räucherwerk, Weihrauch. Das muß uns genügen. Der Scheiterhaufen selbst soll zumeist aus Sandelholz gewesen sein, sagt der Kommentar. Dieser Brauch gilt noch heute bis nach China und weiter, bei der Verbrennung besonders ausgezeichneter Mönche: Sandelholz ist der ideale Brennstoff, aber aus Sparsamkeit pflegt man in der Regel gewöhnliche Scheite zu verwenden, und Späne der kostbareren und würzigen Hölzer werden von Zeit zu Zeit in die Flammen geworfen; die vollständige Einäscherung ist binnen 6-12 Stunden beendet: nach PERCEVAL YETTS' Notes on the Disposal of Buddhist Dead in China, Journal Roy. Asiatic Soc. 1911 p. 705/6.
458 Vergl. Mittlere Sammlung S. 799.
459 Mit S tattha ye te mālam.
460 Zu paccekabuddho cf. Mittlere Sammlung No. 116.
461 ayaṃ tassa paccekabuddhassa thūpo mit S.
462 vihāro hier ein kleines Schutzhaus oder Obdach im Walde, wie dergleichen später auch Asoko entsprechend errichten ließ, Inschrift von Paḍeria Zeile 3; cf. Anm. 178 und oben S. 246 mit Anm. 387. – Der Türkopf, kapisīso, wörtlich Affenkopf, ist das Karnies, in das der Türpfosten endigt. Solche Rinnleisten haben, roh ausgedrechselt, Ähnlichkeit mit Affenköpfen, werden auch als Löwenköpfe profiliert: die letzteren hat Asoko für seine Säulen, Tore u.s.w. gewählt. – Kapisīsako, zum Türkopf gehörig, daran befindlich, terminus technicus der altindischen Bauleute.
463 atittā va, va = iva.
[689] 464 khuddakanagarake, sākhānagarake parinibbāyi, santi bhante, Sāvatthī, Kosambī, Bārāṇasī richtig mit S und Mandalay zu lesen; auch C so die zwei letzten. – Campā in Bengālen, am weitesten gegen Osten, ist zu Beginn der 4. Rede unserer Sammlung S. 76 geschildert, Rājagaham im Süden, als Hauptstadt von Magadhā, eine der meist genannten Königsburgen, im Norden Sāvatthī und Sāketam waren die zwei Residenzen des Königs von Kosalo, Mittlere Sammlung S. 174f., Kosambī im Westen, am breiten glitzernden Gestade der Yamunā gelegen, war noch den Griechen als Reichsfeste wohlbekannt, Mittlere Sammlung Anm. 121; aber nur Benāres in der Mitte ist ober der Erde geblieben, freilich, bis auf die uralten Badeplätze, zwanzigmal zerstört und verändert. Die Ruinen von Sāketam werden neuerdings, nach einer Angabe im Vāyupurāṇam, nördlich von Allahābād gesucht, etwa 30 km vom Prayāgas entfernt, dem auch von Gotamo genannten Payāgo des Ganges und der Yamunā, Mittlere Sammlung S. 42: eine Entfernung, die mir aber angesichts der alten Größe und Bedeutung des letzteren Ortes viel zu nahe scheint. Vergl. Major VOST im Journal Royal Asiatic Society 1905 p. 437-449 nebst Karte. Auch kann Sāketam von Sāvatthī nur eine Tagereise entfernt gewesen sein, nach jenem ausgezeichneten Hinweis in der Mittleren Sammlung S. 174-175.
465 1 yojanam, Meile, entspricht ungefähr 1 deutschen geographischen Meile = 5000 römischen Schritten zu 5 Fuß, nach den sorgfältigen und überzeugenden Untersuchungen und Berechnungen FLEETS im Journal of the Royal Asiatic Society 1906 p. 1011f. und 1907 p. 645f., wo unser yojanam = 16.000 hatthā = 4,54 englische Meilen bestimmt ist, entgegen der bisher allgemeinen Ansicht, ein yojanam sei gleich zwölf englischen Meilen, ein Maß, das erst in einer späteren Zeit aufgestellt wurde. In unseren Texten ist das yojanam noch rund einer deutschen Meile gleich anzunehmen.
466 Mit S, C etc. Ālakamandā. – Ganz ähnlich sagt noch Kālidāsas: vasatir Alakā nāma yakṣe varāṇām, Meghadūtam 7, der Smṛti entsprechend wie oben. Es ist die himmlische Stadt des Überflusses für Geister vom Range des Wolkenboten gewesen: denn S gibt ahosi an, nicht hoti, als göttliche Vergangenheit, Sage der Vorzeit; vergl. das ebenso bewandte Verhältnis oben S. 242 und Anm. 377. Derselbe Götterkreis um Vessavaṇo den Großen Herrscher ist, echt indisch weitherzig, anderseits auch als Gegenwart dargestellt, so in unserer 18. Rede, so in der 37. der Mittleren Sammlung. Eine von den zahlreichen Felsengrotten am Berge des Aufgangs oder Lichtenstein, Udayagiri, in Orissa, die König Khāravelo im 2. Jahrhundert vor Chr. den Einsiedlern und Jüngern aus den vier Weltgegenden gewidmet hat, in entzückender Lage an den dichtbewaldeten Schluchten und Abhängen der Khaṇḍagiri-Kämme, hat noch immer ihren alten Namen Alakāpuram bewahrt, der hier so viel als Sanssouci bedeutet.
467 Nach dem vedischen Seher Vasiṣṭhas, als ihrem geistigen Ahnherrn, nannten sich die Maller auch Vāseṭṭher oder Vaseṭṭhiden, gleichwie die Sakyer nach Gotamas, einem nicht minder berühmten Seher der Vorzeit, sich auch Gotamiden nannten: und so hatte jedes echte Fürstenhaus seinen eigenen wirklichen Stammbaum auf einen oder den anderen bestimmten geistig höheren Ahnen in ferner Vergangenheit gegründet. – Vergl. Lieder der Mönche Anm. 536, wo für die Sakyer als Ahne auch der Ādigotamide Angirās angegeben ist. In runder Zahl werden meist zehn solcher vedischer Seherahnen als Uradel überliefert, so 13. Rede, Seite 169, an welchem Orte man die Namen und Nachweise findet. Bei den Sakyern stellt sich das Verhältnis, kurz gefaßt, so dar: sie sind sonnenverwandt, ādiccabandhū, von ādityabandhus »Freund, Verwandter des [690] himmlischen Lichtes«, und damit zu Agnis, dem himmlischen Feuer, gehörig: von Agnis aber stammt der vedische Seher Angirās ab, von ihm das Sehergeschlecht der Āngirāsen, dem dann der ṛgvedische Hymnenseher Gotamas entsproßte, einer der berühmtesten, wie der Name im Superlativ schon sagt, wörtlich: der größte Stier, das heißt der vorzüglichste Führer, schlechthin so viel als der Beste, Höchste, Optimus, Maximus; aus Vorliebe für diesen nannten sich die Sakyer Gotamiden, Gotamer, Gotamā, im Saṃskṛt später populär geworden als Gautamās: Die vom Stamme des Gotamas, so zu sagen die Optimaten. Jener Gotamas war nun zugleich dem Sehergeschlecht der Rāhūgaṇās von väterlicher Seite her verwandt: so daß unser Gotamo, als er, noch Fürst, seinen einzigen Sohn Rāhulo nannte, wohl auch daran gedacht haben konnte; obzwar natürlich der nächste Anlaß hierzu in der hochgerühmten leiblichen Abstammung der Sakyer von dem altvedischen Kriegerstamme der Raghuiden gegeben war, s. oben Anm. 98. Rāghulas, der Raghuide, wird im Pāli zu Rāhulo, wie laghu zu lahu. Asoko hat, in Bairāt, den gutturalen Laut überliefert. Dieser historisch-etymologische Nachweis, den ich schon längst in den Bruchstücken der Reden Anm. 335 gegeben habe, ist nun, wie ich soeben zu meiner Freude sehe, auch von JARL CHARPENTIER in Upsala besprochen und angenommen worden, Indogermanische Forschungen Bd. 28, Straßburg 1911, S. 173-178. Einen analogen Superlativ zu gotamo, dem größten Stier, hat Asoko mit gajatamo, dem größten Elefanten, gebildet, auf seiner symbolischen Darstellung der Theragāthā 692-699 an der östlichen Seite des Kālsī-Felsens. Eine neuerliche Untersuchung hat mich überzeugt, daß BÜHLERS Lesung gajatame wirklich die richtige ist, und nicht gajutame: die Kerbe im Stein unter ja ist zu kurz um für u gelten zu können. Man hätte eigentlich den edleren Ausdruck von nāgo, also nāgatamo, nāgatame, erwarten sollen, cf. den mahānāgo der 27. Rede der Mittleren Sammlung; man lernt aber, nach einigem Nachdenken, wiederum nur Asokos feinstes Verständnis bewundern, indem er durch die hier bevorzugte Ableitung von gaj, garj tönen, erschallen, eben unfehlbar sicher Gotamo als besten Verkünder angedeutet hat: unaufdringlich, niemanden verletzend oder auch nur leise ärgernd, Verständigen von selbst verständlich, wie das so Asokos Art immer ist.
468 adutiyo ist richtig, mit S.
469 S wieder richtig chinnapādaṃ viya.
470 avandito ca bhagavā mit S.
471 Dieselbe bündige Zusammenfassung zeigt die Inschrift der Urne, in der, zugleich in kristallener Phiole verwahrt, ein Teil der Aschenreste Gotamos von den nächsten Stammverwandten, den Sakyern von Kapilavatthu, tief am Grunde eines Kuppelmals beigesetzt wurde: eine Inschrift, deren Graphik und Sprachausdruck ebenso nüchtern als vollkommen mit der Zeit und Sitte des obigen Berichts übereinstimmt, entdeckt in dem nach 2400 Jahren ausgegrabenen Kuppelmal oder Thūpo bei Piprāvā, an der Grenze von Nepāl, im Januar 1898; vergl. die Nachweise Mittlere Sammlung Anm. 429 u. 321. Die kusinārischen Maller waren die Reichsnachbarn der Sakyer von Kapilavatthu; daher auch ihre besondere Anteilnahme. Der sakkische Herrensitz, Burg Kapilavatthu, lag noch etwa ein bis zwei Tagemärsche weiter nach Norden hinauf (heute eine sumpfige Wildnis); so weit war Gotamo auf der letzten Wanderung nicht mehr vorgedrungen: ohne Zweifel mit Vorbedacht.
472 Dieser Gedanke wird späterhin im Norden überaus weit und in reicher Fülle und Überfülle schöner, bedeutender Sagen ausgeführt und verarbeitet; vergl. Mahāvastu I p. 55: Kalpāna atasahasraṃ saṃdhāvitvāna ... buddho lokasmiṃ upapanno.
473 labhatu S parassapade. Dann aññāpekho 'va maṃ, und yañ ca sāham puṭṭho.
[691] 474 sabbe 'va pana na abbhaññaṃsu zu lesen; S sabbe pana na abbhaññaṃsu, und udāhu ekacce etc., wie Majjhimanikāyo No. 30.
475 suññā parappavādā samaṇehi aññehi mit S und Mandalay zu lesen; parappavādā = parapravādāt wie häufig. Vergl. TRENCKNERS Majjhimanikāyo p. 534. – Zu den vier Ständen s. vorher die 390. Anm. – Asoko hat vielfach sich ähnlich vernehmen lassen, ganz besonders auf dem 7. und auf dem 12. Felsenedikt; auf dem 7. hat er geradezu an unseren obigen Text wörtlich angeknüpft: te sarvaṃ va kāsaṃti ekadesam va k[ā]saṃti sagt er Girnār Zeile 2, indem er unser sabbe te abbhaññaṃsu udāhu ekacce abbhaññaṃsu trefflich anwendet und mit dem gesamten übrigen, meisterhaft kurzgefaßten Inhalt in Einklang bringt. In der folgenden letzten Zeile ist nicā, mit der dreifach gleichlautenden Variante (außer Girnār) nice, als nicce = nitye zu erklären: cf. die Wiedergabe des Satzes in der Mittleren Sammlung, Anm. 520. Im 12. Felsenedikt sodann ist unsere schwierige Stelle suññā parappavādā samaṇehi aññehi mit tiefem Verständnisse schlicht aufgelöst in parapāsaṃdagarahā va no bhave apakaraṇamhi, wobei Asoko noch die sinnvolle Erläuterung anschließt: lahukā va asa tamhi tamhi prakaraṇe. Es ist der königliche, wohlerfahrene Kommentar zum gotamidischen Text: Ohne Verlangen nach Zank und Streit mit anderen Asketen. Dies konnte freilich erst durch die siamesische Überlieferung, die zugleich mit der barmanischen hier vollkommen übereinstimmt, erschlossen werden. – Ein Hinweis auf unsere Stelle Lieder der Mönche v. 86.
476 Zu padesavattī ist im Divyāvadānam p. 389 die richtige Auflösung angegeben: ye buddhena bhagavatā prade ā adhyuṣitās.
477 Cf. Anm. 201 den Nachweis zur richtigen Textfassung = Bruchstücke der Reden Anm. 5471. Der Text lautet also: yo kho aññatitthiyapubbo imasmiṃ dhammavinaye ākankhati pabbajjam ākankhati upasampadaṃ, so cattāro māse parivasati: catunnaṃ māsānam accayena parivutthaparivāsam āraddhacittā bhikkhū [ākankhamānam] pabbājenti upasampādenti bhikkhubhāvāya; api ca m' ettha puggalavemattatā viditā. Diese hier nach den siamesischen Handschriften treu überlieferte alte Ordensregel ist kürzlich durch die Auffindung wertvoller Fragmente des Saṃskṛt-Kanons, deren wenige Blattreste PELLIOT aus dem 1500jährigen Sand- und Tempelschutt bei Kuchar im östlichen Turkestan glücklich gerettet hat, bestätigt worden, wo die entsprechende Stelle wörtlich übereinstimmt: yat saṃgha caturṇā(ṃ) evaṃnāmno anyatīrthikapūrvakasya catvāro māsāṃ parivāsaṃ dadyāt, caturṇā(ṃ) māsānam atyayāt paryuṣitapari[vāsa]ṃ (ārā)-dhitacittā bhikṣava pravrājayitvā upasampādayeyuḥ: von FINOT mitgeteilt im Journal asiatique, Dez. 1911 p. 622; vergl. zur Topographie etc. M.A. STEIN, Ruins of desert Chatay, London 1912, vol. II p. 375. Die siṇhalesischen Mss haben im obigen Text durchgängig parivutthaparivāsam ausgelassen, obzwar auch sie es in der Parallele des Saṃyuttakanikāyo (vol. II p. 21) richtig überliefern. Dementsprechend ist die Stelle in den Reden des Majjhimanikāyo zu ergänzen, und zwar No. 57 und 75 gegen Ende und No. 73 in der Mitte. Auf die echte Fassung im Saṃyuttakanikāyo hatte bereits TRENCKNER hingewiesen, Majjhimanikāyo vol. I p. 563.
478 Subhaddam paribbājakam mit S.
479 Mit S: Lābhā te āvuso Ānanda, suladdaṃ te āvuso Ānanda, mit C: yo ettha satthari sammukhā antevāsābhisekena abhisitto.
480 Mit S dātabbo. – Channo war ein Streitbold, aus dem Vinayo als ein zorniger Querulant nachweisbar und nicht zu verwechseln mit jenem anderen Channo der Mittleren Sammlung, 144. Rede, der durch Freitod endete, vitam evasit. Die geistliche Strafe soll, wie Cullavaggo XI i.f. berichtet wird, den Störenfried bekehrt haben.
[692] 481 Ganz in diesem Sinne hat später auch Asoko als einzige Strafe für streitsüchtige, auf Zwiespalt bedachte Mönche oder Nonnen bestimmt, daß ihnen weiße Gewänder zuzuteilen seien: womit er, so einfach als sicher, solche Unfriedenstifter aus dem Orden entfernt und zu gewöhnlichen Hausleuten gemacht hat. Denn die weißen Gewänder sind eben, nach unseren Texten, das Kennzeichen der im Hause lebenden Leute, der Bürger, im Gegensatze zu den Bürgern der vier Weltgegenden, den hauslosen fahlgekleideten Ordensjüngern: Asoko hat diese Ausdrucksweise wörtlich aus den Reden übernommen, siehe Mittlere Sammlung, S. 376, auch 528, und oft. Wie es da »weiß gekleidet«, odātavasanā, von den gihī, den Hausleuten, heißt, so hat der König odātāni dusāni, »weiße Gewänder« für jene des Ordens Unwürdigen ausgesetzt und einen anderen Ort als Aufenthalt: das allein war die Strafe. So ist nämlich das Edikt zu er klären, das Asoko von Pāṭaliputtam ausgegeben hat, mit der Weisung an seine Beamten, es aller Orten bei Jüngern wie Anhängern weiterzuverbreiten und stets jeden Sonntag zu verkünden, ein jeder in seinem Bezirk, es pünktlich so nach allen Stadt- und Landgebieten, seiner Bestimmung gemäß, ausgehn zu lassen. Gefunden wurde die Inschrift 1905 bei den Ausgrabungen in Sārnāth, ein vorzüglicher Abklatsch im VIII. Bande der Epigraphia Indica zu S. 168 veröffentlicht; daß aber die weißen Gewänder sich auf jene Angabe der Mittleren Sammlung usw. beziehn, blieb unbemerkt; darauf hat mich DE LORENZO gelegentlich hingewiesen. Natürlich sind jetzt auch die Paralleledikte von Kosambī und Sāñci, Indian Antiquary 1890 p. 126 und Epigraphia Indica II p. 367, genau ebenso zu erklären. Und so haben wir denn nun den Kommentar zum Kommentar Buddhaghosos, Vinayapiṭakam ed. OLDENBERG III p. 312: rājā ... tesaṃ setakāni vatthāni datvā upapabbājesi. Milicia à la malicia, sagte der milde GRACIAN.
482 Mit S natthi imasmim bhikkhusanghe ekabhikkhussa pi. – Den folgenden letzten Ausspruch hat ebenso ANTONIOS als letzten Gruß seinen Jüngern hinterlassen: cf. Ende Anm. 403 den Nachweis.
483 Anuruddho ist spätere Glosse, vergl. S. 290.
484 Sahampati: siehe Mittlere Sammlung Anm. 215, wo der Name entsprechend begründet wird.
485 Mit S yattha etādiso satthā. – Zu yattha, pādādisaṃyoge, cf. yattha me vusitam pure, so in der 18. Rede v. 1, Therīgāthā 197. Mit geradezu prachtvoller philologischer Treue unserem Text oben folgend ist der Spruch in den tibetischen Kanon, vom Saṃskṛt her, übernommen: s. FOUCAUX in den Annales du Musée Guimet, tome VI Paris 1884, p. 381; während er von europäischen Pāli-Forschern immer mehr verunglimpft wurde, vergl. OLDENBERG, Buddha, 5. Aufl. S. 234 und noch einmal, mit dem aus der eigenen Oberlehrerweisheit geschöpften Kommentar kokett empfindelnd, S. 386: wobei nun aber, leider, nur eben so was wie eine Art apokalyptischer Jüngster Tag und Dämmerschein hervorgequält wird, von dem, als völlig unbuddhistisch, ja unindisch, im Text natürlich keine Rede ist. Denn nikkhipissanti ist das Futurum der Nezessität. Dem Verständnis am nächsten war noch TURNOUR gekommen, der erste Übersetzer, im Dezemberheft des Journals of the Asiatic Society of Bengal, Kalkutta 1838, p. 1008, auf Grund einer damals sehr guten Tradition in Kandy.
486 Volkstümlich gewordener Spruch, schon auf den alten Felseninschriften in Swāt, noch wohlbekannt: s. unsere Anm. 563, bei v. 1159 der Lieder der Mönche die identischen Stellen, und RABELAIS' Tempelinschrift, auf »aimant indicque«, Προς τελος αυτων παντα κινειται, Pantagruel V 37, »Toutes choses se meuvent en leur fin.«
[693] 487 Vergl. die Variante hierzu in den Liedern der Mönche v. 905-906, nebst den dort gegebenen Belegen, Parallelen und Ausführungen, namentlich zum Bild von der Lampe, sowie auch Mittlere Sammlung, Anm. 460.
488 Zu diesem Erschauern und Erzittern cf. das Ende von No. 1 unserer Sammlung: »Während aber diese Darlegung stattgefunden hatte, war ein Beben durch das tausendfache Weltall gegangen.« Ein solches Beben der Welt ist demnach geistig aufzufassen; ergriffen, fühlt sie tief das Ungeheure: wie man mit Faust sagen könnte. Es sollte damit nicht mehr und nicht weniger angedeutet sein, als daß der Gedanke des Menschen, d.i. hier die Macht des Vollendeten, über alle Sonnen und Himmel hinausreichen und das Unmögliche möglich machen kann: daher das Erschauern und Erschaudern der ganzen Natur, gleichsam in einer Katharsis. Diese Ansicht entspricht der zarten, feinen, verinnigten Naturanschauung der alten Inder vollkommen; erst spätere Ausleger haben dann, zumal bei den barbarischen Nachbarvölkern im Westen, wie aus so vielem anderen auch hier aus dem ahnenden Erdebeben ein quid pro quo, d.h. ein plumpes Schüttelrüttelbeben gemacht, welch letzteres denn auch richtig wahlverwandt von den christlichen Evangelisten vorgeschoben wurde: ihnen kam es allein auf die rohe, schreckhafte Wirkung der widerwärtigen, gräßlichen Folgeerscheinungen an, während bei unserem Erzittern der Weltseele freilich nicht die leiseste Spur einer derartigen Angabe sich entdecken läßt. Ja das Mahāvastu fügt noch ausdrücklich hinzu, I 207, II 10, daß dabei keinerlei Wesen, ob nun ortwechselnd oder ortbeharrend, wie Pflanzen usw., irgend verstört werde, sie alle nur sanft, heiter, herrlich entzückt und beglückt seien, bei jenen so ganz anders als auf gewöhnliche Weise welterschütternden Ereignissen. In der bildenden Kunst, die ein solches Beben natürlich nicht veranschaulichen kann, hat man dafür die Teilnahme der ganzen belebten Welt zu schildern versucht, namentlich später in China und Japan, wo fein ausgeführte Gemälde die huldigenden Götter, Menschen und Tiere zeigen, alles was da lebt und atmet, kriecht und fliegt, wilde und zahme Wesen, und sie insgesamt zur Bahre des Meisters heranströmen, um ihn noch einmal zu schauen, klar bewußt oder in dunklem Instinkte zu preisen, daß er auch ihnen zum Heil erschienen ist. Weitere Bemerkungen bei DE LORENZO, India e Buddhismo antico, 2a ediz. Bari 1911, p. 92/93. Zuständige Geister mögen noch prüfen, ob hier nicht etwa auch jenes Beben mit erwähnt werden darf, das gegen Ende des vierten Satzes der Neunten Symphonie, nach der bangen, schmerzlich ergreifenden Spannung, bei der Frage »Ahnest du den Schöpfer, Welt? – Über Sternen muß er wohnen«, von einem Staccato pianissimo begleitet bis zum Forte anschwillt und bei der verminderten Dezime, in ein Tremolo-Staccato verebbend, sich verliert: der tiefinnige Schauer, der in dieser Ode an die Freude über alle Himmel hinausgezuckt ist, läßt da, wie mir scheint, mit ganz unvergleichlicher Kraft die schöpferische Beschwichtigung und allversöhnende Auflösung in solchem Erbeben anklingen. – Dagegen sind die oben S. 257 zuerst beigebrachten zwei Erderschütterungen allerdings gewöhnliche postume Beben, ein »unleidlicher Verdruß« von seiten eines gewaltigen Gottes oder polternden Seismos.
489 ye tattha bhikkhū zu lesen: S ye te 'ttha bhikkhū, und wieder richtig chinnapādaṃ viya. – Nullis planctibus defuncta revocantur, sagt SENECA mit gleich kräftiger Anschaulichkeit.
490 Erscheinung, Unterscheidung, sankhāro, von saṃskar = zusammenstellen, ist wörtlich Synthesis, nämlich der Wahrnehmung, saññā, die an sich nur Sinnesempfindung, aber keine Synthesis der Apperzeption gibt: daher ist sankhāro als das vermittelnde Glied zwischen der Wahrnehmung, saññā, und dem Bewußtsein, viññāṇam, [694] schlechterdings die Unterscheidung, und zwar das aus der Wahrnehmung erst hervorgehende Zusammenfassen der Merkmale, ihr Eindruck (cf. sankhāro = vāsanā), der alsbald in Bewußtsein übergeht. Im weiteren Sinne, wie oben, ist dann sankhāro, pl. sankhārā, so viel als Erscheinung überhaupt, das ist jede irgend mögliche Vorstellung eines Objekts für ein Subjekt. Näheres noch in meiner Buddhistischen Anthologie, Leiden 1892, p. XXIII-XXV. [Siehe Band III, Anhang, S. 896-898.]
491 adutiyo mit S, wie oben S. 285. Er wollte keinen Begleiter.
492 Diese Botschaft hat Ānando, nach unserer Zeitrechnung, am Morgen des 14. Oktober 483 v. Chr. den Mallern überbracht: wenn nämlich die sehr wohl möglichen astronomischen Berechnungen zutreffen, die FLEET mit großem Scharfsinn in Gemeinschaft anderer Forscher aufgestellt hat, J.R.A.S. 1909 p. 1-34, namentlich p. 22; das Ereignis selbst hätte demnach in der vollen Mondnacht des 13. Oktober, in der Kārttikī rātrī, stattgefunden. Die Lotusziegel um die Aschenurne, vom Grunde der Kuppelmale bei Niglīva (Letzte Tage1 T. IV), deuten nach der Art Asokos, mit unverkennbar zarter Innigkeit, auf jene Mondnacht zurück, da Kārttikī = Kaumudī, das ist: die volle Mondnacht der Oktoberlotusblüte; nebenbei die schönste des Jahres, vergl. Mittlere Sammlung Seite 883.
493 sattamam pi divasaṃ mit S.
494 Mit S sīsanhātā zu lesen: es waren also snātakās, junge Edelleute, die ausgelernt und soeben die Hauptweihe, das Sakrament der Firmung, oder sachlich zutreffender: die Promotion sub auspiciis empfangen hatten: nach der oben bestätigten altvedischen Anschauung und Sitte daher die allergeeignetsten Personen zu einem so außerordentlichen Amte: cf. Ā valāyanagṛhyasūtram III 9 6 i.f. Sīsanhātā ist natürlich = sasīsanhātā, entsprechend sa iraskaplutās, wie Ā v. I 11 2, oder bei Gobhilas II 1 17 etc., woselbst auch sogleich und mit denselben Worten wie oben bei uns die ungebrauchten Gewänder folgen: noch genauer, als ausdrücklich für den Gefirmten bestimmt, bei Hiraṇyake ī I 3 10, 5 zu finden: āharanty asmā ahate vāsasī, nachdem eben vorher, im dritten Absatze, gesagt worden war, daß von dem strahlenden Glanze des also Gebadeten diese Sonne erst ihr flammendes Feuer erhält und daher das Antlitz des snātakas vor Glanz gleichsam knistert, rebhāyatīva, nach der älteren, besseren Variante bei Āpastambas, Dharm. ed. BÜHLER p. 73. – Die knappen nüchternen Angaben unseres Textes oben besagen also, genauer geprüft, daß jene acht mallischen Edelleute herrlich wie junge Götter anzusehn waren.
495 Mit S bhante Anuro. Vergl. das vedische ābhyudayikam, eine Totenfeier, wobei zuerst den Göttern und Ahnen in Gestalt der Priester zu huldigen ist, zu richtiger Durchführung und rechtem Gelingen: Prayogaratnam p. 43b, nach HILLEBRANDT in BÜHLERS Grundriß III 2 p. 93. VERGIL sagt entsprechend: nihil invitis fas quemquam fidere divis, Aen. II 402.
496 Der Leichenzug durch das nördliche Tor gilt für Tote aus der Kriegerkaste: dies hatten die Maller nicht beachtet, daher sie an diese alte Sitte – die übrigens noch heute eingehalten wird – zu erinnern waren. Der Westen ist dem Priester, der Osten dem Bürger, der Süden dem Bauer bestimmt. Vergl. COLEBROOKE, On the Religious Ceremonies of the Hindus, Miscellaneous Essays 1st ed. I 157. – Die richtige namentliche Überlieferung des Platzes ist uns durch ein Siegel gewährleistet, von dem ein Tonabdruck 1906 bei den Ausgrabungen um Kasiā, eben in unserem Landgebiet oben, gefunden wurde. VOGEL hat im Journal of the Royal Asiatic Society 1907 p. 365f. eine ausgezeichnet gelungene Phototypie davon und zugleich von dem anderen, in der Anm. 449 er wähnten, gegeben und die Inschrift erklärt. Das Siegel ist [695] oval, 5:3 cm; im Mittelfelde sieht man auf einem Scheiterhaufen die Truhe in Form eines umrahmten Rechtecks: von der oberen Kante steigen sieben mächtige Feuergarben empor, während an beiden Seiten des Holzstoßes je eine sitzende Gestalt mit edlen feinen Zügen noch erkennbar ist; darunter steht in Schriftzeichen von etwa 400 n. Chr. rīmakuṭabandhe saṃgha[ḥ], »Die Jüngerschaft am Hochgiebeldamm«. Solche Siegel wurden vielfach als Briefverschluß damals gebraucht und vom Kloster, das also am Giebeldamm zur Erinnerung errichtet worden war, auf diese Weise nach auswärts und so auch nach dem nahen Kasiā gesandt, wo der Abdruck jetzt, mit über 500 anderen, wieder zu Tage kam. FLEETS Meinung, im Bande R.A.S. 1906 p. 160, Makuṭabandhanam sei der Krönungstempel der Maller gewesen, ist unhaltbar, weil in einem Tempel kein Scheiterhaufen verbrannt werden konnte, zumal ein solcher von 55 m Höhe, wie der Kommentar angibt: es muß ein weiter offener Platz gewesen sein, wie dies durch die näheren Angaben unseres Textes, ja schon durch die Kennzeichnung als cetiyam (siehe Anm. 418) sichergestellt ist. Das Siegel beweist, daß der Ort noch etwa 900 Jahre später in lebendigem Andenken war. Auch I-TSING, der bekannte chinesische Forscher, hat ihn Ende des siebenten Jahrhunderts n. Chr. aufgesucht und darüber berichtet. Spätere, ebenda gefundene Siegel, die noch 200 Jahre weiter herabreichen, weisen inschriftlich nur mehr allgemeiner auf die Stätte der Erlöschung hin. Daß übrigens der Orden zu einer Zeit, wo man sich Briefe schrieb und sie mit eleganten Siegeln verschloß, nicht mehr der Schatten von einst war, versteht sich: dem Archäologen ist aber dieser Wechsel der Sitten sehr zustatten gekommen.
497 Der Gedanke, auf solche Weise ein sichtbares Wahrzeichen für das Volk zu errichten, von Ānando hier den Mallern treulich vermeldet, ist später über ganz Indien verwirklicht worden und viele Jahrhunderte in Geltung geblieben. Zu dieser zwar nur äußerlichen, aber nicht ganz zu verachtenden Beglaubigung unserer alten Texte hat der gründliche Kenner der indischen Inschriften, Altertümer und Geschichte, R.G. BHANDARKAR in Pūna, eine klassische Arbeit geliefert, in seinem Peep into the Early History of India, im XX. Bande des Bombay Branch of the Royal Asiatic Society, 1902. Er zieht darin die Summe seiner Forschungen, die er ein langes Leben hindurch in der glücklichsten Weise bewährt sah, und zeigt uns Schritt um Schritt auf Grundlage der numismatischen und epigraphischen Belege und Urkunden, wie Indien von Beginn des zweiten vorchristlichen Jahrhunderts bis zum vierten n. Chr. ein großes allgemein buddhistisches Reich wurde, nachdem ganz Mittelindien, zumal seit Asoko, es schon längst geworden war. Er sagt da p. 386ff.: »During this period it is the religion of Buddha alone that has left prominent traces, and was professed by the majority of the people. The vestiges of the time are Stūpas or hemispherical structures purporting to contain a relic of Buddha or of saints, and monasteries, and temples containing smaller Stūpas or Chaityas. These Stūpas or Chaityas were the objects of worship amongst the Buddhists. And wherever there is a stupendous Stūpa, we find sculptures representing Buddhistic sacred objects, such as the Bodhi or Pippala and other trees under which ākyamuni and the previous Buddhas attained perfection, wheels representing, metaphorically, the Dharmachakra, or wheel of righteousness, which Buddha turned, and so forth. – Now, the remains of Vihāras, Chaityagṛihas, and Stūpas are found in all parts of the country, including Afghanistan.« Er bespricht nun die großartigen Baudenkmale von Barāhat und Sāñci, 3. Jahrh. vor Chr., die Felsentempel im Mahārāṣṭram, 1. Jahrh. vor Chr., die herrlichen Grotten von Kārle, Nāsik – denen man auch die kürzlich von ZUGMAYER [696] entdeckten paar hundert buddhistischen Felsengrotten und -Kammern am Gondrani-Paß, 17 km NW von Bela in Belutschistan, würdig anreihen darf, cf. PETERMANNS Geogr. Mitteilungen 1911 (II) Tafel 12/13 – und kommt dann zum Schlusse: »The period that we have been speaking of has left no trace of a building or sculpture devoted to the use of the Brahmanic religion. Of course, Brahmanism existed, and it was probably, during the period, being developed into the form which it assumed in later times. – But the religion certainly does not occupy a prominent position, and Buddhism was followed by the large mass of the people from princes down to the humble workman. Another peculiarity of the period was the use of the Pāli or the current Prākṛit language in inscriptions. Even the Brahmanic inscription at Nānāghāṭ and those in the south just noticed are composed in this dialect.« Das Ergebnis der Untersuchungen des weitschauenden einheimischen Gelehrten, die RHYS DAVIDS in seinem Buddhist India, London 1903 p. 150, mit Recht strikingly suggestive nennt, ist mir um so erfreulicher als es, sogar mit gleichen Worten, bestätigt, was ich einige Jahre früher schon in der Vorrede zum zweiten Bande der Mittleren Sammlung p. XXXVf. dargelegt hatte, auf anderen Wegen wandernd, mehr im nordöstlichen Indien bekannt, und den Blick bis auf die letzterreichbaren buddhistischen Denkmale einer noch tausend Jahre späteren Zeit gerichtet: so daß nun der Kreis der historischen Betrachtung wohlgeschlossen sich zeigt, immer gemäß der Maxime GOPAL BHANDARKARS »Nothing but dry truth«, und eben also zur »erliuhtunge der inwendigen ougen« geeignet.
498 Näheres über die Nackten Büßer, ājīvikā, in der Mittleren Sammlung Anm. 36, wo vedische und auch griechische Nachweise gegeben sind, Anm. 107, wo sie aus den Inschriften Asokos bestätigt, und Anm. 443, wo sie gar noch von AUGUSTINUS richtig beschrieben werden. Von einem solchen Büßer handelt ganz besonders und am gründlichsten die 8. Rede unserer Sammlung, wo das Gespräch Gotamos mit einem Namensvetter des großen Kassapo überliefert ist. Ob maskarī, wie sich der ājīviko sonst noch nennen soll, wirklich auf Makkhali den bekannten Gosālo zurückreicht, wie DEVADATTA RAMKRISHNA BHANDARKAR meint, scheint mir zweifelhaft; vergl. das Bombayer Journal R.A.S. 1904 p. 403.
499 sattāham mit S.
500 Dieser alte Subhaddo ist von dem früher, gegen Ende des fünften Berichtes, erwähnten Namensvetter wohl zu unterscheiden. Subhaddo = Felix, Makarios, Fortunato, Bonaventura, gern gegebener Name.
501 Mit C upaddutā zu lesen; S upaddūtā. Ist upadrutās.
502 Lies padakkhiṇaṃ katvā bhagavato pāde sirasā vandi. Das pādato vivaritvā ist Glosse.
503 Mit S vandite panāyasmatā.
504 tesañ ca: bāhiran ti, micchāsangītisamphappalāpena veditabbam; Thūpavaṃsapūjāvalippajjamadhu-Zusatz.
505 Zu abbhunnamitvā cf. Anm. 152, wo der Gebrauch des sehr seltenen Wortes auch bei Asoko gezeigt ist.
506 sakkariṃsu garukariṃsu mit S, C etc. – Alle diese Szenen vom Tode des Meisters: das Sterbelager mit den trauernden Göttern und Menschen, die Umhüllung des Leichnams mit den Tuchbinden, die Bestattung in der ehernen Truhe, die huldigenden Maller, die Ankunft Kassapos, die Verbrennung auf dem Scheiterhaufen, die Überführung nach Kusinārā durch das Stadttor, die Ehrenwache bei den Überresten; ferner sodann die Verteilung der Reliquien in acht Urnen, der Abzug der Fürsten und die Errichtung der Kuppelmale: alle diese Vorgänge sind uns in einer Fülle verschiedenartiger [697] künstlerischer Gestaltung und Ausgestaltung auf den Reliefen von den nördlichen Stūpās, zumal aus dem Gebiete um Peschāwar, in zahllosen Darstellungen aus dem ersten Jahrhundert vor Christus noch leidlich erhalten, wenn auch freilich nur in fragmentarischem Zustande. Die besten Phototypien und Erläuterungen hat uns der reichversorgte Forscher und Reisende FOUCHER gegeben, in seinem grundlegenden Werke L'art gréco-bouddhique du Gandhâra, tome 1er, Paris 1905, p. 554 bis 599.
507 S hat richtig Thūlayo erhalten; vergl. die Burg Thūlakoṭṭhitam, Mittlere Sammlung S. 608, im Gebiete der Kurūner.
508 Eine Zweiglinie der Koḷiyer ist noch auf den Votivinschriften der Jainās von Mathurā, aus dem 1. Jahrhundert vor Chr., überliefert; Epigraphia Indica I, 371 bis 397 von BÜHLER veröffentlicht und durch die wertvollen Untersuchungen von LÜDERS im Journal of the Royal Asiatic Society 1911 p. 1081-1089 sichergestellt. Die Stammburg unserer Linie, Rāmagāmo, war am östlichen Ufer der Rohiṇī gelegen, etwa 50 km südöstlich vom Lumbinī-Hain, der Geburtstätte Gotamos, dem heutigen Rummin-deī, wie FLEET auf Grund sorgfältig geprüfter Angaben genau bestimmt hat, Journ. R. As. Soc. 1907 p. 355.
509 Der Veṭhadīpako könnte als Vaiṣṭadvīpakas auf den Vaiṣṭapureyas der ruti zurückweisen. Die tibetische Übersetzung, die, wie oben Anm. 485, unserem Text außerordentlich genau Wort um Wort nachfolgt, hat hier Viṣṇudvīpas: cf. FOUCAUX in den Annales du Musée Guimet, tome VI, Paris 1884, p. 387-388; weiters, nach t. II 1881 p. 290 No. VI, das gesamte Stück. Veṭhadīpako = Viṣṇudvīpas wird ferner noch durch einen jener Siegelfunde bei Kasiā, aus dem 4.-5. Jahrh. n. Chr., bestätigt, wo ein Viṣṇudvīpavihārabhikṣusaṃghaḥ sich zeichnet: vergl. Anm. 496, 2. Absatz. Ja, VOGEL, der Entdecker, ist ein Jahr später so glücklich gewesen, daselbst auch noch ein dazugehöriges Petschaft auszugraben: es ist daher nahezu sicher, daß unser Veṭhadīper Priester an der Stelle des heutigen Kasiā zuhause war, als einer jener weisen und hochmögenden Priester, wie sie oben S. 281 und 284 angegeben; cf. J.R. As. Society 1907 p. 994f., wo Petschaft und Klosterruinen photographiert sind. Ebenda lebte auch Sitikeḍu, vergl. später Anm. 540.
510 Mit S amhāka und bahū janā pasannā zu lesen; cf. Anm. 408 Anf. – Der Name Doṇo, s.v.a. Küfer, Küper, ist keineswegs, wie es wohl scheinen möchte, ein beliebiger, etwa ad hoc erfundener oder später aufgekommener Beiname: der Mann war offenbar einer der angesehnsten und reichsten Nachkommen aus dem Priestergeschlechte der Bhāradvājer, wo ebendieser Name immer dem vornehmsten der Sippe zukam. So nennt sich auch späterhin wieder ein hochmögender Bhāradvājerpriester aus Mathurā auf der Inschrift der von ihm gespendeten steinernen Opfersäule, datiert vom 24. Jahr der Regierung Kaṇiṣkas, d.i. 34 vor Chr., schlechthin Droṇalas, als Abkömmling der Bhāradvājer. Das war damals vollkommen klar, alles weitere wußte man schon. Die Säule mit der Weihinschrift, eine der ersten epigraphischen Urkunden in reinem Saṃskṛt, wurde erst kürzlich, im Juni 1910, am Gestade der Yamunā bei Īsāpur, gerade Mathurā gegenüber, wiedergefunden.
511 Aus dem Fürstengeschlecht der Morier, Saṃskṛt: Mauryās, ist später Candagutto, Candraguptas, der Sandrakottos des MEGASTHENES, hervorgegangen, ein glänzender Imperator, der die griechischen Herrscher aus Indien vertrieb und ein mächtiges einheitliches Reich mit der Hauptstadt Pāṭaliputtam schuf; sein noch berühmterer Enkel ist unser Asoko gewesen. Auch die Morier betrachteten sich als »sonnenverwandt«, zum Sonnengeschlechte gehörig, gleichwie die Sakyer und noch andere [698] Fürsten; vergl. oben S. 284 nebst Anm. 467. Asoko war demnach mit Gotamo auch genealogisch verbunden, nach vedischem Wappen.
512 Dieses Kuppelmal stand auf der Felsenburg bei Rājagaham, dem Giribbajam, und dürfte später zumal von Asoko verehrt worden sein; wie FLEET im Journal Royal Asiatic Society 1907 p. 359-363, gestützt auf chinesische Reiseberichte, vortrefflich nachweist. Da der Islam südlich vom Ganges am schlimmsten gehaust hat, ist uns auf diesem Gebiete keine dergleichen epigraphische Kunde erhalten geblieben, doch Spuren.
513 Von HIUEN-TSIANG besucht: FLEET l.c.p. 358f.; cf. Anm. 515.
514 Bei Piprāvā im Januar 1898 aufgefunden: vergl. oben Anm. 471. Die Inschrift um die kleine Aschenurne, worin sich der Anteil der Sakyer an den Überresten befand, lautet:
iyaṃ salilanidhane budhasa bhagavato (I)
sakiyanaṃ sukiti bhatinaṃ sabhagiṇikanaṃ saputadalanaṃ (II)
Das ist ein Leichenschrein des Erwachten, Erhabenen:
Der Sakyer Stiftung, der Brüder mit Schwestern, mit Kindern und Frauen.
FLEETS wiederholter Versuch, im Journal of the Royal Asiatic Society 1906 und 1907, die Inschrift auf die Familienangehörigen, die sich hier selber ein Denkmal gesetzt hätten, zu beziehn, ist bedauerlich verfehlt, schon darum, weil der klare Wortlaut eine solche Deutung ausschließt, da er ja nicht, wie FLEET getan, willkürlich zerrissen und verstellt werden darf; dann aber, weil die Inder durchaus keinerlei Familiengräber kannten, am allerwenigsten aber ein Kuppelmal dazu verwendet hätten, insofern ein solches Denkmal stets nur einem einzigen großen Manne gewidmet wurde, sei er nun ein Welteroberer oder ein Weltüberwinder gewesen; und endlich noch, aus einem an sich schon augenfälligen Grunde, weil nämlich die spärliche Handvoll Staubreste, die da in Piprāvā vorgefunden wurde, zu dem in unserem Bericht oben angegebenen achten Teil wohl vollkommen paßt, keineswegs jedoch als Leichenrest aus einer Familiengruft von mindestens dreißig Fürsten mit Schwestern, Frauen und Kindern je auch nur entfernt gelten könnte. Die von meinem guten alten Lehrer, dem in Madras leider zu früh verstorbenen PISCHEL, bereits 1902 gegebene Erklärung dieser unserer ältesten epigraphischen Urkunde, in der Zeitschrift der deutschen morgenländischen Gesellschaft Bd. 56 S. 157f., hat hier einmal das Rechte getroffen. FLEET, der sich ganz besonders um die spätere Epigraphik unvergängliche Verdienste erworben, hat eben nur, statt unsere Texte gründlich zu prüfen, seinen mühseligen und wenn auch noch so umfangreichen und weitschweifigen so doch völlig versagenden Apparat gerade hier an tausend Jahre jüngeres taubes Gestein angelegt, wo es denn freilich mit SWIFT heißen muß:
You beat your pate, and fancy wit will come:
Knock as you please, there's nobody at home.
Wie übrigens hier die Inschrift der Sakyer mit iyaṃ beginnt, so hat später Asoko die Reihe seiner vierzehn Felsenedikte mit iyaṃ eröffnet (Girnār, Kālsī). Die Votivurne aus Takha ilā hat aus einem wohlüberlegten sachlich-formalen Grunde, der fein dort zutrifft, ayaṃ in der Mitte: cf. die Tabelle zu T. VII der Letzten Tage, (1. Aufl.)
515 Von FA-HIAN auf seiner Reise um 399-414 gesehn, desgleichen noch von HIUEN-TSIANG um 630-644: cf. FLEET l.c. 350f. und 1906 p. 902. Der Turm, wie die [699] Chinesen das Denkmal nennen, war zwischen Kusinārā und Kapilavatthu gelegen, also ganz oben an der Grenze von Nepāl, bei Rāmagāmo: vergl. vorher Anm. 508. – Zum Vethadīper Priester Anm. 509.
516 Durch HIUEN-TSIANG bestätigt: FLEET l.c. 1907 p. 355-358.
517 Auch dieses Kuppelmal wurde noch beiden chinesischen Reisenden gezeigt, FLEET l.c. 1906 p. 900, 1907 p. 350.
518 bhūtapubban ti zeigt den Schluß des Berichtes an. Der Kommentar fügt noch ein paar Verse hinzu. Vergl. Mittlere Sammlung Anm. 521. – Die prächtige Feuerbestattung auf dem turmhohen kostbar geschmückten Scheiterhaufen, die Beisetzung in der Urne, Errichtung des Grabmals als Wahrzeichen bis zu fernen Geschlechtern war bekanntlich bei den römischen Cäsaren ebenso der Brauch; gleichwie bei ALEXANDER, der in Indien sogar seinen Freunden, dem DEMARATOS, HEPHAISTION und auch dem Asketen KALANOS, die selbe Totenfeier bereitet hatte: und schon die Ilias führt uns zweimal ein solches Schauspiel vor, genau wie bei uns oben, Mitte des vorletzten und Ende des letzten Gesanges, als Erbteil aus der Hünengräber- und Dolmenzeit. Bei weitem das schönste Kuppelmal, das ich gesehn habe, ist der Sāñcithūpo bei Bhilsa, an der südlichen Grenze von Mittelindien, in seiner echten altindischen Kunst heute noch teilweise erhalten, vor allem aber durch die anmutige Lage ausgezeichnet, am Gipfel eines Hügels, mit dem Rundblick über die stille blühende Landschaft, einer Aussicht bis zu den letzten sanften Halden und Gefilden am Horizont, die schimmernden Auen und Wälder ringsum beherrschend: hier merkt man bald, das ist Indien, das große weite Indien, und doch erscheint die Gegend wie wohlbekannt, wie heimatlich vertraut und lieb. Vergl. Mittlere Sammlung, Anm. 206. Unsere Kuppeln und Kirchen sind, wie man längst weiß, eben daher auf dem Wege der altbyzantinischen Kapellen Armeniens, die den buddhistischen Kuppelmalen der Gestalt nach vollkommen gleichen, zu Plan und Aufbau gelangt. Dies hatte bereits der Nestor der Indologie, ALBRECHT WEBER, in einem Vortrag 1856 ausgesprochen, in seinen Indischen Skizzen, Berlin 1857, S. 58. Als jüngster Ausläufer eines Kuppelmals zum Gedenken an den Cakkavattī oder Welteroberer grüßt der Dom von der Seine her, mit den Resten NAPOLEONS,
candidus accenso qua redit orbe dies.
519 Vergl. 2. Rede S. 47 und Lieder der Mönche Anm. 862 zum Kriegerfürsten als vājapeyī.
520 Vergl. Anm. 466. – Ähnlich wird auch Ayodhyā geschildert, die Heimat Rāmas und nächst Benāres altehrwürdigste Stadt der Inder, genau bis zu den einzelnen Angaben entsprechend, mit den zwölf Meilen der Länge, den Strömen von Menschen, dem Überfluß und dem Lärmen von Elefanten, Rossen und Wagen, dem Gesang und Gefiedel usw., im Rāmāyaṇam I 5, dem Abschnitt von der Ayodhyāvarṇanā. Es ist also episches Erbgut: wobei jedoch der Pāli-Kanon dem Rāmāyaṇam gegenüber, wie OLDENBERG aus metrischen Kriterien sehr verständig und überzeugend dargetan hat, die ältere Stufe einnimmt, Gurupūjākaumudī S. 9-12. Die Zeit der Abfassung des Rāmāyaṇam wird in das vierte Jahrhundert vor Chr. gefallen sein, in den Herbst der ersten klassischen Sanskritperiode.
521 Mit S tiporisangā tiporisaṃ nikhātā dvādasa porisā ubbedhena. – Vergl. die ähnliche Schilderung im Kumārasaṃbhavam 7 10.
522 Modelle derartiger Palmen, in mehr oder minder feiner Juwelierarbeit, sieht man, nebst dergleichen Feigenbäumen, Lotusrosen usw., in den Kapellen der Tempel [700] auf Zeilon und in Barma und Siam ornamental gern aufgestellt. In neuerer Zeit ist diese altüberlieferte Königspracht bei Hofe in Siam – wie regelmäßig bei halbzivilisierten Alleinherrschern – einen widerwärtigen Bund mit der europamerikanischen Kitschkultur eingegangen, deren Erzeugnisse trotz alles märchenhaft kostbaren Materials (gediegenes Gold und unschätzbares Edelgestein) dem Verfall der ererbten Sitte und Anmut unrettbar entgegenstürzen. Nach der alten Königschronik, wie sie der Mahāvaṃso (30 Mitte) gibt, hat der Prunk und Hofstaat Duṭṭhagāminis, etwa 350 nach Gotamo, der obigen Schilderung möglichst zu entsprechen gesucht; wie denn Duṭṭhagāmini vor allem als tapferer und weiser Monarch im Süden den indischen Kaiserbegriff treu besonnen verwirklicht hat. Eine gut erhaltene Statue des Königs, der echte Typus »Des großen Herrlichen«, am Ruanwäli Dagoba zu Anurādhapuram, ca. 3 m hoch, im edelsten indischen Stil gearbeitet, schlank, voller Kraft, wirkt durch das Antlitz mit den heiter-mächtigen Zügen noch stärker als ein Rhampsinit, uns näher stehend, verwandt, vertraut.
523 Mit S zu lesen suppaṭitālitassa kusalehi susamannāhatassa. Zur fünfstimmigen Instrumentalmusik der alten Inder und ihrer hohen Ausbildung cf. die Nachweise in den Liedern der Mönche, Anm. 398, namentlich den prächtigen epigraphischen Beleg über die königliche Hofmusik. Die vokale Begabung ist auch heute noch bei den besten Künstlern eine sehr feine und bis zur Vollkommenheit gepflegte, und man hört gelegentlich Meister brāhmanischer Sangesweisen, die einen Stimmumfang von drei Oktaven wie spielend bewältigen. Die wundersamen Gewebe der fugierten Melodien mahnen oft und oft merkwürdig genau an PALESTRINA; vergl. Lieder der Mönche, Vorrede S. 274. Eine unsichtbare (Orchester-) Musik ist in der 14. Rede erwähnt, oben S. 194. Die gleichen Angaben wie bei uns von einer überirdischen Musik, durch das Rauschen im Winde bewegter Juwelenbäume usw. hervorgebracht, finden sich bei den Jainās, im Rāyapaseṇaijjam III 4 1, nach LEUMANNS Bericht und Übersetzung in den Akten des 6. Orientalistenkongresses zu Leiden 1883, 3. Teil, 2. Abschnitt S. 496: und es wird noch recht schön, wenn auch etwas pedantisch hinzugefügt, daß jene Weisen nicht dem Lautenspiel irdischer Barden um Mitternacht – eine bekannte Gepflogenheit – zu vergleichen seien, vielmehr »dem Klange des göttlichen, aus den sieben Tönen gebildeten, mit den acht Feinheiten versehenen, durch keinen der sechs Fehler verunstalteten, elffach verzierten und mit den acht Vorzügen ausgestatteten Spieles der himmlischen Musiker, wenn sie sich im Bhaddasāla- oder Nandana-Haine oder an anderen berühmten Orten zu gemeinsamem Spiele vereinigen.« Über die auf Inschriften und Münzen bezeugte außerordentliche Verehrung der Musik durch Samudraguptas, den wohlbekannten Eroberer und Beherrscher Indiens, und die Verbreitung dieser Kunst siehe Anm. 651. Vergl. noch Anm. 921, Seite 892, eine Äußerung Gotamos über die Musik.
524 suvaṇṇabhingāraṃ gahetvā mit S.
525 Das vedische Vorbild des leuchtenden Rades ist der flammende Feuergeist, Agni-Vai vānaras, der vor König Māthavas von der Sarasvatī aus immer weiter und weiter nach Osten über diese Erde sprühend dahinzog: und allegro con brio, genau wie oben, alsogleich hinterher der König, überall schon von dem Lande Besitz ergreifend, bis er zur Sadānīrā, der Wasserscheide des Videher-Reichs, nördlich vom Ganges, gekommen war, also beinahe ganz Niederindien sich unterworfen hatte, gefolgt von seinem Opferpriester Gotamas Rāhūgaṇas, der sodann den besiegten Barbaren ārische Satzung und Sitte gab. Diese uralte Erzählung des atapathabrāhmaṇam I 4 1, 10-18 hat bekanntlich ALBRECHT WEBER in sei nen Indischen Studien 1849 und wiederum in [701] den Indischen Streifen, Berlin 1868, I S. 11-13 übersetzt und besprochen. Unsere obige Darstellung ist unverkennbar die volkstümliche, weiter entwickelte Sage nach dem vedischen Bericht, wie später noch deutlicher wird, Anm. 537. – Vergl. den »Stern« NAPOLEONS, den auch dieser Kaiserkönig immer, wie er sagte, vor sich gesehn, und dem er siegend nachgefolgt ist, bis zu dessen Verschwinden. Das Motto zu einer solchen Siegeslaufbahn hat Asoko auf seinem vorletzten Felsenedikt, Ṣāhbāzgarhī Zeile 8, herrlich und großartig in den Spruch gefaßt:
vucati teṣa[ṃ], ki[ṃ]ti:
avatrapeyu na ca haṃñeyasu.
Das aber ist vollkommen gleich der römisch bewährten Maxime, Aen. VI 852/53:
pacisque imponere morem;
parcere subiectis et debellare superbos.
Und es ist so zugleich die Königsweisung, die unser HARTMANN gibt, Gregorius v. 82-84:
Den Herren stark, den Armen gut,
Die Deinen sollst du ehren,
Die Fremden zu dir kehren.
526 Entsprechend Asoko, gleich auf seiner ersten Felseninschrift zu Anbeginn: Idha na kiṃci jīvaṃ ārabhitpā prajūhitavyaṃ: »Hier darf kein Lebendiges zum Schlachten ergriffen werden«: usf. auf Erlassen und Edikten über das gesamte indische Festland. Vergl. noch Bruchstücke der Reden, Anm. 303. Recht schön paßt hierher was PLUTARCH über NUMA berichtet, cap. VIII, zumal von dessen pythagoreischer Art der Opfer, ohne Blutvergießen, mit Mehl, Wein usw. – Eine vortreffliche allgemeine Kennzeichnung unserer asokischen und zugleich kostbarsten Urkunden aus der indischen Geschichte hat vor nunmehr bald sechzig Jahren ALBRECHT WEBER so kurz als möglich in folgende Worte zusammengefaßt: »Der Einfluß aber, den der Buddhismus auf Indien geübt hat, ist bei alledem, besonders in der ältern Zeit seiner Reinheit, ein überaus segensreicher gewesen. Wir haben hierfür ein historisches Zeugnis seltener Art aus dem 3. Jahrhundert v. Chr., Felseninschriften nämlich eines buddhistischen Königs Piyadasi [so nannte Asoko sich selbst, s.v.a. Gratianus], die sich mit einzelnen dialektischen Verschiedenheiten gleichlautend im Osten, Nord- und Südwesten [jetzt in jeder Richtung] Indiens vorgefunden haben, und deren Inhalt den einzigen Zweck hat, allen seinen Untertanen Friede, gegenseitige Achtung und Toleranz, liebevolles Betragen gegeneinander und Beobachtung des Gesetzes einzuschärfen; gewiß ein seltener Inhalt auf solchen Monumenten, da fast alle dergleichen Inschriften anderer Könige, von denen die Weltgeschichte sonst noch Kunde hat, nur von blutigem Krieg, von Schlachten und Eroberungen reden.« Der hochverdiente Forscher hat in diesem 1854 gehaltenen Vortrage, trotz des damals noch sehr unzulänglichen Materials, besser als es je wieder einem anderen gelungen ist den Ruhm des Königs verkündet; abgedruckt ist die Stelle in den Indischen Skizzen, Berlin 1857, S. 25. Asoko war, durch das Mittel des Buddhismus, wieder zum vedischen Königsbegriff eingekehrt. Das Dharmasarvasvam, der Inbegriff aller überlieferten Satzung, lautet ja nach der Smṛti:
Paropakāraḥ puṇyāya,
pāpāya parapīḍanam:
[702] Dem andern beistehn läßt Verdienst,
Ihm Schaden antun Schuld aufgehn.
527 Wie Anm. 65, so auch hier mit S anuyantā. – Der Eroberer, dem selbst der Ozean keine Grenze zieht, ist im Gespräch Raṭṭhapālos mit König Koravyo, Mittlere Sammlung S. 621, mit wenigen aber unvergänglichen, klassischen Umrissen gekennzeichnet; wozu Berengar, in der Braut von Messina I 8 Mitte, gleichsam kommentiert:
Denn das Meer ist der Raum der Hoffnung.
528 Vergl. die 14. Rede, oben S. 194.
529 Vergl. Mittlere Sammlung S. 929f.. – Die Glosse bhūtapubbam: akāsi ist hier wie beim Rosse später Zusatz. Eine ungemein flotte Darstellung eines solchen kolossalen Reitelefanten findet man auf einem noch erhaltenen Fresco zu Ajaṇṭā: in GRIFFITHS Prachtwerk auf Foliotafel 71. Er hat eine hellgraue Hautfarbe. In Barma und Siam ist er späterhin zum Weißen Elefanten geworden. Plastisch ist unser Elefant, nebst den anderen sechs Juwelen, am edelsten auf den Reliefen des Kuppelmals von Amarāvatī veranschaulicht: scharf beobachtet, künstlerisch ausgeführt; die näheren Angaben in der Mittleren Sammlung, Anm. 503. Das ideale Maß »sieben Ellen hoch«, gleich viereinhalb Meter, wird heute noch, in seltenen Fällen, erreicht; doch haben solche Tiere jetzt immer eine dunklere Hautfarbe: ein derartiger Ilph, prächtig mit Gold und Purpur geschmückt, und wunderbar treu erzogen, bekleidet dann die Würde eines Staatselefanten bei dem glücklichen Mahārājā, der ihn erworben hat. Als höchstes Maß für einen wilden Waldelefanten, der beobachtet wird wie er in einem tiefen Weiher badend noch Fuß fassen kann, ist im Anguttaranikāyo X Nr. 99 »sieben bis acht Ellen« angegeben, sattaratano vā aṭṭharatano vā, wo oratano zu ratnī Elle gehört, wie schon CHILDERS erkannt hat; bei uns oben ist dafür opatiṭṭho als gleicher Maßstab gewählt um eine Amphibolie mit dem hatthiratanam zu vermeiden.
530 Vergl. das Ende der 65. Rede der Mittleren Sammlung, S. 481. Zur Windesschnelle Atharvavedasaṃhitā VI 92 1.
531 Cf. Mittlere Sammlung, Anm. 419.
532 Vergl. Mittlere Sammlung S. 98 den selben Typus. Unsere letzte Angabe oben, in puncto puncti, mahnt an den alten Spruch »Bien creyo que daquel tiempo non fue fembra de tal exemplo«; sie ist in galanter Umdeutung auch bei SHAKESPEARE zu finden, Cymbeline, gegen Ende:
. . . . . . . . . . . . thy virtuous daughter,
Which we call mollis aer; and mollis aer
We term it mulier; which mulier, I divine,
Is this most constant wife.
533 Er war ein kṣetrajñas, Bodenkenner, wie er wohl in der Chāndogyopaniṣat VIII 3 2 mit verstanden ist, beim Auffinden verborgener Goldschätze. – Faust v. 4893-4896, 4937-4938:
In Bergesadern, Mauergründen,
Ist Gold gemünzt und ungemünzt zu finden,
Und fragt ihr mich, wer es zutage schafft:
Begabten Manns Natur- und Geisteskraft. –
Das alles liegt im Boden still begraben,
Der Boden ist des Kaisers, der soll's haben.
[703] 534 attho 'va mit S. – Das Folgende ist ein wohlbekanntes altes Prestidigitatorenstücklein, suvaṇṇamāyākāravidaṃsanam.
535 Ein solches Juwel von einem Bürger, eine Art indischer FUGGER, der dem Herrscher jederzeit mit seinem Schatz und Reichtum zu Diensten steht, ist uns historisch in dem edlen Jagaḍū überliefert, einem mächtigen Reeder, Großkaufmann und Gildemeister im Reiche des Caulukyer Königs Bhīmas II von Aṇhilvāḍ, Nachkommen Mūlarājās I (cf. Anm. 704). Als der reichste Mann im Lande war er nicht nur seinem König in Krieg und Frieden unentbehrlich geworden, er hat in den Zeiten einer dreijährigen furchtbaren Hungersnot sich auch als der Retter des Volks bewiesen, indem er, ein opferfreudiger Anhänger der Jainās, durch Verteilung seiner aufgestapelten Getreidevorräte weit über die Grenzen des Landes hinaus Hunderttausende vor dem ärgsten Elend und Tode bewahrt hat, sowie er zeitlebens an vielen Orten Teiche, Almosenhäuser, Klöster, Tempel und andere gemeinnützige Anlagen gleichwie ein Monarch ausführen ließ. Bei aller werktätigen Frömmigkeit, ohne Einschränkung auf Heimat, Rasse und Religion, ist er übrigens ein gewandter, feinsinniger Weltmann gewesen. Unser obiger Begriff eines Bürgerjuwels stellt einen solchen Mann dar. Cf. BÜHLER, Sitzungsberichte der kais. Akademie der Wissenschaften, Wien 1892, V. Indian Studies Nr. 1, Einleitung zum Jagaḍūcaritam.
536 Dieser Staatsmann oder Kanzler, pariṇāyako, hat den offiziellen Titel rājyavāhakas oder rājyacintākārī, d.i. Reichsverweser: er ist die erste und wichtigste Person nach dem König, oft der eigentliche Herrscher; BÜHLER nennt ihn Major domus: an Bhīmas II Hofe hatte Lavaṇaprasādas und später Vīradhavalas dieses Amt inne, neben Jagaḍū dem Bürgerjuwel, l.c.p. 30. Vergl. die weitere Teilung, Einteilung und Oberleitung der politischen Geschäfte, nach vedischer Sitte, alsbald bei uns, Anm. 551.
537 Diese hiermit vorgeführten sieben Juwelen gehören schon zum volks- und stammtümlichen altvedischen Sagenbestand, den ich in der Anm. 91 als aus der Ṛksaṃhitā überkommen nachgewiesen habe.
538 rañño pi mit S.
539 anāvaṭam zu lesen. – Dergleichen Teiche, Gärten, Anlagen hat später Asoko in seinem ganzen Reiche geschaffen, wie er selbst z.B. auf dem 7. Säulenedikt berichtet, Delhi-Sivalik (II) Zeile 2-3: »An den Landstraßen auch hab' ich Luftwurzelfeigenbäume einpflanzen lassen, auf daß sie Schatten darbieten Menschen und Tieren; Mangohaine sind angelegt worden, und von Meile zu Meile (7 km, FLEET JRAS 1906 p. 401-417 nimmt irrig aḍha = aṭha und daher 45 km an) dann Teiche mit Brunnen gegraben; ebenso hab' ich Rasthäuser erbaut und viele Trankplätze allerorten eingerichtet, zur Labung für Menschen und Tiere.« Eine treffliche Bestätigung solcher Angaben über die Teiche mit dem milden Wasser, gespeist von den kühl zusprudelnden Brunnen, und die wiederum von einem edlen und tapferen Herrscher gepflegten Gärten, seine Bauten usw. hat für Taxila (heute Ṣāhdheri im Rāwalpindi) und die spätere Zeit, etwa 45 nach Chr., PHILOSTRAT im Leben des APOLLONIOS gegeben, nach sicher bewährten Quellen, worauf CUNNINGHAM im Archaeological Survey of India vol. II p. 113/14 nachdrücklich hingewiesen hat; im Pariser Folio von 1608 im 11. Kapitel des 2. Buches erzählt. Aus beträchtlich weiter herabreichender Epoche sind jetzt noch die Grundmauern eines Bassins und seiner Anlagen von ganz ungeheuerem Umfange beim alten Vikramapuram erhalten: vergl. BÜHLER, Vikramānkadevacaritam p. 44. Die mit erlesenem Geschmack ausgeführten Wasserbauten im alten Anurādhapuram, heute in einer großartig öden Wildnis gelegen, schon seit dem Islam von Dickicht überwuchert, sind allgemein bekannt. Obzwar längst keine künstliche [704] Quellenleitung mehr besteht, trocknet der »Große Weiher« niemals aus. Als ich im Juli 1894 mit dem damaligen Gouverneur des Distrikts, HUGH NEVILL, das mächtige Wasserbecken nach einer über drei Monate anhaltenden Dürre aufsuchte, war es noch immer, von den früheren Regengüssen durch Kanäle gespeist, weit und breit angefüllt, wie ein kleiner See im Urwald anzusehn.
540 Alle diese Vorkehrungen, die Der große Herrliche getroffen, sind bis in die Einzelheiten auf der berühmten Inschrift wiederzufinden, die Uṣavadātas, der Schwiegersohn König Nahapānas, etwa 300 Jahre nach Asoko, an der Felsenwand der Terrasse zur zehnten Grotte bei Nāsik, gegen 250 km nordöstlich von Bombay im Gebirge, nebst ähnlichen in anderen Grotten, hat eingraben lassen: cf. BHAGVĀNLĀL INDRAJIS vorzüglichen Abklatsch, in der Epigraphia Indica 1905 (Nr. 8 Tafel IV) mit Apparat und Kommentar neuerdings von SENART herausgegeben. Uṣavadātas berichtet daselbst, unsere obige Aufzählung, die ihm wahrscheinlich bekannt war, noch weit übertreffend, von folgenden Gaben und Stiftungen: dreimalhunderttausend Rinder, tägliche Speisung von hunderttausend Brāhmanen jahraus jahrein, Schenkung des Einkommens aus sechzehn Dörfern an dieselben, Verteilung von ungemünztem Gold (suvarṇadānam) und zweiunddreißigtausend Geldstücken (1 nāḷīgero = 1 Groschen) an bestimmte Lehrstätten und Genossenschaften, ferner die Errichtung und Anlage je einzeln namhaft gemachter Tempel, Badeplätze, Gasthöfe, Herbergen, Rasthäuser, sowie von Hainen, Teichen, Brunnen, Tränken, Flußüberfuhren, und, als ein der Lehre Ergebener, einer Einsiedelei für Asketen am Govardhanafels im Trira migebirge, ebendieser Grotte von Nāsik, mit einer Quellenleitung versehn, samt jährlicher Beisteuer einer Rente zum nötigen Unterhalt für die jeweiligen Mönche aus den vier Weltgegenden. Den Priestern aber, den Brāhmanen, hatte Uṣavadātas noch außerdem acht Hochzeiten ausgerichtet, einem jeden die Gattin zugeführt, an der altehrwürdigen Wallfahrtstätte, dem Badeplatz von Prabhāsam. Der Schwiegersohn Nahapānas, der übrigens ein tapferer, erfolgreicher Feldherr war, wie die Inschrift des weiteren zeigt, ist also wirklich so liebreich wie nur denkbar bis ins einzelne herab unserer obigen mehr allgemeinen Weisung nachgekommen, als Erbe und Vollstrecker vedischer Sitte in buddhistisch veredelter Überlieferung. Bei so rührender Vorsorge, o wie gern alle und jeden möglichst nach Wunsch zu erfreuen – »Unser Schuldbuch sei vernichtet, ausgesöhnt die ganze Welt« – wird es ihm zusamt seinem Vorbild, Dem großen Herrlichen, zuweilen wohl nicht anders ergangen sein als seinem Zeitgenossen, dem geistesverwandten und noch viel mächtigeren Herrscher, der auf die Vorstellung seiner Vertrauten, er verspräche mehr als er halten könne, sich nur durch die unsterbliche Antwort entschuldigen mochte, es dürfe niemand traurig von ihm fortgehn: VESPASIAN, bei SUETON. – Das Bereithalten von Korn für den Bedarfsfall ist uns schon auf einer der ältesten bisher bekannten Inschriften überliefert, in einer Fassung, die mit der oben gegebenen Darstellung prächtig übereinstimmt. Es ist dies die berühmte kleine Kupfertafel, die vor ungefähr 40 Jahren gelegentlich der Grundaushebung eines Bauwerks im Schutte bei Sohgaurā, am rechten Ufer der Raptī, etwa 30 km südsüdöstlich von Gorakhpur, gefunden wurde, und deren Schriftzeichen sowie ganze Ausdrucksweise bis in das 4. vorchristliche Jahrhundert zurückweisen. Um sie zu entziffern haben sich BÜHLER und FLEET in letzter Zeit höchst verdienstvoll bemüht, doch ist sie, so kurz auch der Text ist, bisher noch recht unverstanden geblieben. Die Inschrift lautet so: Savatiyana-mahamagana-sasane Manava-Sitikeḍu-silimate: Usagame va ete duve koṭhagalani ti, yava-nimathula ca cu medama-bhalakana vala kayiyati, atiyāyikaya no gahitavaya. Hier ist nun neu zu erklären: Savatiyana = svavṛtyānāṃ, cf. Hathigumphā-Inschrift [705] I Zeile 2 Ende ovatiye, auch Pāṇinis III 1 110; mahamagana = mahāmārgānaṃ, ein Titel und Amt der »Oberwegener«, genau wie bei mahāmārgapatiḥ, mārgapaḥ etc.; Sitikeḍu (oḍu ganz klar) = Sitikeḷu, itikrīḍuḥ, okrīḍaḥ, dieser Mānaver war offenbar ein reicher hochmögender Priester, wie etwa jener Veṭhadīper Priester in unserer 16. Rede, oben S. 299, der Name wird zu vityādi gehören, wie der gleichfalls hochwürdige, nach der ruti gern und oft gegebene vetaketuḥ, der nach dem atapathabrāhmaṇam gerade hier, im Gebiet um Gorakhpur, recht eigentlich heimisch war; yava = yava; nimathula = nimanthu, nir + manthu, mantha, nach oyaṇamaṃthu etc., das bei PISCHEL, Grammatik der Prakrit-Sprachen § 105, fünfmal belegt ist, allgemein bekannt als Gerstenmehl, mit la als Suffix; cu wie stets so auf den Edikten Asokos = tu; medama von mid medyati, nach medurādi, dicht, dick, grob; vala = vārā, vārāya. Diese schlicht entsprechende und philologisch ebenso einfache als durchaus zureichende Behandlung des Textes ergibt, wörtlich sicher, folgenden Inhalt: »Den zuständigen Wegemeistern als Weisung vom Mānaver Sitikeḍu, dem hochwürdigen: gerade bei Usagāmo stehn diese zwei Vorratspeicher, und zwar mit Gerste, fein gerieben sowohl als grobkörnig, scheffelweise zur Auswahl bereit, je nach Bedarf, aber nicht nach Belieben.« Die ungeheuerlichen Kunststücke, die man bisher bei der Erklärung versucht hat, fallen haltlos zusammen, im Lichte unseres nüchternen Textes: mathula z.B. darf nun nicht mehr, wie BÜHLER vermeinte, als irgendein mādhuryam betrachtet werden, geschweige gar nach FLEET als die über 700 km weit entfernte Stadt Mathurā; wie denn natürlich sämtliche von letzterem Forscher so gewaltsam herbeigezogenen Städtenamen mit der Inschrift auch nicht im mindesten zusammenhängen, usw. Die Embleme, die am Kopfe des Kupfertäfelchens gebosselt sind, bedeuten nämlich nichts weniger als die Wappen jener ersonnenen Städte: es sind zwei Bäume und zwei Scheunen, in der Mitte ein caityam von Korngefäßen nebst einem Maßlöffel, die da sauber ausgegossen sind und nur die Örtlichkeit der Vorratspeicher und diese selbst anzeigen; wobei der Maßlöffel natürlich nicht etwa als Wappen der stolzen Kriegerstadt Mathurā, wie FLEET meint, gelten kann, sondern nur die Austeilung des Korns versinnbildlicht. Doch ist ein wirkliches Wappen allerdings auch noch mit angebracht, oberhalb der aufgeschichteten Kornkufen, die übrigens zugleich, wie auf Münzen, ganz allgemein einen Stapelplatz anzeigen. Es ist dies das altbekannte symbolische Nandipadam, die Fußspur des Stiers, hier aber weniger auf ivas bezogen, ob schon auch diese Deutung sehr wohl weiterhin auf den Stifter Sitikeḍu mit zurückweisen mag, als vielmehr eben zunächst den Ort der Kornverteilung bezeichnend, den die Inschrift genau angegeben hat, nämlich Usagame, Usagāmo, Vṛṣagrāmas, d.i. Ochsendorf. Bei näherer, mehr gesicherter und gesäuberter Betrachtung erweist sich demnach die kleine Inschrift des Kupfertäfelchens von Sohgaurā, durch unseren obigen Bericht über die Gepflogenheiten Des großen Herrlichen bestens erläutert, als vollkommen ihren Zeiten und Sitten entsprechend, die vertrackten Verknotungen lösen sich ungezwungen auf, und man braucht kaum so weit zu gehn wie FLEET, der seine Untersuchung, Journal of the Royal Asiatic Society 1907 p. 509-532, mit einem fast verzweifelnden Scherze abschließt, indem er launig bemerkt: der Verfasser dieser Gedenktafel scheine beinahe, wie der Verfasser der Inschrift auf der Urne von Piprāvā, es darauf abgesehn zu haben, von einer Art Vorahnung getrieben, ein Rätsel zusammenzusetzen um den Scharfsinn der Epigraphiker unserer Zeiten auf die Probe zu stellen. Vergl. oben Anm. 514.
541 ābhataṃ richtig mit S, auch C.
542 māpeyyāma mit S.
543 Vissakammo war erster himmlischer Gipfelsteinmetz und Wolkendombaumeister [706] am Hofe der Dreiunddreißig: der hochberühmte Vi vakarmā, Omnifex, der Ṛcas X 81f., genannt Herr der Weltgegenden, di āṃ patiḥ, Dominus in partibus, wie Kāṭhakasaṃhitā 39 4, endlich purānisches Factotum wie oben bei uns und noch heute in seinem wundervollen granitenen Felsenkuppelpalast bei Elurā.
Stein und Metall zum Palast des Kaiserkönigs war von den Untertanen gespendet, der Bau selbst aber von unserem göttlichen Architekten und seinen Werkmeistern ausgeführt worden. Nach dem Vorbild ebendieser treuvedisch verbündeten Gesellschaft mit beschränkter Haftung und Herrlichkeit hat man später die Bauten und Denkmale Asokos gleicherweise als gemeinsame Schöpfung irdischer und himmlischer Kraft angesehn; wie ja auch so noch elf und mehr Jahrhunderte nach Asoko die Errichtung des nördlich gegenüber dem Boro-Budur vielleicht großartigsten Bauwerks von ganz Asien, des übergotisch in stalagmitischen Orgeln und Kuppeln emporgewölbten Wahrzeichenpalastes von Angkor-Wat in Kambodscha, angestaunt wurde, mit seiner 1047 × 827 Quadratmeter breiten Terrassenfront usw., dessen steinerne Riesenpracht heute noch, wie lichtwiderprallende Wolkengebilde, die Augen blendend dasteht, dessen Schöpfer aber auch nur als Göttersohn, wie unser Vissakammo, und nicht anders bekannt ist. Abbildungen in FOURNEREAUS Folioband, Paris 1890. HAVELL hat in seinem Werk Indian Sculpture and Painting, London 1908, Seite 77 u. 91f. einige hierhergehörige vielsagende Bezeugnisse alter Pilgerbesucher beigebracht. Auch findet man da, Kapitel VI S. 110-131, eine Auswahl, 11 Stück, der Reliefe vom Boro-Budur mit als Probe gegeben, nach einer Anzahl im Jahre 1872 von J. VAN KINSBERGEN für die Batavische Gesellschaft für Kunst und Wissenschaft besorgten vorzüglichen Aufnahmen. Als letzte bedeutende Entwicklung ist hier endlich noch die monumentale buddhistische Toreutik in China und Japan, in gebührendem Abstand, anzuschließen, mit dem Gipfel dieser Kunst als Dai-Butsu von Kamakura.
544 bhaddan tāva ti zu lesen.
545 Die kostbare Palme vor der Halle erinnert an den berühmten Ölbaum im Gemach des Odysseus auf Ithaka, 23 190-200. Beidemal ist es ein Wahrzeichen uralter Verehrung des Puruṣas oder der Weltesche, späterhin zugleich als Freund Hain erkannt und begrüßt. – Solche Palmen, echte und künstliche, sind auch heute noch beliebte Zier am hohen luftigen Söllergarten der Mahārājā-Kastelle. Aus alter Zeit sind die Reste, ein ganzer Wald von prachtvollen Steinpfeilern, eines solchen Bauwerks wie es Der große Herrliche hatte errichten lassen, bei Anurādhapuram zu sehn, die Trümmer des Lohapāsādo: einst einer Burg mit neun Stockwerken, immer erstaunlicher aufgeführt und ausgestattet, zu je hundert Gemächern, von Duṭṭhagāmini mit verschwenderischer Pracht vollendet. Vergl. Mahāvaṃso, 27. Abschnitt.
546 Zu duddikkho, musati cakkhūni cf. Mahābhāratam II ν. 2009 (= Ind. Sprüche2 2971) muṣṇāti cakṣus teja ivāpatat. Es ist mit den barm. und siam. Mss sicher duddikkho = durdṛkṣas zu lesen.
547 Vergl. Mittlere Sammlung, Ende der 46. Rede, wo das Bild ursprünglich erscheint. Es ist später auf Inschriften zum beliebten birudam oder Epitheton ornans der Könige geworden, wobei auch gelegentlich der Mond für die Sonne steht: wenn nämlich das Herrscherhaus seine mythische Abstammung von jenem herleitet. Der Wortlaut ist in beiden Fällen gleich und zwar wie oben bei uns; so z.B. noch auf einer der etwa tausend Jahre jüngeren Kupferplatten aus Gujarāt, Ende des 7. Jahrhunderts nach Chr., wo die Dorf- und Landschenkung eines Sendraker Königs an einen Yajurvedenpriester aus dem Bhāradvājer Geschlecht beurkundet wird, und dem Herrscher neben den anderen bekannten Macht- und Ruhmestiteln zunächst dieser zukommt, [707] daß wie im Herbste nach Vertreibung der wasserschwangeren Wolken und Nebeldünste der Mond hoch am Himmel aufgeht, in immer strahlenderer Pracht auch der Ruhm des Königs sich weiter und breiter so erstreckt: vyapagatasajalajalajaladharapaṭalavyomatalagata aradindukiraṇadha-
valataraya o [visānala] vitāno, Zeile 10/11 der 1. Platte, nach BÜHLERS Ausgabe in den Sitzungsberichten der phil.-hist. Klasse der kais. Akademie der Wissenschaften zu Wien, 114. Bd. 2. Heft, Jahrgang 1887, S. 223. Für ovisānalao, das BÜHLER tilgen wollte, wird wahrscheinlich – die Zeichen haben durch Oxydierung teilweise gelitten – ovistāralao zu lesen sein, oder bloß ovistārao, wie gewöhnlich.
548 Der König war also der Weisung des Prajāpatis nachgekommen wie sie das 2. Stück des 5. Teils der Bṛhadāraṇyakopaniṣat in einer sinnigen Legende vorträgt, nach welcher der Herr der Lebendigen seinen Kindern, den ihm dienenden Göttern, Menschen und Riesen, zu Ende der Lehrzeit ihre Bitte um ein letztes Merkwort je mit der Silbe da, da, da beantwortet hatte, was diese denn auch, je nach ihrer Art, sogleich zu verstehn vermochten; woher man noch heute den himmlischen Widerhall, wann der Donner da-da-da nachdröhnen läßt, ebenso vernehmen kann, den Menschen zu Geben, dānam, Gedulden, damo, und dayā, Schonen und Verzichten ermahnend: denn der Mensch soll als Gott Selbstbeherrschung, Geduld üben, als Mensch Gabe geben, als Riese Schonung und Milde walten lassen. So war jener König, Der große Herrliche, der vedischen Weisung gern nachgefolgt. Sein Beispiel lehrte daran glauben. Unermüdet das Nützliche, Rechte schaffend war er hier
ein Vorbild
Jener geahneten Wesen.
Er erinnert an König Nimi und dessen übergöttlichen Humor, Mittlere Sammlung S. 628: durchaus nichts sein zu wollen als omnis curae casusque levamen.
549 Eine mächtige vedische Vorstufe, bei Āpastambas, zu diesen vier brahmavihārā oder heiligen Warten findet man in der Mittleren Sammlung Anm. 54 nachgewiesen. Vergl. sodann auch die wichtigen Bemerkungen nach ROBERT L'ORANGE, Anm. 195. – Zu brahma- »heilig« = »vollkommen« parama- cf. Mittlere Sammlung Anm. 343 brahmanirvāṇam = paramanirvāṇam »die vollkommene Erlöschung«, ein Begriff, der in solcher Fassung lange nach Gotamo erst in die Smṛti übergegangen ist, Bhagavadgītā Ende der zweiten Andacht, oder als brahmanirvāṇasamādhiḥ »Einkehr in vollkommene Erlöschung« im Bhāgavatapurāṇam IV 6 39. Auch für die viel spätere Zeit der Tantrasophie gilt das selbe: daher denn FOUCHER die vier brahmavihārā dort ebenfalls zutreffend als »états parfaits« wiedergibt, p. 9 seiner ausgezeichneten Etude sur l'iconographie bouddhique de l'Inde d'après des textes inédits, Paris 1905. Die Smṛti hat hier, wie häufig, nicht etwa an die alten Dharmasūtren, die längst obsolet geworden waren, sondern an den lebendigen Buddhismus ihrer Zeit angeknüpft, und alle Arten von Gnostikern haben sich rings herum angeschlossen. Letztere haben den Begriff dann natürlich theosophisch gedeutet. Bei uns hat JAKOB BÖHME die vier brahmavihārā wundervoll bildsam erkannt: er nennt sie ›Gottes vier Elemente‹, Liebe, Sanftmut, Barmherzigkeit, Geduld, am Ende seiner Schrift Sex puncta theosophica, Werke ed. 1846, 6. Band S. 395: da ist Liebe  mettā, Sanftmut
mettā, Sanftmut  muditā, Barmherzigkeit
muditā, Barmherzigkeit  karuṇā, Geduld
karuṇā, Geduld  upekhā.
upekhā.
550 Subhaddā mit S, C etc., s.v.a. Felicitas, Makaria, vergl. oben Anm. 500. Von den Jainās wird überliefert, daß die vornehmste Gattin König Ajātasattus gleichfalls Subhaddā geheißen habe; vielleicht einer solchen Legende zuliebe. Cf. Aupapātikasūtram [708] § 40, passim. Der Name scheint aber mehr allgemeiner Titel der Hauptkönigin zu sein, ihr offizieller Beiname: denn als Rufname jener Obergemahlin Ajātasattus ist l.c. § 12 Dhāriṇī angegeben. So wird auch der Name der in der Smṛti oft gepriesenen Schwester Kṛṣṇas, der Gattin König Arjunas, zu erklären sein; wie dies übrigens durch die Deutung Subhadrā ca mahābhāgā, im Bhāgavatapurāṇam IX 24 54, wirklich geschieht.
551 Der König hat, nach Manus VII 121, in jeder seiner Residenzen, Städte, Burgen, kurz an jedem größeren Orte, nagare nagare, einen Statthalter einzusetzen, den er mit der obersten politischen (nicht militärischen) Gewalt und mit fürstlichem Reichtum ausstattet, und der als sarvārthacintakas, d.i. Gemeinwohlverweser, den Herrscher zu vertreten und ihm stets zuverlässig erprobten Bericht nach Hofe zu erstatten hat. Genau so hat es auch Asoko gehalten: siehe Anm. 380, wo schon aus der Zeit vor Asoko unsere obige Teilung der höchsten Zivil- und höchsten Militärgewalt angezeigt ist. Die erstere Stelle vertritt heute [1912], im englischen Indien, wiederum ganz ebenso an jedem größeren Orte der Government-Agent: immer ein völlig vertrauenswürdiger, umsichtiger, vornehm gebildeter Staatsmann, mit einem fürstlichen Jahreseinkommen, wie es ein solches Amt erfordert. Diesem Civil Service folgt der Generalstab an zweiter Stelle, subordiniert wie oben, als bloß ausführendes Organ, und zwar im besten gegenseitigen Einvernehmen.
552 Jede, der Annahme nach, mit je einem erlesenen Gericht, besonders zubereitet: denn die indische Küche und gar Hofküche war, wie noch heute, nicht wenig erfinderisch im Sieden, Rühren, Quirlen und Schmoren von Brühen, Tunken, Würzen, Gemüsen als Zukost zu Reis und Grütze, bei Behandlung mannigfacher Milchspeisen, bei Pasteten, Klößen, Musbrei, Kuchen, Fladen, Zuckerwerk, eingemachtem Honigzeug, bei geröstetem, gebackenem, gesüßtem, gesäuertem, gepfeffertem Kernobst und den zahllosen Nüssen und Fruchtsorten unter, auf und über der Erde; von den selteneren und mehr gelegentlichen Fleischbraten, Vogelsuppen und -sulzen bei Opfer und bei Jagd, sowie von den Fischen, Muscheln, Krabben usw. für die niederen Stände nicht zu reden. Reis aber, körnig, blendend weiß gekocht, war und ist, mit seiner Tunke aus zumeist dreizehn Gewürzen, die tägliche Nahrung wie unser tägliches Brot, in Palast und Hütte, morgens und abends. Die Tausende von Schüsseln – 84000 ist die indische Zahl für »unendlich viel«, μυριοι – gehören für die Feinschmecker, zumal die Herren Hofpriester und -Schranzen, die wie vor alters in der Komödie, bei Kālidāsas usw., auch in der lebendigen Gegenwart üppig gedeihen; wobei natürlich das geistige Bedürfnis nach süffigen, kräftig gegorenen und gebrannten Wässern als Zugabe keineswegs zu kurz kommt: vergl. oben Anm. 294. Diese Fülle überfeinerter Gaumenkultur reicht freilich bei weitem nicht an die lukullische Tafel heran, und zu so albernen Ausschweifungen, wie sie das Gastmahl des Trimalchio zeigt, ist es in Indien nie gekommen.
553 Die Jahrhunderte jener Äonen der Vorzeit entsprechen etwa den Tagen unserer späteren Weltperioden, analog den Anschauungen der 14. Rede. Vergl. Mittlere Sammlung, Anm. 200. Man kann hier einen Anschluß an das Mahāyānam beobachten.
554 Die gelbe Farbe, pīto, ist bei Gewändern Ausdruck einer festlichen, freudigen Stimmung: wohl zu unterscheiden von dem fahlen, erdfarbenen Kleide des Mönchs, das somit eben möglichst unscheinbar, unauffällig sein sollte. Der buddhistische Klerus hat dies längst außeracht gelassen und wählt mit Vorliebe jenes pīto, zitronengelb. Einer der gelehrten Oberen vom Vidyodayapariveṇa in Kolombo, von dem ich mir allmorgendlich während einer erquickenden Stunde im Garten Kommentare erklären ließ, deutete beim Abschied an, daß er gern solch eine neue zitronengelbe Seidentoga [709] entgegennehmen würde. Anderseits ist auch orange recht beliebt. Aber das ursprüngliche fahle, indisch erdfarbene Rostbraun, kāsāyo, eine trübe Teefarbe, sieht man mehr auf dem Lande, bei minder gelehrten als besser erfahrenen Jüngern. Eben so wird auf dem indischen Festland auch heute noch von den Jainās der strengen Observanz nur das erdfahle Wams, kaṣāyavastram, getragen. Vergl. Indian Antiquary 1903 p. 460; sodann auch oben, Anm. 393 gegen Ende.
555 Ebenso wie vorher mit S paṭikatthatāni; ein derartiger Batist noch Mittlere Sammlung 637f., auch weißes Gewebe genannt. Vergl. den Seidenbatist oder seidenartigen Batist aus Benāres in unserer 16. Rede, Anm. 441. Die Gilde dieser Batist- und Seidenweber stand noch viel später in guten Verhältnissen und hohem Ansehn, wie das inschriftliche Preislied zu Ehren des von ihr gestifteten Sonnentempels in Mandasor, aus dem 5. Jahrhundert nach Chr., es wunderschön zeigt, v. 4.-22. Mehr in BÜHLERS ausgezeichneter Abhandlung über die indischen Inschriften usw. in den Sitzungsberichten der kais. Akad. der Wissensch. zu Wien, phil.-hist. Kl. Bd. 122 (1890), No. 11 S. 9, 21 u. 93.
556 Die Königin nennt sich selbst nicht bei Namen, ähnlich wie der oberste Hofpriester in der 5. Rede, S. 96.
557 S kathañ ca hi taṃ.
558 Vergl. den Merkspruch Govindos, in der 19. Rede, 2. Hälfte, Mitte. Ebenso lautet der Stempel eines der Sieben Weisen, PERIANDERS: Θνητα φρονει. Ähnlich auch BYRONS Abweisung der tröstenden Worte und Weibertränen, die feig im Tode machen, und die Summe seiner »Euthanasia«:
Then lonely be my latest hour,
Without regret, without a groan.
559 Vergl. Anm. 549; so auch die 83. Rede der Mittleren Sammlung S. 624, wo noch der Kronprinz auftritt. Mit unserem obigen Absatz stimmt der Bericht des Königs Khāravelo, um 160 vor Chr., stellenweise wörtlich überein. Auf seiner Felseninschrift in der Hathigumphā-Grotte auf dem Udayagiri oder Lichtenstein, ein paar Stunden nordwestlich von Bhuvaneṣvar an den waldigen Abhängen der Khaṇḍagiri-Gruppe, Orissa, hat dieser mächtige Beherrscher des Kālinger Reiches von seinem Leben Rechenschaft abgelegt. Nach dem eröffnenden Gruße an die Heiligen und alle Vollendeten sagt er von sich, daß er fünfzehn Jahre die Spiele der Jugend gespielt habe. kumārakīḍ[i]kā kīḍitā (kumārakīḷikaṃ kīḷi im Text oben bei uns), späterhin neun Jahre Kronprinz gewesen sei, yovarājaṃ pasāsitaṃ (entsprechend unserem oparajjaṃ kāresi), dann im erreichten vierundzwanzigsten Lebensjahre zur Königsherrschaft geweiht wurde, seine weitere Manneszeit nunmehr in Siegen der Milde und der Gerechtigkeit zu verbringen; jetzt folgen die Angaben, was er Jahr um Jahr für öffentliche Bauten und Anstalten zum Wohle des Volkes geschaffen, Arbeiten, Schenkungen, Stiftungen usw. eingesetzt, Steuern erlassen habe, wie er die Künste und allen voran die Musik in seiner Hauptstadt gepflegt, was für Kämpfe, Kriege und Siege von ihm durchgeführt wurden, bis er seine Elefanten das Wasser des Ganges habe trinken lassen, und wie er alsdann die Kenner, die Weisen und Asketen aller Gegenden zu sich berufen: so gelangt er bis zum dreizehnten Jahr seiner Regierung und bekennt sich endlich am Schlusse der Inschrift als ein bhikhurājā, Schützer der Mönche, und überdies noch, ganz wie Asoko ein Jahrhundert früher auf dem 12. Felsenedikt, nach dem Vorbild unseres Großen Herrlichen, als savapāsaṃḍapūjako, d.i. Verehrer aller Religionen. Eine vortreffliche Ausgabe der Inschrift mit Faksimile, Kommentar etc. verdanken wir [710] BHAGVĀNLĀL INDRAJI, Leiden 1885, in den Akten des Sechsten Orientalistenkongresses, S. 135/177. – Das vorangehende Gleichnis von der gesegneten Mahlzeit deutet auf die Unio mystica oder göttliche Verdauung und Transsubstantiation beim vedischen Opferschmaus und Somatrank, besonders bei der hochheilig geltenden Agniṣṭomafeier. Cf. HILLEBRANDTS Darstellung nach Āpastambas in BÜHLERS Grundriß III 2 § 68, sowie LEOPOLD VON SCHRÖDERS treffende Bemerkungen hierzu, in dessen »Vollendung des arischen Mysteriums« etc. S. 126, wo er jenes vedische Opfermahl bespricht und dann sagt: »Die mystische Communio bei der Opferfeier aber vereinigt den Menschen, bezw. den Priester schon hier auf Erden mit der hehren himmlischen Lichtgottheit« usw. Mit feinem Hinweis auf solche königspriesterliche Sitte und Anschauung aus alter Ahnenzeit wird also oben der Übergang Des großen Herrlichen auf gute Fährte, in heilige Welt, bildlich angedeutet; wobei jedoch, wie regelmäßig sonst, das Gleichnis auch zunächst an sich, bloß nach außen betrachtet, vollgültig besteht. Der Sinn einer solchen gleichnisweisen Verdauung, Wandlung, Umartung zu seligem Gedeihen ist bei uns von HAMANN, aber nicht nach dem kirchlichen Hostienrezept, richtig erkannt und aufgezeigt worden, mit dem Spruche, der seine Sibyllinischen Blätter abschließt: »Zum Himmelreich gehört kein Salto mortale. Es ist gleich einem Senfkorn, einem Sauerteige, einem verborgenen Schatze im Acker, einem Kaufmanne, der köstliche Perlen suchte und eine gute fand – το παν Αυτος«: Ausg. v. 1819, 2. Buch No. 227.
560 Mit S khattiyāyinī vā vessāyinī vā: vergl. die khattiyī vā vessī vā, Fürstin oder Bürgermädchen, oben S. 137 und 171. Der König hatte demnach, getreu der vedischen Sitte, eine Verbindung mit einem Weib aus dem Priesterstande oder aus dem Dienerstande – von Pariatöchtern zu geschweigen – als nach beiden Seiten unzukömmlich gemieden, genau wie es MANUS bestimmt III 12, 14: Savarṇāgre dvijātīnāṃ' pra astā dārakarmaṇi, kāmatas tu pravṛttānām imāḥ syuḥ krama o varāḥ, Na brāhmaṇakṣattriyayor āpadyapi hi tiṣṭhatoḥ, kasṃim cid api vṛttānte ūdrā bhāryopadi yate. Eben darauf also ist oben angespielt.
561 yato tena samayena nāḷikodanaparamam zu lesen; S nāḷikodanam paramam.
562 S yañ ca kho rājā.
563 Dieser Spruch, hier als Meisterwort gegeben, ist in der vorangehenden Rede, oben S. 292, von Sakko dem König der Götter nachgesagt worden. Er wurde, nächst dem in der 14. Rede, oben S. 214, vorgetragenen, von der buddhistischen Tradition überallhin verbreitet und ist von Nepāl über Tibet bis zu den letzten Mongolen gedrungen und ebenso im ganzen asiatischen Süden wiederzufinden. Ich selbst habe den Spruch mit einer Inschrift aus dem äußersten Nordwesten Indiens identifizieren können: v. Epigraphia Indica vol. IV p. 134. Es ist eine Felseninschrift auf dem sogenannten Juwelenstein, Khazanaghat, unweit Mangalor im Swātgebiet, Peschāwar, oberhalb der Ruinen der einst so hochberühmten Königsburg Ud yānam: noch im 4.Jahrhundert nach Chr. einer der Residenzen der guptischen Erderoberer, die, nach den ungās, wieder das Erbe der Mauryās, ein großes, geeinigtes, blühendes Weltreich sich erkämpft und ein paar Jahrhunderte ebenso tapfer als weise, auf durchaus nationaler, landestümlich gefestigter Grundlage, behauptet hatten und sich zugleich als Förderer und Freunde aller klassischen Künste und Wissenschaften, der vedischen gleichwie der buddhistischen, einen unvergänglichen Ruhm gesichert haben. Vom hohen Alter der Lautzeichen und der schönen Sprache unserer Inschrift gilt das Gleiche, was ich über jene andere verwandte Felsenurkunde nach BÜHLERS Urteil, oben Anm. 336, beigebracht habe, und wiederum der wärmste Dank dem Colonel H.A. DEANE für [711] seinen ausführlichen Bericht und die tadellos gelungenen Abklatsche, die auf dem rauhen Felsgestein nur mit sachkundiger Sorgfalt zu erreichen waren.
564 Diese Völkerschaften waren die bedeutendsten von Mittelindien, im recht eigentlich ārischen Kulturbereich, auf einem Landgebiet von weit mehr als der Größe des Deutschen Reichs. Nächst den Benāresern waren die Kosaler, mit ihrer göttlichen, vom Sohn der Sonne Manuvaivasvatas selbst gegründeten Stadt Ayodhyā – der klassischen Stätte des Rāmāyaṇam – sowie auch die Kurū-Pañcaler, seit den ältesten Ahnengeschlechtern durch Weisheit und Tapferkeit aus gezeichnet, im oberen Flußgebiet von Ganges und Yamunā gesiedelt, an welch letzterer die mächtige Königsburg der Pañcāla-Pāṇḍaver, Indraprastham, gelegen war, auf deren Ruinen heute Delhi steht. Nicht minder berühmt war Mathurā, die Residenz der benachbarten Sūrasener, die Heimat Krischnas, des »Herrn von Mathurā«, und seines Kults, durch MEGASTHENES, in ARRIANS Indica VIII 5, wo er von den Σουρασηναι berichtet, gut bestätigt. Die westlichen Maccher, im Saṃskṛt die Matsyās, waren die Bundesgenossen der Pañcāler im großen Kampfe mit den kurūnischen Bharatern, deren gegenseitig ungeheuerliche Heldentaten zu schildern das Epos nie müde wird. Ostsüdöstlich, im Umkreis des heutigen Bezirks von Patna, saßen die stolzen Stämme der Vajjīner und Maller, die uns schon in der 16. Rede begegnet sind. Die Cetier endlich und Vaṃser oder Va ās der ruti und Vatsyās der Smṛti (zum ersteren cf. OLDENBERG, Buddha 1. Aufl. S. 400f.), gerühmt als Hüter und Bewahrer echter Ordnung und Sitte – die vordersten nannten sich Söhne der Kurūner und sind die schon seit der Ṛksaṃhitā wohlbekannten Cedyer oder Cedayās – lagen an den südlichen Grenzen der altehrwürdigen Landstriche, etwa im heutigen Bereich von Gwalior bis Jabalpur, und sind auf Inschriften als Herrschergeschlechter häufig anzutreffen. Vergl. Manus II 17-22, wo ebendieses ganze Ländergebiet, das Mittelreich mit all seinen Völkern, vom östlichen bis zum westlichen Meer und vom Himālayo bis zum Vindhyer Gebirge, als der Ārische Bereich, Āryāvartas, bezeichnet ist, Und dies war der Schauplatz der Wanderungen des Asketen Gotamo und seiner Jünger, wie Anm. 418 näher gezeigt wurde.
565 Zumeist Nachfolger, die als huldigende Anhänger im Hausstande zu verstehn sind, wie auch in der 16. Rede, oben S. 246. Die auffallend hohe Anzahl von Verstorbenen, hier stets angeführt, mag wirklich eingetretenen Ereignissen entsprechen, da ja wie heute noch in Indien auch damals plötzlich ein großes Sterben, eine der großen Seuchen, Cholera oder Pest, über Stadt und Land sich erstreckt haben kann: wo denn, oft in wenigen Stunden, viele Hunderte weggerafft werden. Eine Schilderung dieser Verhältnisse, Umstände und Erlebnisse ist in den Liedern der Nonnen aufbewahrt, v. 219.
566 Vergl. die 68. Rede der Mittleren Sammlung S. 499-503; sodann den »Spiegel der Lehre«, oben S. 247. Über die Hörerschaft handelt später Anm. 590; cf. auch den Indischen Spruch, bei BÖHTLINGK 6573:
rutvā dharmaṃ vijānāti,
rutvā tyajati durmatim;
rutvā jñānam avāpnoti,
rutvā mokṣam avāpnuyāt.
567 suññā maññe anga Magadhā ist die richtige Zerlegung.
568 ayaṃ kho panāpi ahosi mit S.
569 Mit S tatra, eine Nuance stärker betont. – Zur Topographie Mittlere Sammlung S. 188, 191, 270, 641.
[712] 570 gatiṃ nesaṃ jānissāmi mit S.
571 upasantappadisso = upasaṃtāpyadṛ yas; mit S aber vippasannattā.
572 Mit S api ca me bhante lomāni haṭṭhāni. – Janavasabho, Scharenfürst, s.v.a. gaṇapatis: ein Titel, der in der Ṛksaṃhitā Göttern (Indrābṛhaspatī), später auch Menschen gegeben wird. Vergl. ähnlich gaṇe agaṇe varas. Inschriftlich ist ein Herrscher Gaṇapatis von Nalapuram überliefert, Indian Antiquary vol. XXII p. 81-82; und noch eine Reihe verwandter Königsnamen wie Gaṇapatināgas etc., finden sich in KIELHORNS Index zum Appendix des 5. Bandes der Epigraphia Indica verzeichnet. Vor allen anderen aber ist es Janamejayas, der hier bedeutsam anklingt, der »Scharenförderer«, der Name jenes altvedischen Königs der Kurūner, der in ruti wie Smṛti so hochgefeiert wird, leuchtend als Urbild und Inbegriff eines Herrschers der Vorzeit, und somit Janavasabhos, des verstorbenen Königs von Magadhā, geistiger Ahne. Ānandos Freude ist also gerechtfertigt, und sein Erstaunen insofern erklärlich als der Name in solcher Form und Zusammensetzung sonst nicht irgendwoher bekannt war, eben nur in der Welt der Dreiunddreißig, mehr Anomalie statt irdischer Analogie zeigt.
573 Mit S antarā kho saddassa und saddham anussāvesi; dann so ito cuto bis pahomi. – Das Reich Vessavaṇos ist die himmlische Stätte des Überflusses, Ālakamandā, s.v.a. Slûraffia, cf. oben Anm. 466; etwa Hiraṇyapuram, der Goldenen Burg des Mahābhāratam, oder den Inseln der Seligen, auch Wanaheim, analog. Vessavaṇo oder Kubero, wie er mit Vornamen heißt, ist im persönlichen Umgange ungemein liebenswürdig, der Herr der Schätze am Himālayo: in der Skulptur schon auf einem Relief am Kuppelmal von Barāhat prächtig dargestellt, später immer beliebter und populärer geworden, weit über den indischen Umkreis hinaus, bis nach Japan, wo er Bischamon genannt wird. Es ist jener Plutos, ein König reich und milde,
Er hat nichts weiter zu erstreben,
Wo's irgend fehlte, späht sein Blick,
Und seine reine Lust zu geben
Ist größer als Besitz und Glück.
Dies gilt eben, wohlverstanden, für Ālakamandā, Wahnheim, Carnevalia, Cuccagna, the Land of Cockayne, »where wit and wealth are squandered«, für Utinamutinopolis im Kimmgau, kurz für alle Gandharverstädte der Fata Morgana und apokalyptische Potztausendherrlichkeit. In den tiefer gelegenen Welten bewährt sich besser des Kynikers MONIMOS Vorstellung vom Plutos oder Reichtum: πλουτον ειπε τυχης εμετον, als zufällig von ihm angespien sein – zufällig, d.i. zukömmlich, after desert; in diatonischem Einklang mit Kālidāsas Wunsch, Ende der Urva ī:
Parasparavirodhinyor ekasaṃ rayadurlabham,
saṃgataṃ rīSarasvatyor bhūtaye 'stu sadā satām.
574 Es war jener Morgen, wo König Bimbisāro, am Söller seines Palastes stehend, den jugendkräftigen Gotamo als Pilger dahinziehn sah: cf. den Bericht und das mächtig ergreifende Gespräch zwischen König und Pilger in den Bruchstücken der Reden Nr. 27, v. 405-424.
575 Virūḷhako ist einer der gegenüber benachbarten Geisterherren, der Hüter des Südens, während Vessavaṇo am Himālayo thront, und noch je ein großer König und Weltbeschützer im Osten und im Westen seines Amtes waltet. Bei der übermäßigen Ausdehnung des indischen Reiches war, nach gut vedischer Anschauung, mit einem Erdgeist allein nicht auszukommen: daher denn ein Vierherrenamt von Sakko, dem [713] König der Götter, eingesetzt wurde, im Einvernehmen und nach Beratung mit den Dreiunddreißigern, wie oben alsbald weiter berichtet wird, eine Art Quatuorviratus viarum curandarum. Diese Herren sind von Afghanistan bis zu den Kurilen wie nach Zeilon in unzähligen Gestalten, meist als Tempeltorhüter, anzutreffen. Sie werden aber zuweilen auch, wie unsere Evangelisten, nur durch ihre Embleme angedeutet, und zwar gehört zu Kubero der Löwe, zu Dhataraṭṭho der Elefant, zu Virūḷhako das Roß und zu Virūpakkho der Stier. – Mit S idāham zu lesen.
576 S wie Mandalay upasankamitum.
577 ativirocenti und adhunūpapannā mit S.
578 Besser sa-indakā, nach Majjhimanikāyo vol. I p. 140; auch mit C. – Der obige Gruß mit seinen oft wiederholten Strophen ist das Ave verum der Dreiunddreißig und wurde ohne Zweifel dort im Verein der Himmlischen, in der voll aufgegangenen Mondnacht, so gesungen wie hier auf Erden unser Choral von MOZART, der die Andeutung aus dem Osten dazu bekanntlich von PALESTRINA empfangen hatte.
579 Ebendieser Vorgang im Götterhimmel Sakkos war, nach Mahāvaṃso 30 v. 89-97, am Großen Kuppelmal zu Anurādhapuram auf Hochreliefen geschildert: Catuddisante cattāro | mahārājā ṭhitā ahu | tettiṃsa devaputtā cādi: alles aus gediegenem Gold und mit Edelgestein übersät, nach der Anweisung Duṭṭhagāminis. Neuerdings noch hat H.C.P. BELL die Erzbildnisse der vier Großen Könige oder Welthüter unter den Ruinen des Vijayārāmo aus dem 8. Jahrhundert bei Anurādhapuram aufgefunden; S.V.A. SMITH in der Zeitschrift der deutschen morgenländischen Gesellschaft 1911 S. 237f.
580 Vergl. hiermit die Angaben bei der psychologischen Reise zu Brahmā, 11. Rede 152-157.
581 sanankumāro, auch Eigenname; über den beglaubigten Wert oder Unwert dieser Bezeichnung später, Anm. 610. So ein hoher indischer Gott, der Äonen Lebensalter durchbesteht, ist relativ ein ewiger Jüngling, im Vergleich zu den kurzlebigen Menschen, Geistern usw. Vergl. Anm. 714. Über die Dreiunddreißig Götter und ihre Potenzen, mahimānas, wie es in den Upanischaden heißt, ist das nähere in Anm. 643 beigebracht. Die Griechen haben sie, nach KALLIPPOS, als die 33 planetarischen Sphärenträger erklärt, von TASSO schön wiedererzählt in seinem Dialog »Il MALPIGLIO secondo«, gegen Ende. Bei den Gnostikern sind es 33 Geisteräonen geworden: vergl. Mittlere Sammlung Anm. 296, wo die Nachweise bis auf JAKOB BÖHME herabreichen, der seinen Gott schlechthin mit der Zahl 33 bezeichnet. So ist auch die doketische Selbstgestaltung, wie sie bei uns oben dargestellt wird, bei den Gnostikern wiederzufinden und war insbesondere bei ihnen und ihren Jüngern und Nachfahren zu hohem Ansehn gelangt. Dies hat schon I.J. SCHMIDT sorgfältig dargelegt, in seiner noch immer ungemein anregenden Abhandlung »Über die Verwandtschaft der gnostisch-theosophischen Lehren mit den Religionssystemen des Orients, vorzüglich dem Buddhaismus«, Leipzig 1828, wo er S. 17 die Ansicht nachweist, daß solche Theophanien und Engelerscheinungen »aus einer Art Mâja oder Sinnestäuschung zu erklären seyen, indem die Engel nach dem Bedürfnisse derer, denen sie erscheinen, sich in eine beliebige Form verwandeln können, ohne daß eine solche Form ihnen eigen wäre.« Diese gnostische Vermittlung ist also ohne Zweifel aus Texten, wie es unser obiger ist, erfolgt. – Die Machtsphäre eines solchen Großen Brahmās erstreckt sich, nach Anguttaranikāyo X Nr. 29, über tausend Erdwelten mit ihren Himmeln: während ein vollkommen Erwachter, ein Buddho, seinen Abglanz und die Kraft seines Wortes noch dreimal weiter aussenden könnte, wenn ihn danach verlangte, ibid. III Nr. 80. Ähnlich auch Mittlere Sammlung S. 360.
[714] 582 pallankena nisīdanti zu lesen: es ist die wohlbekannte Körperhaltung bei ernster Aufmerksamkeit; vergl. Mittlere Sammlung S. 247, Lieder der Mönche Anm. 1095. Hier oben natürlich nur göttliche Nachwirkung, Nachahmung: da nach indischem Begriffe der Gott zum Asketen wie zum Menschen der Affe sich verhält.
583 pañcasikho: fünfstrahlig, auch fünfsträhnig, und so in der Smṛti auch als Bezeichnung für brāhmanische Büßer und Asketen gebraucht, zugleich im Hinblick auf das pañcāgnisādhanam, der hochgerühmten, heute noch wie einst eifrig geübten Fünffeuerbuße, mit den vier Feuerbränden an den vier Ecken und der Sonne zufünft im Scheitel. Die obige Umwandlung Des ewigen Jünglings in einen Jüngling mit fünf Strahlen ist demnach auch vergeistigte Andeutung der einst geübten, erfolgreichen Buße: Sanankumāro, Der ewige Jüngling, weist auf Pañcasikhakumāro, den Jüngling mit fünf Strahlen zurück, der er vordem gewesen sein mochte; ganz ebenso wie ein anderer Großer Brahmā, Sahampati, sich selbst als saham pati, einen mächtigen Herrn, erklärt, nur daher dazu geworden, weil er einst, in vergangenen Äonen, als Kassapo der erwachte Meister war, bei diesem ein mächtiger Mönch, sahako bhikkhu, gewesen war: vergl. Mittlere Sammlung, Anm. 215. – Mit dem Plan der dramatischen Ausgestaltung eines solchen Themas hat bekanntlich RICHARD WAGNER in seinen kräftigsten Jahren – damals noch nicht am Jesusbild niedergebrochen – sich lange getragen. Er wollte, wie er, Mein Leben S. 627, berichtet, das vergangene Leben der Hauptpersonen als unmittelbare Gegenwart in die neue Lebensphase hineinspielen lassen, und erkannte sogleich, »wie nur der stets gegenwärtig miterklingenden musikalischen Reminiszenz dieses Doppel-Leben vollkommen dem Gefühle vorzuführen möglich werden durfte – und dies bestimmte mich, die Aufgabe der Ausführung dieser Dichtung mit besondrer Liebe mir vorzubehalten.« Ein Jahrhundert früher schon hatte VOLTAIRE, ebenfalls von den Indern und damals bereits wunderbar tief belehrt, jene Reminiszenz gleichnisweise angedeutet: »comme une étincelle a quelque chose de semblable au soleil, et une goutte d'eau tient quelque chose du vaste Océan«, Sophronime et Adélos, gegen Ende; und hat uns hiermit allerdings auch zugleich mit PLOTINOS verbunden. Die Gestalt des Ewigen Jünglings ist bei uns offenkundig als Christus veranschaulicht worden, am schönsten vielleicht von CORREGGIO, auf dem Gemälde im Prado, wo er den unversehrt wiedererstandenen Herrn vor der entzückt zu ihm aufblickenden Magdalena erscheinen läßt: eine Darstellung, bei der freilich selbst der letzte Rest von Davidhistorie und hieratischer Larve spurlos in seliges Licht aufgelöst ist, und der Ewige Jüngling einzig im Glanze von jenseit – von den Dreiunddreißig her – dasteht. CORREGGIO war nämlich, in ähnlicher Weise wie RAFFAELLO und noch andere, auf dädalischem Pfade längst schon hinter das Geheimnis gekommen, das erst der Philosoph von Ferney dem gekrönten Jugendfreunde ganz offen, âne tougenheit, verraten konnte, als er sagte: »Il m'a paru évident que notre sainte religion chrétienne est uniquement fondée sur l'antique religion de Brama«, und der da die christlichen Fabeln und Mysterien bereits richtig kennzeichnete als »une misérable et froide copie de l'ancienne théologie indienne«: welche Erkenntnis der »Grand Homme« zur seinen gemacht und noch verstärkt hatte, indem er dann aus Potsdam am 19. März 1776 zurückschrieb: »II est vrai, comme vous le dites, que les chrétiens ont été les plagiaires grossiers des fables qu'on avait inventées avant eux. Je leur pardonne encore les vierges en faveur de quelques beaux tableaux que les peintres en ont faits; mais vous m'avouerez cependant que jamais l'antiquité, ni quelque autre nation que ce soit, n'a imaginé une absurdité plus atroce et plus blasphématoire que celle de manger son Dieu. C'est le dogme le plus révoltant, le plus injurieux à l'Être [715] Suprême, le comble de la folie et de la démence. – Les Indiens font incarner trente fois leur Sommona-codom [so war Samaṇo Gotamo über Siam seit Louis XIV. schon bekannt geworden]; à la bonne heure: mais tous ces peuples ne mangeaient point les objets de leur adoration.« Etc. Vergl. ferner Lieder der Nonnen Anm. 294; Bruchstücke der Reden Anm. 853, 2. Absatz. Unserem Ewigen Jüngling ist auch der Cherubinische Wandersmann, III 2, begegnet und hat ihn als Ewiges Kind angesprochen.
584 Zur Physiologie der Rede, bez. der Zunge cf. Bruchstücke der Reden Anm. 1022; über die Vortragsweise handelt Mittlere Sammlung S. 1021.
585 ghose yeva devā maññanti, und auch mit S yvāyam, zu lesen. – Auf einem Beiblatte zur großen Bombayer Ausgabe des Harivaṃ am ist der Ausschnitt eines Bildchens gegeben, wo man unseren Ewigen Jüngling viermal in ganz gleicher Gestalt nebeneinander im Himmel thronen sieht, die rechte Hand mit dem erklärenden Zeigefinger beim Vortrag erhoben, zu Häupten die Überschrift: Sanatkumārādi, »Der ewige Jüngling usw.«: es ist also eine typisch überlieferte Darstellung auch der obigen Szene, der Samayamudrā des göttlichen Vertrags. Die vierfache Schablone statt einer dreifachen, für die auf der Miniatur unmögliche dreiunddreißigfache, dient zur Andeutung der vier brahmavihārā des Ewigen Jünglings: cf. Anm. 549.
586 iddhivisatāya mit der Variante S zu lesen.
587 Schwarz und weiß oder dunkel und licht, so viel als gut und böse; vergl. Mittlere Sammlung S. 351, auch Bruchstücke der Reden v. 526. Ebenso im Yogasūtram 4 7: Karmā uklākṛṣṇaṃ yoginas, trividham itareṣāṃ. Der Büßer wirkt nicht weiß nicht schwarz, dreifach die übrigen: d.h. die anderen Menschen handeln gut oder schlecht oder gut und schlecht miteinander gemischt. – Hier muß man ansetzen um das Jenseit von gut und böse verstehn zu lernen. Der Jünger, der als Asket, d.i. unermüdlicher Kämpfer, diesen Standpunkt erobert hat, hat das lächelnde Weltauge aufzuwecken vermocht. Emporgelangt ist er zur rechten Tatenrast, sunikkammo, Lieder der Mönche v. 212 = Mahābhāratam XIV 46 18 naiṣkarmyam ācaret muniḥ. Damit ist das Verhältnis von Grund und Folge, die bedingte Entstehung, durchschaut, in sich zerfallen, schwarz und weiß wie Grauwacke unter dem Gipfel zurückgelassen, Lust und Leid als verschollener Traum entschwunden. Auf solcher Warte ist nur mehr das Bewußtsein der reinen Erkenntnis übriggeblieben, die Einsicht des »Auges der Welt«, wie Gotamo genannt wird: frei von der Absicht irgendeinem Zwecke zu dienen, ist jede Bedingung, jede Beziehung, jede Verbindlichkeit nach unten und oben abgeschnitten. Das ist das Ziel des »Stillen Denkers«, in der 140. Rede der Mittleren Sammlung, S. 1031, strahlend aufgewiesen. Mit einem ähnlichen Blicke lächelt der Meister auf Puṇṇo herab, als dieser pilgernd gegen Westen aufbricht, nach einem wilden Lande, wo er wohl gewaltsamen Tod finden könnte, ib. Nr. 145: denn auch Puṇṇo ist längst an schwarz und weiß vorübergegangen; und den Schwertstreich, der etwa sein Haupt vom Rumpfe trennen wird, erwartet er mit genau derselben rein entrückten Heiterkeit wie der heilige Placidus zu Parma auf dem Gemälde CORREGGIOS noch heute nicht minder es beglaubigt, jenseit von gut und böse, von Spaß und Ernst, jenseit von schwarz und weiß miteinander verteilt. Meister ECKHART und LAO-TSE haben bekanntlich ein Gleiches gelehrt; arg entstellt ist der Begriff bei NIETZSCHE, schlecht und modern, trotz der glänzenden zarathustrischen Larve, hinter der man zuletzt doch nur den Zeitgeist merkt.
588 Mit S richtig sammāsamādhissa bhāvanāya sammāsamādhissa pāripūriyā. – Vergl. die fünf Herzensgeräte, Mittlere Sammlung S. 641; sodann 881 und auch Bruchstücke der Reden v. 268.
[716] 589 Der Text ist mit S zu lesen, und zwar beidemal, wie auch in der 14. Rede, apārutā te amatassa dvārā; cf. Majjhimanikāyo vol. I p. 169 und die Anm. 329 zu unserer 14. Rede.
590 sātirekānādi, und dann das vereinzelt herausfallende sakadāgāmino, ist in das folgende musāvādassa ottappam mit dem Obelos einzureihen. – Zum ersten Jüngergrade, der erworbenen Hörerschaft des Ansichtvertrauten, cf. Mittlere Sammlung S. 356. Im Saṃyuttakanikāyo vol. V p. 458 wird von einem solchen Jünger gesagt, daß er höchstens noch siebenmal wiederkehren wird; und gleichwie etwa ein Sandhaufen, sieben Bohnen hoch, gegen den Himālayo, den König der Berge, nicht gezählt, nicht gerechnet, nicht verglichen werden kann, ebenso kann auch das Leiden, das dem Ansichtvertrauten noch bevorsteht, gegen das, was hinter ihm liegt, nicht gezählt, nicht gerechnet, nicht verglichen werden. Bei diesem Gleichnisse ist die Bohne, Kundigen zwar augenfällig, als recht absonderliches Maß verwunderlich: es ist eine Andeutung, daß sie für Totengebein gelte. Denn Bohnen waren die spezifische Spende beim Totenopfer seit uralter Zeit, so nach der berühmten Agniciti im Kāṭhakam 20 8, etwa schon 900 vor Chr., wurden daher als unrein und von übler Vorbedeutung betrachtet; ganz ähnlich wie bei PYTHAGORAS, bez. in Griechenland und zumal auch in Rom: worüber man in den Untersuchungen LEOPOLD VON SCHRÖDERS, Wiener Zeitschrift f.d. Kunde des Morgenlandes 15 187-212, das nähere findet. Ein solcher Haufe Totengebein ist nun sonst, beim unerfahrenen gewöhnlichen Menschen, unermeßlich: bergeshoch schichtete sich der Knochenfels, im Verlauf auch nur einer Weltäon, während des rastlosen Wandels von Geburt und Tod, wenn man im Geiste die Knochen zusammenfaßte, bei jedem einzelnen an, bis zu einem Gebirge aus Menschenkalk, Saṃyuttakanikāyo vol. II p. 185, Lieder der Nonnen v. 496-502; bei dem zur Hörerschaft gelangten erfahrenen Jünger dagegen ist das künftige Gebein, das noch aufgehäuft werden könnte, eben im Vergleich verschwindend wenig: höchstens sieben Bohnen hoch, d.h. im Verlaufe von sieben restlichen Lebensläufen noch sieben Totenopfer, und Bohnenspende und Knochenberg ist für immer erschöpft. An solchen, wie zahlreichen anderen, Beispielen läßt sich beobachten, wie außerordentlich fein die Gleichnisse Gotamos den Anschauungen und Sitten der vedischen Vorzeit nachkommen, sie ausgestalten, vertiefen und vollenden. Nichts ist da zufällig oder willkürlich angenommen, wie es auf den ersten Blick wohl scheinen möchte; vielmehr ist in der Regel jedes Wort, jeder Ausdruck so gewählt, daß die versöhnende Verbindung mit der Vorzeit und ihren Altmeistern dem Hörer alsbald offenbar werden kann. Doch dies nur nebenbei. Die Sache selbst, auf die es zuletzt allein ankommt, ist ja auch dem fernst Stehenden und vedisch Unkultivierten, an sich ohne weiters verständlich: ein Verhältnis, das hier wie bei jedem echten Kunstwerk statthat. Den später allbekannt gewordenen Gemeinplatz des Jātakam (Nr. 166), daß es keinen Fleck Erde gibt, der nicht Staub Verstorbener sei, Natthi loke an-āmatam, hat bei uns als erster VOLTAIRE aufgestellt: »Le globe ne contient que des cadavres«, und hinzugefügt »je voudrais n'être pas né«, im Dialog Les adorateurs, gegen Schluß.
591 Wie Ende der 14. Rede, S. 217; s. Anm. 339. – Ob Scharenfürsts Kunde und Verkündigung aus der Welt der Dreiunddreißig eine dichterische Erfindung sei, wird gern zu bejahen sein, wenn man formal verblüffend gleichartige Berichte aus angeblich unseren eigenen jenseitigen Kreisen, wie sie z.B. im zweiten Bande von KERNERS Seherin von Prevorst vielfach vorgetragen werden, als bloß umgekehrte Spiegelwellen und schlafwache Träume und Hirngespinste erklären darf: worüber mir kein Urteil zusteht. ROBERT L'ORANGE, auch darin erfahren, hat dergleichen Erscheinungen, [717] obzwar ihm von einer höheren Warte aus gänzlich belanglos, eine gegenständliche Gültigkeit zuerkennen mögen – salvis rumusculis, versteht sich, geheimredlicher Rede unter Haus-, Hof- und Kammerräten utriusque Minervae. Denn hier heißt es eben ku alo Yustīnaḥ Karṇaḥ, dem Kāmandakīyam V 70 gemäß:
kṛ o 'pi hi vivekajño
yāti saṃ rayaṇīyatām.
Eine Art Erinnerung, erforscht und erfunden aus früherem Leben, mag vielleicht in jenen Reichen oder fern-nahen Dimensionen von ganz andersartigen Bedingungen als bei uns abhängen, von Umständen, die wohl am besonnensten und saubersten in SCHOPENHAUERS bahnbrechendem Versuch über das Geistersehn dargelegt sind. Der Grund, warum dem so sei, ist übrigens schon vor etwa 170 Jahren von einem sehr geistvollen Kopfe erkannt worden und an einer Stelle ausgesprochen, wo man nach dergleichen kaum suchen dürfte, im sogenannten conte moral »Le sopha« von CRÉBILLON dem jüngeren. Er sagt da, bald nach Beginn des ersten Kapitels: »Quoique le dogme de la métempsycose soit parmi nous généralement établi, nous n'avons pas tous les mêmes raisons pour le croire certain, puisqu'il y a fort peu de gens à qui il soit accordé de se souvenir des différentes transmigrations de leur âme. Il arrive ordinairement qu'au sortir du corps où une âme était emprisonnée, elle entre dans un autre, sans conserver aucune idée, soit des connaissances qu'elle avait acquises, soit des choses auxquelles elle a eu part. – Nos âmes destinées, pendant une longue suite de siècles, à passer de corps en corps, seraient presque toujours malheureuses, si elles se souvenaient de ce qu'elles ont été. Telle, par exemple, qui après avoir animé le corps d'un roi, se trouve dans celui d'un reptile, ou dans le corps d'un de ces mortels obscurs que la grandeur de leur misère rend plus à plaindre encore que les animaux les plus vils, ne soutiendrait pas, sans désespoir, sa nouvelle condition. – L'âme, d'ailleurs, se trouverait nécessairement surchargée d'un grand nombre d'idées qui lui resteraient de ces vies précédentes; et plus affectée peut-être de ce qu'elle aurait été que de ce qu'elle serait, négligerait les devoirs que le corps qu'elle occupe lui prescrit, et troublerait enfin l'ordre de l'univers au lieu d'y contribuer.« CRÉBILLON hatte hier mit glänzendem Scharfsinn den Kern der Frage schon angeschnitten, wenn auch seine Ansicht von der »métempsycose« natürlich nur auf dem ihm zugänglichen Grund und Gemeinplatz sich entwickeln konnte, ähnlich wie später bei LESSING, noch fern von dem goetheschen Begriff einer Entelechie, geschweige der schopenhauerischen Transszendentaltheorie, nach welcher »der Unterschied zwischen den ehemals gelebt Habenden und den jetzt Lebenden kein absoluter ist, sondern in beiden der eine und selbe Wille zum Leben erscheint; wodurch ein Lebender, zurückgreifend, Reminiscenzen zu Tage fördern könnte, welche sich als Mittheilungen eines Verstorbenen darstellen.« Dies entspräche nun freilich mittelbar genau unserem obigen Fall mit Scharenfürst, εν εϑει φημης μαντικῳ.
Die Reihenfolge der Zeugen, durch welche der legendarische Bericht als reich ausgeschmückte Rede, dem Gehalt nach aber rein lehrgemäß als Gespräch wie es bei Ordensbrüdern oft wiederkehrt, auch aus der Welt der Dreiunddreißig unter vieles Volk auf Erden gedrungen war, allgemein verbreitet, jedem zugänglich, den Menschen eben wohlbekannt wurde, diese am Ende aufgestellte sakrale Zeugenreihe, von Brahmā und Vessavaṇo bis zu Ānando und den Mönchen und Nonnen und allen Anhängern herab, ist nach dem Brauche der alten Upanischaden gegeben, wo gleichfalls die Überlieferung des Gehörten am Ende so vorgetragen wird, z.B. Chāndogyopaniṣat [718] i.f.: »Das aber hat also Brahmā zu Prajāpatis gesprochen, Prajāpatis zu Manus, Manus zu den Nachkommen«, auch in der Bṛhadāraṇyakā etc. etc., wo meist noch lange Reihen vedischer Meister und Altmeister und ihrer Jünger als Mittelglieder aufgezählt werden, am letztgenannten Orte in umgekehrter Folge von Bhāradvājīputras, der etwa unserem Ānando der Zeit nach entspräche, über 60 Seherahnen hinauf bis zu Ādityas, dem Sonnigen, oder der Sonne selbst. Dieser vedische Brauch ist daher oben, am Ende unseres Sagenberichtes, glatt übernommen. Vergl. Mittlere Sammlung Anm. 529, wo ich außerdem noch auf eine verwandte Norm bei den Nachfolgern San Francescos hingewiesen habe: denn die Glaubwürdigkeit der vorgetragenen Legenden wird am Schlusse des vorletzten Fioretto ganz ähnlich bestätigt: »Hanc historiam habuit frater Iacobus de Massa ab ore fratris Leonis, et frater Hugolinus de Monte Sanctae Mariae ab ore dicti fratris Iacobi, et ego qui scripsi ab ore fratris Hugolini viri per omnia fide digni.« Freilich ist bei uns oben die Mühe solcher Beglaubigung ziemlich überflüssig, da ja ausdrücklich gesagt wird, der Meister habe es auch selbst erkannt, sāmañ ca abhiññāya: so daß hier nur etwa das heraklitische Wort noch mitbezeugen könnte, im Epigramm bei DIOGENES LAERTIOS IX I i.f., εἱς εμοι ανϑρωπος τρισμυριοι, οἱ δ'αναριϑμοι ουδεις: Einer gilt mir für Dreißigtausend, doch die Unzähligen garnichts – als āryapraveṇivad āptavākyam.
592 pañcasikho, vergl. oben Anm. 583. Hier ist, als Klasse für sich, der Fünfstrahlige zu einer selbständigen Person geworden. Mit S dann Gijjhakūṭam pabbatam. – Die folgende Rede ist streckenweise in das Mahāvastu übertragen, ed. SENART vol. III p. 197 bis 224. Eine Reihe Parallelen hat OLDENBERG mit dankenswertem Fleiße zusammengestellt, Zeitschrift der deutschen morgenländischen Gesellschaft Bd. 52 S. 659f.; jedoch leider nicht nach der damals schon zugänglichen sorgsamen siamesischen Textausgabe, sondern etwas zu hastig nach seinem Exzerpt aus einer verderbten siṇhalesischen Handschrift greifend: wobei er freilich wie jener Pfaffe am Sterbelager Eulenspiegels statt der paar gangbaren Batzen, will sagen: richtigen Namen, was anderes aus der Erbkanne hervorgezogen hat. Die einzelnen Paragraphen haben die beiden RHYS DAVIDS auf einer Tabulatur in der Einleitung zu ihrer Wiedergabe mit Zahlen angezeichnet, Dialogues of the Buddha Part II p. 256. Die Bemerkungen dieses letzteren Forscherpaars sind, wie gewöhnlich, eine phantasievolle Hausarbeit, frei von jedem beschwerlichen philologischen Kröper, als Plundermatz recht putzig in Kinkerlitzchen aufgemutzt und ausstaffiert mit Zwirn und Dockensamt. Dagegen hat auf Grund ernster, ungemein feinsinnig vergleichender Mythenforschung LEOPOLD VON SCHRÖDER in seinen kürzlich erschienenen Wurzeln der Sage vom heiligen Gral (2. Aufl. Wien 1911) die vedischen Gandharven, zu denen eben auch unser obiger Himmelsbote gehört, als die stammverwandten Urahnen Lohengrins höchst wahrscheinlich gemacht. Derlei Arbeiten – ob auch hin und wieder stark enthusiastisch – seien als wirksames Gegengift bei Erkrankung an Tabu oder wundtischer Völkerpsychologie den davon betroffenen Köpfen herzlich empfohlen. Denn »daz haupt ist oft siech von mangerlai sachen«, meinte schon sehr richtig, im Hinblick auf künftige Pourleméritiker, ein alter Naturfreund, unser wackerer KONRAD VON MEGENBERG. – Zur allgemeinen Naturgeschichte des Himmelsboten, gandharvas, gandhabbo, sei hier noch bemerkt, daß er in der altindischen Physiologie und Terminologie als jener Genius oder geistige Schößling gilt, der hienieden, wenn das Weib vom Manne befruchtet wird, als Keimling empfangen wird, in Duftes (gandho) lebendiger Fühlung hergeflogen, und der nun als das neue Menschenwesen grunelnd entsteht und aufgeht, recht als ein himmlischer Same zur höchsten Entwicklung. So ist der gandhabbo oder [719] schwängernde Düftling jedesmal die Form, durch welche im Kreislauf des Daseins die jeweilige Geburt zustande kommt, der genau bestimmte δαιμων und αγγελος, oder der geistige Stempel zur entsprechenden Matrize, der erst im Tode zerbricht und sich auflöst, um sogleich in neuem Gusse wiederzuerstehn und so fort, solange eben Begehren und Anhaften dauert. Weitere, sehr lehrreiche Aufklärungen gibt die Mittlere Sammlung S. 296 und 716; vergl. auch ibid. Anm. 530. Unverbrüchliche Grenzen zwischen Menschen- und Tierreich, Geister- und Götterwelt usw. bestehn natürlich nicht: vielmehr gehn sie auf organisch entwickelten Stufen in einander über und stehn so stets im lebendigen Zusammenhang; siehe dazu die 15. Rede, oben S. 219. Bei uns ist das geheimnisvolle Weben und Wesen zwischen den Himmelsboten und den Frauen von BYRON in seinem Mysterium Heaven and Earth wundervoll kühn und ganz indisch anmutend – ihm selbst schien es griechisch – behandelt worden. Endlich aber gehören, der zarteren und innigeren Verwandtschaft nach, auch wohl jene Drei Knaben hierher, die als Sendboten aus der Welt der Dreiunddreißig, der höchsten symbolischen Freimaurerzahl, auf den indo-iranisch-gnostischen Pfaden Sarastro-Zarathuṣtras zu uns gelangt, ihre lichte Abkunft und das Ziel dieser Bahn mit überirdisch beglückender Wirklichkeit in den Weisen der Zauberflöte so sicher und unmittelbar gegenwärtig anzeigen.
593 Vergl. die Acht Seligkeiten, auch die Octo beatitudines, Mittlere Sammlung Anm. 503, zumal aber den in die Welt der Dreiunddreißig hinaufreichenden Sphärenreigen der Acht Musen, der allen Aufruhr, Lärm und Unfrieden besänftigt, bei PLUTARCH, Sympos. IX 14 6.
594 icchāma mayam mit S.
595 te na zu lesen, mit S.
596 Den Begriff Urasketentum, ādibrahmacariyam, hat Gotamo selbst als sein Kennzeichen aufgestellt, in der 63. Rede der Mittleren Sammlung; vergl. auch die 133ste (S. 984) sowie oben die 9. Rede (S. 134). Ein vedisches Analogen Bruchstücke der Reden Anm. 701. Bei uns hat San Francesco ein Gleiches mit dem Merkwort ausgesprochen: »Non pluribus indigeo: scio Christum pauperem crucifixum«, nach CELANO, Vita secunda cap. XLVIII. – Die vorangehende siebente Lobpreisung wird von MAKARIOS, bei FLOSS p. 197, so überliefert: Gloriatio monachi, quando verba eius operibus consonant.
597 Mit S zu lesen brahmuno Sanankumārass' eva paṭissutvā.
598 Der Prayāgas, Payāgo, Ort der Einmündung von Ganges und Yamunā, der hochwürdigen vedischen Ströme, gilt dem orthodoxen Inder als die heiligste Stätte der Welt, wo der Büßer alles Übel von sich abspült. Das Bildnis oben entrollt daher eine vergeistigte Anschauung jenes Inbegriffs von Heiligkeit, als Gegenstück zur 7. Rede der Mittleren Sammlung, wo Gotamo gleichfalls vom Payāgo spricht und das Innere Bad anzeigt, S. 42. Vergl. auch Lieder der Nonnen Anm. 239. – Im Arm der Ströme war einst eine ragende Burgstadt gelegen, die längst unter dem Alluvium völlig verschwunden ist. Einzig die Säule Asokos mit ihren Inschriften und späteren Einzeichnungen ist übriggeblieben, nun nach der neugegründeten Stadt All ahābād genannt, der Feste, die AKBAR unter dem Namen Ilāhabās an diesem strategisch wichtigen Punkt auf den Flußdünen 1800 Jahre später hatte errichten lassen, kaum 1/2 km vor dem Zusammenfluß, heute noch ein starkes Bollwerk, das den etwa 21/2 km breiten gelblichen Ganges und die 3/4 km breite bläuliche Yamunā bei ihrer prachtvollen Einmündung im Gabelgrunde bekrönt. Über den sogen. Unvergänglichen Feigenbaum an ebendieser Stelle gibt CUNNINGHAM weiteren Bericht im Archaeological[720] Survey of India, vol. I, Simla 1871, p. 297-301. – Ein anderes Gleichnis vom Ganges, nicht minder anschaulich und großartig gesehn, findet sich in der 73. Rede der Mittleren Sammlung S. 530, wo Vacchagotto der Pilger sagt: »Gleich wie etwa, o Gotamo, der Gangesstrom nach dem Meere sich neigt, nach dem Meere sich beugt, nach dem Meere sich hinsenkt und angekommen am Meere stillesteht: ebenso auch ist hier des Herrn Gotamo Gefolge, so Pilger wie Bürger, zur Erlöschung geneigt, zur Erlöschung gebeugt, zur Erlöschung hingesenkt und bleibt angekommen bei ihr stillestehn.« Dieses Bild ist auch darum so ungemein zutreffend, weil der Übergang der Fluten des Ganges in das Meer, wenn man von Kalkutta aus ungefähr zehn Stunden lang hinabsegelt bis Ufer und Dünen verschwunden sind, in der ungeheueren Weite vollkommen unmerklich stattfindet, d.h. daß der Strom zum Meere geworden, in Meer übergegangen, eben wie stillegestanden erscheint, zumal die Farbe des Wassers immer noch viele Meilen in die Runde gangesfarben bleibt, das ist hier gelbgrau-grünlich opalisierend: aber alle einzeln gesellige Stromwellenbewegung ist im Meer ersunken und erloschen. Eingedenk des Anblicks dieser mächtig ergreifenden Öde hat denn auch Valliyo, Lieder der Mönche v. 168, einst zum Meister gesagt:
O zeige du den Weg mir an,
Die Furt aus arger Todesmacht:
Und schweigend werd' ich schweifen hin,
Gleichwie der Ganges hin zum Meer.
Wieder ein anderes Gleichnis vom Ganges, das eine ähnliche Darstellung in der 21. Rede der Mittleren Sammlung, S. 151, weiter ausführt und vertieft, ist in einer Meisterrede des Saṃyuttakanikāyo gegeben, vol. V p. 53: wie man den Ganges, der nach Osten gewandt ist, nach Osten fließt, nach Osten dahinströmt, nicht nach Westen zurückleiten kann, so kann auch kein König, kein Freund und Genosse den heiligen Jünger, der heiliges Wirken vollendet, lange schon der Ablösung hingegeben ist, je wieder zur Umkehr nach Hause bewegen.
599 Mit S mahāpañño 'va.
600 Mit S tasmiṃ kho pana samaye.
601 d.i. das indische Festland: oben mit dem breithin erstreckten Gebirgsjoch, unten mit der Deichselspitze zwischen zwei Meeren. – Daß man schon damals eine im ganzen richtige Vorstellung von der Gestalt des Festlandes hatte, erhellt auch aus der Legende vom Mahāsupino des bodhisatto, dem »Großen Traumgesicht des Erwachsamen«, Anguttaranikāyo, Pañcakanipāto Nr. 196, wo das erste der fünf allegorischen gewaltigen Traumbilder den Vollendeten zeigt, auf die große Erde zur Ruhe hingestreckt, mit dem Himālayo als Kopfkissen, die linke Hand in das östliche Meer eintauchend, die rechte Hand im westlichen Meer, während die beiden Füße in den südlichen Ozean herabreichen: ein Symbol der Erwachung, die über ganz Indien aufgehn soll, in einem vorbedeutenden kolossalen Anthropomorphon erschaut.
602 Es waren also je sieben verjüngte Teilindien als Gesamtindien, sphärische Dreiecke in Deichsel- oder Haizahn-Form. – Um König Reṇus Reich, Kāsi mit Benāres, schlossen sich rings umher an: im Osten Bengālen mit Campā; im Norden das Land der Videher mit Mithilā, ein Gebiet oberhalb des heutigen Kreises von Patna, mit dem Ganges als der unteren Grenze, die altberühmte Janakabhūmi oder das Reich Janakas, der durch seine Gespräche und Freundschaft mit Yājñavalkyas aus dem 4. Buche des Bṛhadāraṇyakam so wohlbekannt ist; westlich davon die Sovīrer mit Rorukam; im Süden von diesen die blühende Landschaft Mālavā, damals noch wie auch sonst [721] häufig Avanti genannt, mit der Hauptstadt Māhissatī, später zumal durch Kālidāsas berühmt geworden, zu dessen Zeit Ujjayinī die Residenz war, nach den Bruchstücken der Reden v. 1011 ohne Zweifel eine ebenso alte Stadt: die Grenzen des Landes erstreckten sich bis zum Vindhyer Gebirge, zu Zeiten auch bis zur Narbadā herab, an deren klaren Gewässern eben die eine Hauptstadt Māhissatī gelegen war, heute das zerfallene Maheṣvar, im Gebiet von Indore, als Hintergrund gewaltiger Kämpfe und Heldentaten im Mahābhāratam wiederholt erwähnt, auch aus Inschriften vom nahen Sāñcithūpo des 2. Jahrhunderts v. Chr. (Epigraphia Indica II 109, 389f.) bestens bestätigt, vergl. FLEET im Journal of the Royal Asiatic Society 1910 p. 441-447; dann das als kriegslustig bekundete Reich der Assaker im Südwesten, mit der Reichshauptstadt Potanam: das Land wurde von Asoko erobert, der die Bewohner Potinikyer genannt hat, auf dem 13. Felsenedikt, Kālsi Zeile 7; und endlich im Südosten Kalingā, die Calingae des PLINIUS, mit Dantapur, ein mächtiges Reich, gleichfalls von Asoko erobert, im neunten Jahr seiner Regierung, in einem überaus blutigen Kriege, wo hunderttausende im Kampfe fielen, wovon er selbst, auf dem zuvor genannten Edikt, mit tiefer Rührung spricht, voll Reue über die Greuel des Krieges und zuversichtlich einem allgemein gesicherten Frieden und Verträgnis entgegensehend: heute trägt aus jenen längst entschwundenen Zeiten und Namen der kleine Hafenplatz Kalingapatam, an der Küste des Meerbusens von Bengālen, in der Tiefebene unter den östlichen Ghats, noch eine fern anmutende Erinnerung herüber.
603 Dieser Merkspruch klingt recht altertümlich einem vedischen nach, den Vi vāmitras seinen Söhnen – darunter auch ein berühmter Reṇus – gegeben, Aitareyabrāhmaṇam VII 17 i.f.:
Madhuchandāḥ ṛṇotana,
Ṛṣabho Reṇur Aṣṭakaḥ
ye ke ca bhrātaraḥ sthanāsmai
jyaiṣṭhyāya kalpadhvam.
In der Smṛti ist Reṇu als ein Aikṣvākas, Abkomme des vedischen Urkönigs, überliefert und daher mit Gotamo als einem Ikṣvākuiden, Okkākiden, genealogisch verbunden: cf. Anm. 98. Der Name Reṇu gehört zu ri, riṇāti, ist also urverwandt mit unserem rinnen = to run, bedeutet somit der »Renner«, der »Stürmer«, Ornymenos, Cursor; wie bei den herrlichen beiden L. PAPIRIUS, wo LIVIUS 10, 38 vom Sohne sagt: consul insignis L. PAPIRIUS CURSOR, qua paterna gloria, qua sua. – Die anderen Namen, meist schon bei BÖTHLINGK belegt und erklärbar, bedürfen keines weiteren Kommentars. Auf Reṇu im Lalitavistaras, ed. LEEMANN p. 171 v. 1 a, hat FLEET hingewiesen, Journ. Royal Asiatic Soc. 1907 p. 653 n. 2. Über den Namen der Bhārater in der allgemeinen Bedeutung von Fürsten, Herrschern, hat OLDENBERG gesprochen, in seinem ausgezeichneten ersten Exkurs, Buddha, 1. Aufl. S. 415 Anm.
604 Mit S anusāsaniyā satta ca rājāno und rajjena anusāsi.
605 Die vier Monate der Regenzeit einsam zurückgezogen an nur einem Orte zu verbleiben ist altvedische Asketenregel. Vergl. die schönen Ausführungen BÜHLERS im zweiten Bande der Epigraphia Indica S. 262-265 und Mittlere Sammlung S. 563. Im Orden Gotamos sind drei Monate die untere Grenze: die ersten, bez. die letzten vierzehn Tage der Regenzeit können, als weniger belästigend, wieder wie gewöhnlich zur Wanderung von Ort zu Ort verwendet werden. Der Mönch hat demnach mindestens von Mitte Juli bis Mitte Oktober die Regenzeit zu halten. Eine solche Zurückgezogenheit hatte auch HERAKLIT im Sinne, als er sagte, weise sein heißt von allem [722] abgesondert sein, σοφον εστι παντων κεχωρισμενον, bei STOBAEUS, Flor. III 81. – Das Glück dieser Einsamkeit als höchstes Gut aufzuweisen ist ein oft wiederholtes Thema in den Liedern der Mönche, gleich von v. 1 an, und immer in neuer, überraschender Wendung erklingend, bis zu v. 1149. So läßt sich z.B. der Mönch Bhūto, während der Regenzeit einsam im Gebirge zurückgezogen, in einer seiner Strophen also vernehmen, v. 522:
Wenn droben Donner dröhnt und rollend widerhallt,
Und Wolkenbrüche niederprasseln rings umher,
Und heimlich im Gefels der Weise Schauung übt:
So kennt er Wonnen, wie sie höher keiner kürt.
Vielleicht den wunderbarsten Ausdruck aller hat Kassapo der Große gefunden, in seinem Sang als Wanderer am Felsenjoch, v. 1058-1071. In diesen vierzehn Strophen ist mit starker poetischer Kraft und Anschaulichkeit dargestellt was STIRNER zu Anfang und Ende seines Werks auf eine reine Gedankenformel gebracht hat, die, obzwar anderswoher entwickelt, doch auch für uns den richtigen Exponenten angibt. »Eigner bin Ich«, so schließt STIRNER ab, »meiner Gewalt, und Ich bin es dann, wenn Ich Mich als Einzigen weiß. Im Einzigen kehrt selbst der Eigner in sein schöpferisches Nichts zurück, aus welchem er geboren wird. Jedes höhere Wesen über Mir, sei es Gott, sei es der Mensch, schwächt das Gefühl meiner Einzigkeit und erbleicht erst vor der Sonne dieses Bewußtseins. Stell' Ich auf Mich, den Einzigen, meine Sache, dann steht sie auf dem vergänglichen, dem sterblichen Schöpfer seiner, der sich selbst verzehrt, und Ich darf sagen:
Ich hab' mein' Sach' auf Nichts gestellt.«
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Und mein gehört die ganze Welt.
Diese letzte Folgerung darf nun aber nicht mehr, wie bei STIRNER, fehlen: denn sie krönt unser Thema, gleichsam als Ripienstimme; auch zur Melodie der GUYON im Cantique spirituel, Poésies etc. éd. Paris 1790 tome II p. 98:
Tout rit, tout est charmes
À qui ne veut rien;
Il a sans alarmes
L'Univers pour bien:
La terre fleurie,
Le Ciel azuré,
Et tout rassassie
Un cœur épuré.
Dergleichen ist der schwungvolle Ausdruck dessen, was Sankt ANTONIUS von Padua sechs Jahrhunderte schon vor dem Bayreuther Apostel des Einzigen so nüchtern wie nur möglich angegeben hat: Quot enim mortalia habes: tot Deos adoras, dicit Bernardus; sapiens sis tibi, nihil deest tibi ad sapientiam: sin autem tibi non fueris, nulli fueris: Sermo secundus in Dominica III post Pascha, ed. DE LA HAYE 1739 fol. 202 a. – Es sei hier noch zu unserem Text oben bemerkt, daß Govindos Anrede »Herr« an Stelle von »Majestät« durchaus der vedischen Überlieferung entspricht, da ja die Priesterkaste keinem anderen sich untertan ansah als nur ihrem eigenen Könige, nämlich Somas, dem Monde: Somāya candrāya dvijānāṃ rājñe; so auch in der Manusaṃhitā IX [723] 129 mit Kullūkas Kommentar, nach alter Sitte. Daher spricht denn auch Vassakāro der Māgadher Marschall, weil er einem Priestergeschlecht entstammt, seinen Herrscher, den König Ajātasattu, nur mit »Herr« an: in unserer 16. Rede, oben S. 231. Das war Norm.
606 puratthimena nagarass' eva mit S.
607 nāssa koci upasankamati mit S.
608 sammukhe pāturahosi ibid.
609 Vergl. Bhagavadgītā XI 14. Das folgende Gespräch ist ein Gegenstück zum Nāciketam upākhyā nam, nach der Kaṭhopaniṣat I 1-3.
610 madhupāko = madhuparkas, der berühmte Honigtrank oder Meth der ruti; zum Wechsel der Quantität cf. pāyāso etc. – Die von Brahmā in der Strophe vorher ausgesprochene Ansicht, daß man ihn als von Ewigkeit, als den ewigen Jüngling, betrachte, beruht natürlich auf einem Irrtum, auf einer himmlischen Gedächtnisschwäche, an der der Gott und seine Umgebung leidet: wie dies in der 49. Rede der Mittleren Sammlung ausführlich dargetan wird. Vergl. auch oben Anm. 21. Brahmās Herrlichkeit ist relativ gültig, pariyāyena, cum sedulitate angelica: da doch, wie IOANNES SECUNDUS gut indisch es sagt,
Perpetuum nil.
Cuncta recurrunt
Ordine certo.
611 S hat richtig in der Variante mamattaṃ ti p' ahan ti panādi. Dies ist der zweite Schritt des werdenden Asketen: der erste ist saddhāpaṭilābho, Vertrauen fassen, wie 2. Rede S. 46 ersichtlich. Zu virato methunasmā, entraten der Paarung sein, nicht mehr Paarung pflegen, »das gemeine Gesetz«, cf. ib. 99, passim; vergl. auch Mittlere Sammlung Anm. 365, sowie das feine 45. Bruchstück der Reden, v. 814-823, wo Gotamos Darstellung des ewig Weiblichen und ewig Männlichen, die Lehre von der Hingabe und Davonkunft, aus einer Rede des Anguttaranikāyo als Kommentar angeschlossen ist, Anm. 823. – Von einer ähnlichen Betrachtung wie oben Brahmā war der heilige ANTONIUS von Padua ausgegangen, als er einmal, in der 9. Sonntagsrede nach dem Trinitatisfest, weniger auf Etymologie als auf gute Semasiologie bedacht, erklärt hatte: »Mulier a mollitie dicta, quasi molliens heroum«, Weib, von Weichheit genannt, gleichsam Helden erweichend: ed. DE LA HAYE 1739 fol. 252 b. Auch ihm war eben das andere Gesetz, die Botschaft des brahmacariyam, aufgegangen.
612 paṭisanlīyati (sic) S für paṭisaṃlīyati. ›In sich geeint‹, ekodibhūto, eigentlich: ›allein für sich geworden‹, odi = ava + di von dayate, seinen Teil davon haben, damit zurückgezogen sein, nämlich in sich und mit sich, als eko, allein, zu einem solchen Menschen geworden, bhūto. Govindo legt also dieses etwas dunkle Wort, wenn auch nicht der Etymologie, so doch dem Sinne nach vollkommen richtig aus. Der Begriff ist der Yogasmṛti, der ja Govindo folgt, natürlich wohlbekannt; so z.B. auch als ātmaratirekasthas, s.v.a. in sich beseligt alleinstehn, wie es noch im Vāyupurāṇam XI 19 heißt:
Yas tu pratyāharet kāmān
kūrmo 'ṉgānīva sarvataḥ,
tathātmaratirekasthaḥ
pa yatyātmānam ātmani.
Eine andere mögliche, aber weniger gute Ableitung von ekodi hat MORRIS gegeben: [724] cf. Bruchstücke der Reden Anm. 962. – Die Angaben Govindos zeigen, daß er wiederum die zweite Schauung bereits erfahren hatte, bis dahin mit seinem Verständnisse gelangt war. Denn ebendiese Stufe wird immer so dargestellt, z.B. in der 2. Rede S. 50: »Nach Vollendung des Sinnens und Gedenkens erreicht der Mönch die innere Meeresstille, die Einheit des Gemütes, cetaso ekodibhāvam, die von sinnen und gedenken freie, in der Einigung geborene selige Heiterkeit, die Weihe der zweiten Schauung. Gleichwie etwa ein See mit unterirdischer Quelle, in den sich kein Bach von Osten oder Westen, von Norden oder Süden ergösse, keine Wolke von Zeit zu Zeit mit tüchtigem Gusse darüber hinwegzöge, in welchem nur die kühle Quelle des Grundes emporwellte und diesen See völlig durchdränge, durchtränkte, erfüllte und sättigte, so daß nicht der kleinste Teil des Sees von kühlem Wasser ungesättigt bliebe: ebenso auch durchdringt und durchtränkt, erfüllt und sättigt nun der Mönch diesen Leib da mit der in der Einigung geborenen seligen Heiterkeit, so daß nicht der kleinste Teil seines Körpers von der in der Einigung geborenen seligen Heiterkeit ungesättigt bleibt.« Dieser Grad der Einigung des in sich versenkten Asketen ist später auch von Kālidāsas noch rein entsprechend veranschaulicht worden, im Kumārasaṃbhavam III 48: avṛṣṭisaṃrambhamivādi. Das Gleichnis selbst sieht auf den ersten Blick etwas weit hergeholt oder doch seltsam aus, ist aber in Wirklichkeit sogar bei uns ausgezeichnet bestätigt, durch die Schilderung des Teichs bei Tennstedt in Thüringen, die GOETHE gibt, Farbenlehre, Nachträge Nr. 11: es liegt da, sagt er, »ein Teich mäßiger Größe, welcher nicht durch äußeren Zufluß, sondern durch mächtige, in ihm selbst hervorstrebende Quellen seinen immer gleichen Wassergehalt ... liefert. Von der unergründlichen Tiefe dieses Teiches ... wissen die Anwohner viel zu erzählen, so auch die Klarheit des Wassers über alles zu rühmen.«
613 Das ist die zweite heilige Warte, brahmavihāro: cf. die 17. Rede, S. 313, nebst Anm. 549. Govindo war somit, indem er je bis zur zweiten Staffel vorgedrungen, über die erste Hälfte des Weges schon klar geworden.
614 Mit S ūnakāmehi, beidemal.
615 Govindo deutet gleichnisweise an, daß er sich in einer Feuersbrunst befunden, ohne es gemerkt zu haben, in der wirbelnden Flamme von Geburt, Alter und Tod; eben jetzt wird er gewahr, wie schon das Dach aufqualmt und er sich wieder von der Glut jäh am Haupte versengt und verzehrt fühlt: darum rettet er sich und zieht eilig hinaus, fort aus der brennenden Qual der Wandelwelt, der flackernden Strohhütte des Lebens zu entkommen. Brahmā hat ihn angeregt, so nach vedischer Weisheit zu handeln, als ein gewitzigter Jünger dem Verderben zu entfliehen, wie es noch ebenso im Vedāntasāras überliefert ist, ed. BÖHTLINGK Nr. 32: Ayam adhikārī janmamaraṇādisaṃsārānalasaṃtapto pradīpta irā jalarā im ivādi. Vergl. auch Lieder der Mönche v. 39/40. Der selbe Gedankengang nach einem Spruche der Smṛti, im fünften Buche des Mahābhāratam, Vidurahitavākye XXXV 69, die rechte Gelegenheit, Ausgang und Ende zu zeigen:
Verdaute Speise wird gelobt,
Ein Ehweib nach der Jugendzeit,
Ein Held nach durchgekämpfter Schlacht,
Ein Büßer angelangt am Ziel.
Der den vedischen Göttern dargebrachte Feuerkult des Opferpriesters mag in der obigen Strophe Govindos zugleich angedeutet und als ganz vergeblich, ja unsinnig, mit gekennzeichnet sein.
[725] 616 Mit S richtig akāso (sic) zu lesen, d.h. frei von Rissen, akarṣas; zum Wechsel der Quantität cf. oben madhupāko, Anm. 610. Es ist das reine Wasser des Edelsteins damit gemeint, ohne Federn, Wolken, Risse, Blasen: entsprechend der parallelen Stelle subho jotimā, Mittlere Sammlung Anm. 419. – Für suddhā hat S sutvā. Vorher in der ersten Strophe Govindos, ist yiṭṭhakāmo Ellipse, yena so zu verstehn; möglich wäre auch pubbe-y-iṭṭhako: Sinn und Begriff ist, als yajñe, der eine und selbe. Im folgenden Absatz dann chasu rajjesu zu lesen.
617 ime kho bho wie vorher mit S. – Die auch in Altindien wohlbekannte Gier gerade der Priester nach Gold und zumal nach Weibern, schon in der Chāndogyopaniṣat IV 2 unübertrefflich naiv veranschaulicht, ist im Anguttaranikāyo V 191 mit einer verblüffenden Verachtung aller Umschweife besprochen. Fünf Priestersatzungen der Vorzeit, heißt es da, werden jetzt noch bei den Hunden angetroffen und nicht mehr bei den Priestern, Brāhmanen. Einst ist der Priester nur zur Frau aus dem Priesterstande gegangen, heute geht er zu der und zu jener; der Hund aber geht nur zur Hündin. Einst ist der Priester zu seiner Frau nur während der Zeit gegangen, heute geht er während der Zeit und außer der Zeit; der Hund aber geht zur Hündin nur während der Zeit. Einst hat der Priester seine Frau weder gekauft noch verkauft, aus Liebe haben sie sich gefunden um einträchtig miteinander zu leben: heute kauft und verkauft er sie und lebt auch aus Liebe mit ihr; der Hund aber kauft und verkauft keine Hündin, lebt nur aus Liebe mit ihr. Einst hat der Priester keine Schätze angehäuft von Geld und Gut, Silber und Gold, heute häuft er sie an; der Hund aber sammelt keine Schätze von Geld und Gut, Silber und Gold. Einst hat der Priester Abends um das Abendmahl und Morgens um den Morgenimbiß seinen Bittgang angetreten: heute essen sie bis sie satt geworden sind und nehmen den Rest mit; der Hund aber tritt Abends um das Abendmahl und Morgens um den Morgenimbiß seinen Bittgang an. Das sind fünf Priestersatzungen der Vorzeit, die jetzt nur mehr bei den Hunden anzutreffen sind und nicht bei den Priestern. – Schärferen Witz hat auch der Fürst der Kyniker, 150 Jahre später, nicht gebraucht. Der Hund, Indern wie Griechen, ja weit mehr verächtlich, als Lehrmeister der Priesterkaste: dieser Gipfel der Parodie beschattet die unversöhnliche Gegnerschaft der Vedāntisten und anderer Doktrinäre, die bekanntlich in ihren āstras Gotamo für einen unsinnigen Verführer und verruchten Verderber der Menschheit erklärt haben. Durch jene Vergleichung wird übrigens der den Priestern so widerwärtige Hund von Gotamo in berechtigten Schutz genommen, nach einer Empfindung, die zeitlos gültig und von SCHOPENHAUER gegen GOETHE so ausgesprochen ist:
Wundern darf es mich nicht, daß manche die Hunde verleumden:
Denn es beschämet zu oft leider den Menschen der Hund.
Auch wäre es, wie so oft bei Gotamo, gar nicht unmöglich, daß zugleich eine tiefere Auslegung zulässig sei, die, sonderbar genug, wieder im Geiste SCHOPENHAUERS ihr Echo hat, Neue Paralipomena, ed. GRISEBACH § 179: »Wenn die Natur den letzten Schritt bis zum Menschen, statt vom Affen aus, vom Hunde oder vom Elefanten aus, genommen hätte; wie ganz anders wäre da der Mensch. Er wäre ein vernünftiger Elefant, oder vernünftiger Hund, statt daß er jetzt ein vernünftiger Affe ist. Sie nahm ihn vom Affen aus, weil es der kürzeste war; aber durch eine kleine Änderung ihres früheren Ganges wäre er von einer anderen Stelle aus kürzer geworden.« In diesem Zusammenhange dürfen denn wohl noch SWIFTS Houyhnhnms angeschlossen werden, aus dem letzten Teile der Reisen Lemuel Gullivers.
[726] 618 Vergl. Lieder der Mönche v. 552; Mahābhāratam XIV 44 20b: jātasya maraṇaṃ dhruvam. – MANILIUS Astronom. IV 16 (bei MONTAIGNE in der Commentatio mortis I 19 nach CICERO, bez. PLATON reichlich ausgeführt), hat den verwandten Vers:
Nascentes morimur, finisque ab origine pendet.
Man gedenkt hier gern jener Mittöne auf griechischen Grabinschriften, die oft so vielsagend innig ansprechen; wie es z.B. auf der Stele eines jungen Mannes, beim Kallikule-Turm in Saloniki, heißt:
Αλλ' ολιγον βιοτου φαος ειδειν ... αρτι δ'υπ' Αδην
κειμαι, μητε καλων μητε κακων μετοχος.
Nach einem Abklatsch von HADJI-THOMAS veröffentlicht von DUCHESNE und BAYET im Mémoire sur une mission au mont Athos, Paris 1876, p. 36-38. Vergl. noch oben Anm. 332, wo weitere bedeutende römische Sprüche stehn, ebenso rein indo-europäischen Geistes. Als Ritornell, wie oben, kehrt unser Vers vielleicht am getreuesten bei MICHELANGELO wieder, in einer seiner Dichtungen zwischen 1512-1534, ed. FREY No. CXXXVI:
Chiunche nasce a morte arriva.
Auf dem schwarzen Marmorstein in der Westminster Abtei aus dem Jahr 1689 richtet APHARA BEHN, die schöne und geistvolle Freundin eines POPE und DRYDEN, sich selbst verlächelnd, ein gleiches Abschiedswort an den Wanderer, köstlich bescheiden:
Here lyes a proof that wit can never be
Defence enough against Mortality.
Volkstümlich gewendet hat ABRAHAM A SANCTA CLARA vortrefflich gesagt: ›Vix orimur morimur – unser erster Lebens-Athem ist schon ein Seufftzer zum Todt.‹ Und hat es alsbald ganz govindisch erklärt: ›Wann sterben, ist nicht gewisz; wie sterben, ist nicht gewisz; wo sterben, ist nicht gewisz; aber sterben ist gewisz.‹ Der kaiserliche Hofprediger und Barfüßer ist mit dem königlichen Hofpriester und Asketen darin einig.
619 Vergl. Bruchstücke der Reden v. 424 nebst Anm.; wo auch das analoge Wort des DIOGENES gegeben ist, jener berühmte Ausspruch, den kein Geringerer als unser Meister ECKHART so anschaulich nacherzählt hat, ed. PFEIFFER p. 576: »Darum sprach Der, der nackt in der Kufe saß, zum großen Alexander, der alle Welt unter sich hatte, ›Ich bin‹ sagt' er, ›viel ein größerer Herr als du bist: denn ich habe mehr verschmäht als du besessen hast; was du groß achtest zu besitzen, das ist mir zu klein zu verschmähen.‹«
620 sakāni vā ñatikulāni gacchantu aññaṃ vā bhat tāram pariyesantu mit S. Diese altvedische weitherzige Auffassung ist noch bei Manus IX 76 deutlich zu erkennen.
621 mayam pi bho agārasmā mit S.
622 Mit S und C sa-udrayā zu lesen, wie Saṃyuttakanikāyo vol. II p. 29, Majjhimanikāyo I p. 271: nicht irrtümlich, wie TRENCKNER p. 552 meint, sondern richtig mit dukkhudrayādi abzuleiten, und zwar von īr īrte + ud; während die siṇhalesische Variante uddayā unzutreffend auf dṛṇāti verweist, im Anguttaranikāyo ed. MORRIS I p. 97, n.
623 Mit S zu lesen sāsanam ājānanti, te pañcannam. Nach jener Welt, das heißt: sie gelangen, erst nachdem der letzte Daseinshang jenseits hinweggeschwunden ist, zur [727] restlosen Auflösung, zur Erlöschung, als jene Reinen Götter oder urständigen Wesenheiten, die in Anm. 337-338 nach log O zu bestimmen waren. Es sind die selben, von denen es in MERSWINS Buch von den Neun Felsen, ed. SCHMIDT S. 137f., heißt: Sage mir, Herzelieb meins, wie spricht man von diesen Menschen oder wie heißen diese Menschen, die in ihren Ursprung gesehn haben? – Das will ich dir sagen, du sollst wissen, daß diese Menschen ihren Namen verloren haben und sind namenlos worden usw., »dem Meer dieser Welt«, wie MERSWIN statt saṃsāro sagt, S. 71, auf ewig entfahren. Der Cherubinische Wandersmann hat zur Überfahrt dahin das Paßwort angegeben, I 46:
Ich bin ein seligs Ding, mag ich ein Unding sein,
Das allem was da ist nicht kund wird noch gemein.
Von solcher Stätte kann man denn auch das Explicit des vorletzten Kapitels im Frankfurter (gewöhnlich Theologia deutsch genannt) am besten einsehn, wo der Anbeginn, Fortgang und das zu Ende kommen von jenseit aus, nach jener Welt, gezeigt wird, »alsô das dem menschen oder der crêatûr nichtes nicht blîbe. – Und wie es denne furbasz ergienge oder was dâ geoffenbâret wurde oder wie dâ gelebet wurde, dâ singet oder sagt nimant von.«
624 Zu indakhīlam ohacca cf. das uddham āghātanam, Anm. 35; zum Elefanten Mittlere Sammlung Nr. 125. Mit S susū nāgā zu lesen. In Stein seit Sāñci ideal verlebendigt.
625 Braunenthal, d.i. Kapilavatthu, cf. Bruchstücke der Reden Anm. 1012, und OLDENBERG, Buddha 5. Aufl. S. 112. – Der Waldbereich mit den Einsiedlern, auf Bergen weilend, im Gefels, allein wie Löwen, innig eingekehrt, usw., war durch Vermittlung der thebaïdischen Freske auf dem Camposanto zu Pisa GOETHES geistigem Auge bei Darstellung der letzten faustischen Gegend mit Bergschluchten, Wald, Fels, Einöde, den heiligen Anachoreten gebirgauf verteilt, gelagert zwischen Klüften, mit Löwen stumm-freundlich um sie herum, mit den Bäumen, mit den Felsen, mächtig anzuschauen, so getreu aufgegangen, daß er jenes ursprünglich indische Angesicht wirklich als das seine brauchen konnte, das Prototyp erkannt, »diese Gegend« daher vollkommen klar schon zu einer Zeit wiedergesehn hatte, als der gewöhnliche Sterbliche darin nur einen katholischen Mystizismus – sancta proculitas – tadeln zu müssen glaubte. Auf einem ganz anderen, bloß äußeren Wege, bei der Besteigung des einzig großartigen Bernina, wie er ihn nicht mit Unrecht nennt, ist zwanzig Jahre später RICHARD WAGNER zu einem immerhin ähnlich vorausahnenden »erhabenen Eindruck der Heiligkeit der Öde«, unserem obigen Fest im Walde auch seinerseits nahekommend, gelangt, Mein Leben S. 590. Vergl. noch Mittlere Sammlung, Anm. 454. Gerade solche Jünger, wie sie oben gezeigt sind, hat San Francesco sich als Ideal ersehn, als die wahrhaften heiligen Brüder, Kämpfer und Ritter seiner Tafelrunde gekennzeichnet mit den Worten: »Isti sunt mei fratres, milites tabulae rotundae, qui latitant in remotis et in desertis locis, ut diligentius vacent orationi et meditationi«: Documenta antiqua Franciscana, ed. LEMMENS pars I, Quaracchi 1901 p. 90. – Der als bald folgende Hymnus selbst, in seiner übergöttlichen Festpracht, ist ein frühpurāṇischer, gotamidisch abgetönter Nachhall und Nachgesang des gewaltigen Wunderliedes der Atharvasaṃhitā, XI 5, wo all die unermeßlichen Geisterscharen, alle die Götter, ein jeder der Götter, insgesamt mit den Himmelsboten, den dreiunddreißig, dreihundert, sechstausend, im heiligen Pilger einigen Sinnes werden, saṃmanaso bhavanti, ihn zu erschauen zusammenströmen, draṣṭum abhisaṃyanti: denn Er ist ihre Erfüllung, ihre Verwirklichung, in Ihm, dem vorgebornen, pūrvo jātaḥ, ist das höchste Heil und Geheimnis, [728] sind alle Götter mit der Unsterblichkeit beschlossen. Er, der heilige Pilger, brahmacārī, trägt Himmel und Erde, er, in seinem dunklen Wams, hat die Welten in sich zusammengefaßt, aus ihm ist Vergangenheit und Zukunft, Tag und Nacht, Baum und Busch, aus ihm Tier und Mensch und jedwedes Lebendige. Der heilige Pilger ist funkelnder Heiligkeit Gefäß: darin sind die Götter samt und sonders einbezogen. Auf dem Wogenkamme des Ozeans war der heilige Pilger in Glut erglüht: Er, abgespült, bräunlich, rötlich, strahlt weithin über die Erde. – Auch der Titel bhūmidevās, Erdengötter, womit die Priester seit alters in rautam und Smārtam sich selber bezeichnen, deutet ähnliches an; ebenso der bekannte Spruch:
Sarvadevā jine vare:
Das Götterall im Siegerherrn.
Des Meisters Vortrag der obigen Strophen vor den Mönchen bei Braunenthal im Waldbereich war auf einem Hochrelief am Großen Kuppelmal zu Anurādhapuram, schon im 2. Jahrhundert vor Chr., prächtig ausgeführt zu sehn, mit dem gleichen Namen angegeben als Mahāsamayasuttantam, d.h. »Die große Anrede zum Fest« oder »Die große Festansprache«: Mahāvaṃso 30 v. 83. Analog auch in Amarāvatī.
626 Mit S sattarim = sattaram, satvaram.
627 Das Gletscherreich, Himālayo; wörtlich: der Schneebereich, d.i. das Reich des ewigen Eises, als die Heimstätte zauberischer Wesen und ihrer erhaben entzückenden Schönheit in vedischer wie buddhistischer Sage immer gefeiert; später von Kālidāsas im Eingang des Kumārasaṃbhavam so herrlich verklärt, wie es bei uns etwa nur der Manfred BYRONS ähnlich erschaut, in seiner Beschwörung der Alpengeister, gleich am Anfang, wo er sagt:
Mysterious Agency!
Ye spirits of the unbounded Universe!
– – – – – – – ye, to whom the tops
Of mountains inaccessible are haunts,
And earth's an ocean's caves familiar things –.
Da wie dort und bei uns oben kommt also der eröffnende Reigen den Berggeistern aus dem Gletscherreich über Wolken zu.
628 Allfreunde, Vessāmittā, sind Luftgeister, die vom vedischen Seher Vi vāmitras, Allfreund, ihren Namen haben, Aitareyabrāhmaṇam 7 18.
629 Vepull' assa zu lesen. Vepullo pabbato, das Breite Joch, Mittlere Sammlung S. 875; Königsburg ist Rājagaham, einst die Hauptstadt von Magadhā: Das Breite Joch liegt, eine Stunde zu gehn, östlich der Stadt, heißt noch Vipulagiri. Zwei Stunden weiter, immer nach Osten, der berühmte Geierkulm, der Gijjhakūṭo; doppelt so weit dann der Berg bei Giryek mit Indras Felsengrotte, siehe Anm. 645.
630 Inda-nāmā-mahābalā zu lesen: wie Indo (der Götterfürst) von großer Kraft. Eine samāsavyāsakīrtanā oder Synaulie. Der Umstand, warum dieser himmlische Herrscher gleichwie auch die anderen so unermeßlich viel Göttersöhne sich schufen, ist nach dem Urbild im vierten Kapitel des ersten Buches der Bṛhadāraṇyakā zu erklären. Der Weltgeist war anfangs ganz allein und wußte nur ›Das bin ich‹, so 'ham asmi. Da empfand er denn Langeweile, sa vai naiva reme, weil ein Gott, der allein ist, keine Freude hat. So erschuf er nun aus sich selbst alle Wesen und göttlichen Abkommen, Indra-Varuṇa-Soma-Rudra-Parjanya-Yama-Mṛtyur-Ī āna-Vi ve Devās usw., als Göttergestalten in lebendig [729] reicher Schöne zu wirken und zu leben. Der junge SCHILLER hatte unseren vedischen Mythos innig vorausgeahnt, als er sang:
Freundlos war der große Weltenmeister,
Fühlte Mangel – darum schuf er Geister,
Sel'ge Spiegel seiner Seligkeit.
631 Vergl. Anm. 573, auch Bruchstücke der Reden v. 380, wo Vessavaṇo = Kuvero. Er thront im Norden, nämlich am Himālayo, der alle Schätze in sich birgt, als der Füllespender oder indische Plutos. Kuvero oder Kubero ist in Barāhat zu Kupiro geworden, cf. CUNNINGHAMS Stūpa of Bharhut Tafel XXII.
632 Auf die vorgaukelnde Rolle, die der māyā, wörtlich Gemächte, mit ihren Schleierkünsten und Traumspielen zukommt, dem Schein und Schimmer, Blendwerk, Zauberwerk, hat GELDNER in PISCHELS Vedischen Studien II 299 Anm. 3 genau hingewiesen, bei der Erklärung und Übersetzung des ṛgvedischen Itihāsaliedes X 124. Unsere obige Strophe ist eigentlich nur dann durchaus verständlich, wenn sie als Blättergezweig erkannt wird, hervorgewachsen aus dem uralten Stamme des Itihāsapurāṇam, des fünften Vedas, wie GELDNER 1. c. I 259 treffend sagt, ganz entsprechend dem Itihāsapañcamam, das bei uns zu Beginn der 91. Rede der Mittleren Sammlung, der 3. Rede unserer Sammlung und auch sonst immer bei der Aufzählung vedischer Kunde und Wissenschaft überliefert wird, im schönsten Einklang mit dem Itihāsapurāṇam pañcamam der Chāndogyopaniṣat VII 1 2. Zur näheren Untersuchung Bruchstücke der Reden Anm. 5475. – Als Beispiel wie spätere Zeiten den Begriff der māyā farbig zu wenden wußten, folge hier eine Probe aus dem Viṣṇupurāṇam, V 30, in A. PAULS Übertragung »Krischnas Weltengang« S. 103f. Aditi, die Unendlichkeit als göttliche Mutter, spricht zu Kṛṣṇas dem Allerhalter: »Heil dir, du Gott mit den Lotusaugen, der du alle Furcht entfernst von denen, die dir dienen, der du frei bist vom Wechsel der Geburt und des Todes, des Schlafens und Wachens. Du bist der Abend, die Nacht und der Morgen, Erde, Himmel und Luft, Wasser und Feuer. Du bist alle Götter, Genien und Menschen, du bist alle Tiere, Bäume und Gräser: alles Große, Mittlere und Kleine, alles Ungeheure und Winzige, alles Einfache und alles Zusammengesetzte. In Trug hüllst du die ein, welche deine wahre Art nicht kennen, die Toren, wenn sie im Wesenlosen das Wesen suchen. Die Vorstellung ›Ich bin‹ und ›Das gehört mir‹, die hier die Men schen bewegt, sind trügerischer Schein, den die Mutter des Wandeldaseins im Vereine mit dir, o Herr, hervorbringt. Die tüchtig sind und dich verehren, gelangen über diesen Trug hinweg und finden Freiheit im Herzen. Brahmā und alle Götter, Menschen und Tiere sind insgesamt einzeln in das dichte Dunkel des Wahns getaucht, in den Abgrund deiner Täuschungen. Daß einer, der dich verehrt, doch Wünsche hegt und am Leben hängt, auch das, o Herr, ist nur ein Trugbild, von dir geschaffen. Du spielst mit deinem Zauber und verführst die Menschen, daß sie, dich verehrend, Ruhm und Nachkommen und Vernichtung der Feinde begehren statt ewiger Erlösung. Es ist die Folge ihrer falschen Taten, daß Toren dich um Solches anflehn, gleichwie als ob man, um seine Blöße zu bedecken, den Wunschbaum, der alles gewährt, um einen Fetzen Tuch anflehte! Sei gnädig, Unvergänglicher, du Urgrund des Irrtums, der die Welt einhüllt! Zerstöre den Trug, der sich aus der Wahrheit [730] erhoben hat. Heil dir, die ich dich in deinem Waffenglanze sehe und wahrnehme, und die ich dich nicht wahrnehme, wo du über aller Wahrnehmung stehst.« Usw. Ich glaube, daß es vielleicht kaum einen besseren Kommentar geben dürfte zur »Scheinsal der Welt«, wie unser MOSCHEROSCH die māyā nennt, und ihrer
Gestaltung, Umgestaltung,
Des ewigen Sinnes ewige Unterhaltung.
Urkundlich ist der oben angedeutete Kult Krischnas als jedenfalls sehr alt seit dem 3. Jahrhundert vor Chr. sichergestellt, da Asoko auf der Weihinschrift von Paḍeria als Geburtstätte Gotamos ein Dorf nennt, das nach einem Tempel der Rukmiṇī, der göttlich verehrten Gattin Krischnas, betitelt war und heute noch Rummin-deī heißt. Die Vorfahren und Zeitgenossen Gotamo haben also ohne Zweifel diesem Heros und seinem Kreise gehuldigt. Vergl. Epigraphia Indica V 4, Bruchstücke der Reden Anm. 683, Krischnas Weltengang S. 6-7 der Vorrede. Der alte Götterhain mit den Trümmern von Tempel und Säule und der Inschrift ist abgebildet auf Tafel I-III der Beigaben zu den Letzten Tagen Gotamo Buddhos, (1. Aufl.), München 1911. Auch Gotamo selbst hat über die Krischnasage, und zwar in fein scherzhafter Weise, gesprochen, in der berühmten Rede mit Ambaṭṭho, als dieser voll Stolz mit den Worten sich vorstellt: »Ich bin aus Kaṇhos (Kṛṣṇas) Geschlecht«, 3. Rede S. 61.
633 Zu Panādo, dem Elfenkönig etc., cf. Lieder der Mönche v. 163f. und Anm.; über den Baumgott, Timbaru, usw. später in der Anm. 651 mehr. Mātali, der göttliche Kutscher, Mittlere Sammlung 627f.
634 Das Stromgebiet ist Ort und Landschaft der Einmündung von Ganges und Yamunā, die heiligste Stätte der Welt, nach altvedischer Anschauung: siehe vorher, bei der 19. Rede, S. 339 u. Anm. 598. Die Gewässer der Gangā gelten bekanntlich auch darum so wunderkräftig, weil ihre Flut und Quelle nach der Smṛti, wie Ramāyaṇam I Kap. 44, ihren übernatürlichen Ursprung im Himmel hat, woher sie zuerst durch den Raum fließend als die Milchstraße dahinzieht, dann durch der Lüfte Reich hoch über dem Himālayo auf den Kailāsagipfel mit ungeheuerem Schwalle sich herabstürzt, und endlich in ihrer dritten und letzten Gestalt durch die Ebene gelassen breithin strömend in den Ozean sich ergießt, überall von göttlichen Sehern und Fürsten, glitzernden Geistern und Genien, Nixen und Schlangen, Delphinen und Fischen und Schwänen usw. begleitet, in himmlischer Segensfülle. Den Ursprung dieser lebenspendenden Gewässer als die Milchstraße anzusehn hat nach einem Doppeljahrtausend ein merkwürdiges Spiegelbild bei JEAN PAUL gefunden, in seinem Ausspruch, der gestirnte weite Himmel sei gleichsam der Anfangbuchstabe unseres Seins, Palingenesien I gegen Ende: womit auch nach innen, ebenso erstaunlich, das Oṃ vollkommen getreu wiedererschollen ist, die von hier aus umfassende Silbe des Puruṣas oder Welt- und Urgeists. Vergl. Anm. 27. – All dies ist in der obigen Strophe angedeutet, war dem Hörer damals auch unerklärt offenbar, eine arthavyakti, nach BÜHLERS sehr lehrreichen, hierhergehörigen Bemerkungen über das sogar unter dem Volke ganz allgemeine Verständnis von solchen kurzen, bloß kennzeichnenden Stempeln und Sprüchen, Worten und Winken: s. Sitzungsber. phil.-hist. Kl. der Kais. Ak. d. Wissensch. zu Wien 1890, Bd. 122 No. 11 S. 60-62. Eine schöne Übersetzung von der Herabkunft der Gangā hat A. w. VON SCHLEGEL in seiner Indischen Bibliothek erscheinen lassen, 1. Band, 1. Heft, Bonn 1820, S. 50-79; latein in der Textausgabe, Bonn 1838.
635 Die Bändigung des Grimmen Flegels, Vepaciti, der typischen Dämonengestalt dieser ganzen Klasse von Geistern durch Sakko den Götterkönig vollbracht, ist in [731] einer Legende des Saṃyuttakanikāyo (vol. IV p. 201/2) wundersam tief ausgelegt (wiedergegeben Bruchstücke der Reden Anm. 588): ein Musterbeispiel dafür, wie Gotamo altüberlieferte Sagen zu verwerten wußte. – Vepaciti, viprakāre, ist Bezeichnung und Gattungname für Lümmel, Bengel, Polterer. Kurz und bündig sagt es zugleich dem indischen Zartsinn so viel als uns etwa das bekannte Verslein des nordnordwest-vepacitisch immer beflegelten JEAN JACQUES:
C'est la politesse d'un Suisse
En Hollande civilisé.
Der Ahnherr ist Vipracit, von dem auch der Unholde Oberfürst, der Mondverfinsterer Rāhu, abstammt. Zur Sache: Bruchstücke der Reden Anm. 465.
636 Das Zwillingspaar ist Yamo und Yamī, das typische erste Menschenpaar im Vedas, und daher die ersten Himmelsbewohner, bez. Himmelsfürsten nach dem Tode, in Gemeinschaft mit den lichten Göttern – zugleich aber der Mond mit seinem immer wechselnden und immer wiederkehrenden Anblick, bald im Reich der Schatten, bald im Reich der Lebendigen, im bräutlichen Bunde mit der Sonnenjungfrau, in solchem Strahlenglanz vereint, in Konjunktion mit der jungen Sonne, der typischen Braut auch des indischen Volkes, wie LEOPOLD VON SCHRÖDER, diesen uralten Mythos erklärend, abschließt: Die Vollendung des arischen Mysteriums in Bayreuth, München 1911, S. 113. Ich freue mich hier beiläufig bemerken zu können, daß der feinsinnige Forscher in diesem prächtigen und überschwenglich reichen Werke zu einer durch den Titel schon angedeuteten eigenen Ansicht von dem gelangt ist, was ich bereits vor zwei Jahrzehnten in meinen Erläuterungen zum Wahrheitpfad, Leipzig 1893, S. 156 vorgetragen hatte; wenn auch mit etwas weniger Begeisterung für Bayreuther Donquijoterie, so doch mit derselben begründenden Hauptstelle vom Schlusse der Götterdämmerung, nämlich dem Scheidegruß der endenden Brünnhilde, mit welchem sie, rein buddhistisch redend, oder »die der höchsten Erkenntnis entsprechendste Sprache«, wie RICHARD WAGNER selbst es einst gleichgesetzt hat (cf. Lieder der Mönche S. 275), Wahnheim den Rücken kehrt, da sie alles Ewigen seliges Ende gewonnen, in der Gewißheit: nicht mehr ist diese Welt.
637 Der Mauernstürzer, purindado, ist natürlich auch hier, der Ṛksaṃhitā entsprechend, s.v.a. der Zerstörer der Wolkenburgen: Sakko spaltet sie mit seinem Donnerkeil, befreit die gefangenen Wolkenkühe, so daß diese nun hervorströmen und die erquickende Regenmilch über die Erde ergießen. So z.B. im 89. Hymnus des letzten Buchs: bibheda giriṃ etc. Vergl. MACDONELL, Vedic Mythology, BÜHLERS Grundriß III 1 A 60; 98. Diese Eigenschaft als Kämpfer, Schützer und Wohltäter kommt ihm auch anderweitig bei uns noch durchaus zu; s. vorher Anm. 636.
638 Meergeister, Varuṇiden, die indischen Okeaniden, sind ähnlich aus späteren Jainalegenden erinnerlich: vergl. etwa den sonnenstrahlglitzernden Meergott im Jagaḍūcaritam, ed. BÜHLER III 47, wie er als Susthitāmaro bhāsuradyutiḥ erscheint, und segenspendender Schirmherr. Der aber steht ohne Zweifel in einem unterseeischen verwandtschaftlichen Grade zu Nereus: nach den auch hier zuverlässigen Chronicques des ancestres, im RABELAIS, die manch besseren Aufschluß geben als die folkloristische Sagenvergleichung und daher gelegentlich einmal befragt werden dürfen, ist er nämlich der grand pere du beau cousin de la sœur aisnee de la tante du gendre de l'oncle de la bruz de sa belle mere, d.h. Proteus. Strenge Momologen oder auch Schöngeister wird eine solche Genealogie freilich wenig befriedigen, so passend auch hic posuisse gaudet.
[732] 639 mānusā mānusuttamā, Menschen-, Menschenüberart; zu Lustig im Dämmerlicht usw. cf. die Stellennachweise im Register. Die alsbald nachdonnernde Strophe vom Regengotte, thanayam āgu Pajjunno yo disā abhivassati, ist ein wörtlicher Widerhall aus dem Lied auf Parjanyas nach der Ṛksaṃhitā V 83 6: arvān etena stanayitnunehyapo niṣiṃcannasurādi.
640 Jene seligen Scharen erscheinen im 2. Teil der 11. Rede 153-155. Sie sind auch von der heiligen Justina im Mágico prodigioso, gegen Ende, in einer inneren Fülle der Gesichte nach ihrem fernsten Grunde gleichnisweise dahin gedeutet, que no tiene tantas estrellas el cielo, tantas arenas el mar, tantas centellas el fuego, tantos átomos el dia: daß der Himmel nicht soviel Sterne, das Meer nicht soviel Sand, das Feuer nicht soviel Funken, der Tag nicht soviel Sonnenstäubchen enthalte, als nämlich im Erlöser und Ursprung der Gnade aller Wahn aufgelöst werde. In solchem Anblick aber kommen auch jene unermeßlichen Scharen der entrückten und der noch wahnbeglückten Geister zum Fest im Walde mit herangeschwebt, um huldigend Einkehr zu finden. Eine vollkommene Bestätigung und weitere Vertiefung dieses Gedankens gibt mit jeder nur möglichen Klarheit das Ende der 147. Rede der Mittleren Sammlung Anm. 529 letzter Absatz. Vergl. noch ibid. S. 731 und unsere Sammlung S. 79 die verwandte Stelle von den vielen tausend Gottheiten, die beim Asketen Gotamo zeitlebens Zuflucht genommen haben; ferner auch unsere Anm. 339.
641 Der Ewige Jüngling, Sanankumāro, wurde in Anm. 581 betrachtet, der Pfeilschütz, Tisso, ist zugleich das bekannte Sternbild, schon in der Ṛksaṃhitā V 54 13 verehrt. Manche halten ihn für Sirius. Die tausend Brahmahimmel sind später zumal im Liede des Herrn, wie die Bhagavadgītā richtig heißt, im 11. Abschnitt näher bezeichnet. In »Krischnas Weltengang« S. 120ff. findet man einen guten Auszug. »Als ob am Himmel«, sagt da der Seher, »tausend Sonnen zu gleicher Zeit aufgingen, also ging da ein Strahlenglanz von dem hohen Geiste aus« usw. Und alsdann:
»In bunten Farben strahlst du bis zum Himmel,
Dein weiter Blick entzündet alles um dich:
Entsetzen faßt mich an vor deinem Anblick,
Nicht Raum und Ruhe find' ich Fuß zu fassen.
Gesichter seh' ich strahlen ungeheuer,
Dem Feuer gleich, das einst die Welten aufzehrt.«
usw., usw.
Unsere obigen Strophen stellen, wie die ziemlich gegenüberstehenden der älteren Upanischaden, einen schlichteren Ausdruck dar. Eine ähnliche Einteilung der Lichtgestalten in göttliche Lichtquellen kennen die Jainās. Sie heißen dort Jyotiṣkās, die Leuchtenden, und sind: der Mond, die Sonne, die Planeten, die Sternbilder und die Fixsterne: joisiyā pañcavihā, die fünf Arten der Lichtträger. Diese Anschauungen sind kurz und übersichtlich vorgeführt im Jīvaviyāro des Santisūri, sozusagen einem Leitfaden zur Einführung in das Verständnis der metaphysischen Anfangskunde auf der Grenzlinie des Naturerkennens, wie es bei den Jainās noch heute gepflegt wird. Eine vorzügliche Ausgabe mit Kommentar und Übersetzung hat GUÉRINOT veröffentlicht, im Journal asiatique 1902, p. 231-288. – Die Summe der nun alsbald vollzählig versammelten Geisterscharen dürfte jene andere wohl noch weit übertreffen, die SEUSE als die zehntausendmal hunderttausend grüßenden und lobsingenden himmlischen Geister angibt, im Büchlein der Ewigen Weisheit gegen Ende des 2. Teils; lauter Gestalten und Hypostasen, die dem echten Jüngerasketen schon so durchsichtig wurden [733] wie etwa unserem ANTONIUS von Padua sogar das allerheiligste Sakrament: denn als er vor seinem Ende sah, wie einer der Brüder ihm die letzte Ölung herbeibrachte, sagte er lächelnd zu ihm: »Damit bin ich schon innen gesalbt«: Vita S. ANTONII cap. XXIV, ed. DE LA HAYE fol. 17 a. Wir gewahren hier den unermüdlich erfahrenen Kämpfer und Nachfolger San Francescos zuletzt mit seiner Erkenntnis dahingedrungen, wo wir Gotamo längst angelangt sahn, den Mönch aufweisend als abgespült und »gebadet im inneren Bade«, Mittlere Sammlung 42; vergl. oben noch Anm. 598 am Anfang.
642 Vergl. mahānādair utkṛṣṭatalanāditais in der Smṛti, BÖHTLINGK s.v. talam. Eine Anrufung der unterirdischen Mächte wie bei den Griechen, z.B. Ilias IX 568/9:
πολλα δε και γαιαν πολυφορβην χερσιν αλοια
κικλησκουσ' Αιδην και επαινην Περσεφονειαν –,
eine Gepflogenheit oder crambe repetita venefica, die sich bis heute erhalten hat, nach SAMTER, Geburt, Hochzeit und Tod, Leipzig 1910, Kap. 1: »Griechische Weiber schlagen im höchsten Zorne, indem sie ihren Feinden alles Böse anwünschen, mit der flachen Hand wütend die Erde.« Entgegengesetzt ist das sanfte Streichen über die Erde, Ende der 21. Rede, zur Allversöhnung. Der ohnmächtige wilde Rückzug des Bösen in der folgenden Strophe erscheint beim ägyptischen MAKARIOS wie von uns überkommen, fein indisch, ja gotamidisch verstanden, bestätigt: Και εισιν αλλοι λογισμοι και νοηματα, μη κατεχομενοι ὑπο του σατανα, Homil. XXVI, ed. PRITIUS 1714 p. 347.
643 Die Schlüssel, die den Riegel heben und in das Reich sämtlicher oben aufgestellten irdischen und überirdischen Wesen führen sollen, werden uns in den himmlischen Zahlen dargeboten, die zu Beginn des 9. Kapitels im 3. Buche der Bṛhadāraṇyakopaniṣat vorgetragen sind, wo Yājñavalkyas dem ākalyas auf dessen Frage, wieviel Götter es gebe, zuerst antwortet 303 und 3003, auf weitere Fragen aber erklärt, daß es nur 33 Götter gebe, und daß die 303 und die 3003 bloß die Potenzen, mahimānas, jener 33 seien, und diese selbst endlich in das einige brahma mit dem Namen tyat, DAS, auflöst: eine Auflösung, die von Gotamo, gleich in der ersten Rede der Mittleren Sammlung, glücklich bis zum Durchstechen des Vexierrings der Null gebracht und vollendet wurde. Vergl. noch Bruchstücke der Reden v. 656 und Anm.; ja schon das altberühmte Lied an Skambhas, den Pfeiler der Welt, in dessen einem Stückchen die dreiunddreißig Götter alle vereint sind, yasya trayastriṃ addevā ange sarve samāhitāh, nach der Atharvasaṃhitā X 7 13, mit der Erklärung und Versinnbildlichung hierzu in der wundervollen Stelle am Ende des 6. Stückes der Tripādvibhūtimahānārāyaṇopaniṣat, Mittlere Sammlung Anm. 460 übersetzt. Ebenda noch ein anderer vedischer Beleg, sowie Hinweise auf ECKHART. – Einem gleichen Gedanken hat Asoko Ausdruck gegeben, auf dem Edikt von Sahasarām Zeile 2-3, Bairāt Z. 4, Rūpnāth Z. 2, wo er sagt, daß er den Menschen in Indien – der politisch umfassende Begriff Indien, Jambudīpo, erscheint hier zum erstenmal – die bisher keine falschen Götter zu haben meinten, sie nun als falsche Götter erwiesen habe: Etena ca aṃtalena Jaṃbudīpasi aṃmisaṃdevā saṃtā munisā, misaṃdevakaṭā. Der damals von den Lesern und Hörern dieser wohlbekannten königlichen Botschaft sogleich von selbst ergänzte Folgesatz war natürlich der, daß Asoko das Göttliche nur im heiligen Wandel des Asketen erkennen und anerkennen mochte: wie dies Mittlere Sammlung Anm. 307 bei Besprechung und Vergleichung dieser Inschrift des näheren nachgewiesen ist. Die kürzlich von E. HULTZSCH, S. LÉVI und T.K. LADDU im Journal of the Royal Asiatic Society 1911 S. 1114-1119 versuchte und im Journal asiatique 1911 S. 123-125 vom zweiten verflixt originell vorgeschlagene [734] Erklärung des misa als mi ra scheint mir nicht annehmbar, da misa durchaus regelrecht für mṛṣa steht, nach der lautgesetzlichen Folge kṛ a-kisādi; abgesehn von der ganz unmöglichen Syllepsis, die bei jener Unterschiebung dem König in den Mund gelegt würde. Man beachte auch unsere 16. Rede, oben S. 243 nebst Anm. 379 über den Kernspruch von der heiligsten Stätte der Welt: lauter Dinge, die dem König sicher bekannt waren, da er ja gerade auf sie anspielt.
Diese Anschauung und Lehre, ursprünglich vom vedischen Tat tvam asi ausgegangen, ist späterhin auf dem syrisch-alexandrinischen Weg ins Abendland gedrungen und wurde zumal von AMMONIOS SAKKAS, nachdem er sich vom Christentum losgemacht hatte, im Geiste PLATONS ausgebildet und vorgetragen: mit solcher Wirkung, daß PLOTINOS ebendiese von ihm gehörte Lehre dann als einzigen Inhalt seiner unerschöpflichen Enneaden dargeboten hat. Eine kurze Übersicht der Hauptstellen, mit Berücksichtigung der historischen Mittelglieder, hat SCHOPENHAUER in den Parerga gegeben, § 7 der Fragmente zur Geschichte der Philosophie. Als ein besonders gelungener Stempel PLOTINS, der unseren obigen Text mit sämtlichen Einzelfolgerungen gleichsam in ein Monogramm verjüngt, sei hier noch das Wort angeschlossen vom Ende des 1. Stücks des 5. Buchs der 6. Enneas, in der mir vorliegenden Basler Ausgabe von 1580 fol. 660 i.f. 'Εν αρα παντα τα οντα: Eins also sind alle die Wesen.
645 yadi hi pana mit S. – Der Berg mit der Grotte, später Indra ailaguhā, Indras Felsengrotte, geheißen, liegt etwa 10 km östlich von Rājagaham. Das Dorf, das sich noch heute talwärts am Fuße hinstreckt, mit zahlreichen Steinresten aus der Vergangenheit, recht wie RUISDAELS Kloster anzuschauen, wird nun Giryek genannt. Eine ausgezeichnete topographische Aufnahme der auch landschaftlich ungemein interessanten Hügelketten von Rājgir bis Giryek nebst den Flüssen, Bächen, Teichen, Denkmalen, Orten und Wegen hat CUNNINGHAM ausgearbeitet, Archaeological Survey of India vol. I, Simla 1871, Tafel XIV. Zu den Zeiten FA-HIANS und HIUEN-TSIANGS war an Stelle unserer nicht mehr verstandenen Indra ālaguhā längst schon die an sich ja immerhin gute Bezeichnung o aila-, ilā-, ilaguhā vom Volke vorgezogen worden: unter diesem Namen, eben als Indras Felsengrotte, ist der Ort über ganz China und Japan bis zur Gegenwart dauernd berühmt geblieben. Vergl. EITELS Hand-Book of Chinese Buddhism, London 1888, s.v. Indra ailaguhā. Nach einem ursprünglichen Indasālo aber, einem Gipfelbaume, der weithin über die Lande sichtbar ist, wird wohl schon seit alter Sagenzeit der ungeheuere Rosenapfelbaum auf der Spitze des Meru zur Standarte Indiens geworden sein, die Jambu von Jambudīpo: wie die Sonne über dem Himālayo, am Kulm des Meru steht, Merustha iva bhāskaraḥ, 127 37 yuddhakāṇḍe Rāmāyaṇe.
Der alsbald nun geschilderte helle Abglanz auf dem Bergesgipfel bei der Ankunft der Dreiunddreißig ist in gleicher Pracht von BYRON bemerkt worden, Ende der ersten Szene von Heaven and Earth, als die Himmelsboten bei Nacht sich herabsenken:
Lo! they have kindled all the west,
Like a returning sunset; – lo!
On Ararat's late secret crest
A mild and many-colour'd bow,
The remnant of their flashing path,
Now shines! –
[735] Man sieht hier von ferne schon jenes Gleichnis herüberleuchten, worin NIETZSCHE gar fein buddhistische Art beschreibt als »geistige Glorie und Sonnenuntergangsglut«.
646 saddañ ca me sossati mit S.
647 ovīṇam ādāya assāvesi mit S. Das naccāsanne etc. ebenso taktvoll bei den Jainās naccāsaṇṇe etc., Aupapātikasūtram p. 50. – Nicht unähnlich weiß CELANO vom Besuch eines Himmelsboten mit der Laute bei San Francesco zu erzählen, Vita II cap. LXVI. Als der Heilige einst im Gebirge bei Rieti, Perugia, weilte, und leidend war, hätte er gerne Musik gehört, um dem »Bruder Körper«, wie er seinen Leib nannte, der voller Schmerzen war, etwas Erleichterung zu schaffen. Doch fand sich niemand bereit. Bei Anbruch der Nacht nun, heißt es weiter bei CELANO, der ja selber zugegen war, »repente insonat cithara quaedam armoniae mirabilis, et suavissimae melodiae. Non videbatur aliquis, sed transitum et reditum citharedi ipsa hinc inde auditus volubilitas innuebat.« Die wundersame Begebenheit läuft demnach den äußeren Umständen fein parallel: ohne Anspruch, natürlich, auf diatonische Gleichheit, bei leichter elliptischer Auflösung.
648 sedataṃ mit S, wie arahatam.
649 Sālaṃ vanaṃ zu lesen und am besten yassās' etādisī pajā. – Die Szene des Himmelsboten mit der Laute vor dem Meister in der Grotte, mit dem huldigend wartenden Götterkönig und seinem Gefolge im Hintergrund, ist von der bildenden Kunst bald nach Asoko sehr oft im Relief dargestellt worden, so auf den Kuppelmalen von Sāñci, Barāhat, Buddhagayā, Mathurā, später im Norden des Swātgebietes, Sikri, Loriyān Tangai, desgleichen auf Zeilon in Anurādhapuram usw. Über ein Dutzend Nachweise nebst Phototypien bei FOUCHER, Journal asiatique, Sept. 1903 p. 210, sowie in desselben Forschers Art gréco-bouddhique du Gandhâra, Paris 1905, p. 492 bis 497; vergl. auch GRÜNWEDEL-BURGESS, Buddhist Art in India, London 1901, p. 141f. Zumal das Relief von Sikri zeigt gute Arbeit und echt indische feine Behandlung; man beachte genau den halb abgewandt sitzenden Meister mit dem eben noch merkbaren allverstehenden Lächeln um Augen und Mund, das der oben bei uns alsbald erfolgenden Antwort vorspielt und diese schon innig andeutend illustriert: ein Muster von jenem, uns freilich nicht allzu leicht wahrnehmbaren, zarten Humor der Zeit.
650 Mit S zu lesen n'eva pana te Pañcasikha tantissaro gītassaram ativattati, na gītassaros ca tantissaram. – Saṃyūḷhā = saṃnyūḍhās, saññūḷhā; cf. saṃnyāsī, saññāsī.
651 So mit S, C etc. Zu ikhaṇḍī cf. Sāmavidhānabrāhmaṇam 8 2 ikhaṇḍinī mit der Erklärung ikhaṇḍaḥ ke apā aḥ; etc. – Timbaru ist oben s.v.a. der Baumgott schlechthin: vergl. Timbaruko, Der vom Timbaru-Baume, auch als Name eines bekannten Pilgers überliefert: Saṃyuttakanikāyo vol. II p. 22. Bei den Jainās dafür Tumbaras: cf. WEBERS Ausgabe des Pañcadaṇḍachattraprabandhas p. 18, in den Abhandl. der Königl. Akademie der Wissensch. zu Berlin 1877. Ursprünglich geht nämlich, der Sage nach, diese Bezeichnung auf Tumburus zurück, der eben zugleich unser Fürst der Himmelsboten und der vorzüglichste Musiker ist, gandharvas Tumburu reṣṭhas, wie er im Bhāratam etc. heißt. Wie berühmt seine göttliche Musik gewesen sein muß, erhellt auch später noch recht schön aus Hariṣeṇas Preislied auf König Samudraguptas, aus dem 4. Jahrhundert nach Chr., worin der Hofdichter den Herrscher prächtig besingt und von ihm sagt, daß er sogar Tumburus durch sein wonnesames Spiel, seine holdseligen Weisen, gāndharvalālitais, beschämt habe, Zeile 27 der Inschrift auf der Säule von Allahābād, in FLEETS Gupta Inscriptions, Corpus Inscriptionum Indicarum vol. III (Kalkutta [736] 1888) p. 6-8; vergl. BÜHLERS Erläuterungen hierzu Sitzungsber. der phil.-hist. Kl. der kais. Akad. der Wissensch. (Wien 1890) Bd. 122 Nr. 11 S. 42 u. 90. Ob nun etwa der König den göttlichen Künstler im Spiel wirklich übertroffen haben wird, ist fraglich: sicher hat er selbst sich für einen bedeutenden Musiker gehalten, da er Münzen prägen ließ mit seinem Bildnis als Lautenspieler, unbeschadet seines echten, über jeden Zweifel erhabenen Ruhms als Eroberer und Beherrscher eines Weltreichs. Nichts aber zeigt schlagender die seit den ältesten Zeiten bis zur Gegenwart andauernde Wertschätzung der Musik als der schmucklose zahlenmäßige Nachweis, daß auf je ungefähr vierhundert Leute immer ein ausgebildeter Musiker kommt, d.h. daß es jetzt 782500 Barden, Sänger, Flöten- und Lautenspieler usw. – lauter Fachkünstler, nicht etwa Dilettanten – gibt, bei einer Bevölkerung von 282832000 Menschen, nach Sir ATHELSTANE BAINES, der in BÜHLERS Grundriß II 5 »Ethnography« § 54, Straßburg 1912, die Daten auf Grund genauester Landeskenntnis zusammengestellt hat und dabei die ununterbrochen lebendige Linie all dieser oft hochbegabten Musikerkasten bis in die Vorzeit hinauf verfolgt. Die indischen Rassen und Stämme, unendlich und unbeschreiblich verschieden im einzelnen, sind einig als das rhythmische Volk schlechthin, vom Oṃ oder Urton der vedischen Seher angefangen bis zum letzten Bayaderengruß herab. Für den Inder gibt es kein Leben ohne Rhythmus, und Melodie und Dasein sind Wechselbegriffe. Daher mag denn erst der Überwinder, der weltentlebte Heilige, Lieder der Mönche v. 1071, von sich sagen:
Sogar Musik im Fünferspiel
Beseligt mir nicht so den Sinn
Wie klar vollbrachte Wissenschaft
Der Wahrheit in der eignen Brust.
Das aber ist die Ausnahme. Wird doch auch ivas der göttliche Asket mit der Laute in der Hand als vīṇāhastas und als Tänzer im Dämmerlicht, saṃdhyānāṭi, gedacht: geschweige daß da die Mehrheit der drei Millionen Pilger, Büßer und Fakire, die es immer noch in Indien gibt, den Klangweisen der Gandharven oder Himmelsboten entsagen wollte.
652 Mit S na vadāmi tato pacchā.
653 Mit S und M evaṃ, sukhī hotu sowie devā manussā asurā etc. Dann: mahesakkhe yakkhe.
654 Mit S visamā santi etc.
655 Kosiyo, von Kusiko, Kusiyo abstammend, wie der Vater Sakkos hieß, der vedische Ku ikas, der Seher, der den Gott zuerst ersehn hatte und alsbald voll Sehnsucht einen Sohn erwünschte, der Sakko gliche: daher denn der Gott selbst ihm als Sohn geboren wurde und seither zugleich Kosiyo genannt, nach Sāyaṇas Kommentar zur Ṛksaṃhitā I 10 11; von KLEMM zu Ṣaḍviṃ abrāhmaṇam I 21 Kau ika brāhmaṇeti vortrefflich beigebracht, p. 86 Anm. 19 des ersten prapāṭhakas.
656 Salaḷāgārakam, die Lianenlaube; salaḷā, saralā ist die trivṛtā, die dreifach gedrehte Konvolvulazee Ipomaea Turpethum, ein lianenartiger Windling mit herabwallendem purpurnen Blütenschleier. Zur Anlage einer solchen Laube mit ihrer Terrasse und Einsiedelei im Hintergrund cf. Anmerkung 283. Dergleichen Schutzhäuser und Klausen pflegten zumeist nach der den Ort besonders kennzeichnenden Pflanze, oder nach Wald und Bach, Fluß oder See, Fels und Berg geheißen zu werden.
657 Bhujatī S richtig, eine Art Melusine, apsāriṇī, apsarā, wie der Name andeutet. – Nachher mit S abhivādehi me tvam zu lesen. – Bhujatī wollte nicht stören, solange der [737] Asket nicht ausgeschwiegen hatte. Vergl. das hier sich anschließende Hochrelief aus Ṣāhbāzgarhī, bei FOUCHER, L'Art gréco-bouddhique du Gandhâra, tome I Nr. 215.
658 Die Wandlung Gopikās in Gopako als Erwachsen zu reiferer Phase ist von Sakko mit Recht nach der Weise ausgelegt, wie es in der 115. Rede der Mittleren Sammlung (S. 873) dem allgemein gültigen Naturgesetz vom sexus maior entsprechend vorgetragen wird; und somit auch ganz gemäß dem Worte der Schwester KATREI zu Meister ECKHART (a.a.O. Anm.), daß nämlich das Weib den angeborenen Zartsinn, Jungfrausinn, eben das ewig Weibliche durchgewirkt und nun ein männliches Herz mit voller Kraft erst erworben haben muß, wenn es zu himmlischem Gedeihen sich weiterentwickeln will. Die weibliche Sphäre und nur ahnende Nachfolge liegt da bereits überwunden zurück, nachdem auch sie mütterliche, schwesterliche, töchterliche Liebe im Gemüt ausgebildet hatte, taugliches Mittel zur Förderung gewesen war. Vergl. hiermit die Erklärung, die Piṇḍolabhāradvājo, nach einem Meisterworte, dem König Udeno gibt, Saṃyuttakanikāyo vol. IV p. 110-113, übersetzt Bruchstücke der Reden Anm. 149. Das war noch die Stufe der Kämpfer. Bei Wahnversiegten freilich ist jeder Unterschied überstiegen; ihre Art oder besser, wenn man so sagen darf, Nichtheit, niwiht, entwiht, ist jenseits von Weib und Mann; siehe oben unsere 16. Rede, S. 247, und die Anmerkung 390 dazu, letzter Absatz, vor allem aber die Stelle aus dem Anguttaranikāyo VII Nr. 48, Bruchstücke der Reden Anm. 823, Mitte.
659 āyūhittha, schöner alter Aorist von yu yauti + ā. – Die Erlangung der Kindschaft, puttattass' ajjhūpagamanam, im Reiche der Dreiunddreißig bei Sakko, von der Gopako vorher gesprochen, ist die bekannte himmlische Wiedergeburt als Göttersohn, der neue Aufgang in jener höheren Sphäre, deren Beherrscher eben Sakko ist: gleichwie der Mensch auch hienieden je nach Verdienst unter einem minderen oder höheren Regenten geboren wird, unter dem ihm zukommenden Leitstern. So gehört denn auch dort der eine zu dieser, der andere zu jener planetarischen Bahn, vom Tage an, der ihn der Welt verliehen, nach GOETHES orphischem Urwort, insofern man gar wohl gestehn möchte, »daß angeborne Kraft und Eigenheit, mehr als alles Übrige, des Menschen Schicksal bestimme.« Gopako war demnach zu einem Sohne Sakkos geworden, wie andere etwa zu Bārhaspatyaputrās oder Söhnen Bṛhaspatis etc.; wie ja wir im selben Falle von einem Jupitersohne reden und damit einen Menschen meinen, der Jupiter zum Regenten hat, unter seinem Gruß zur Sonne geboren wurde, ans Licht kam: z.B. bei GOETHE, MOZART, BEETHOVEN. Die Gesetze und Beziehungen im Reiche der Dreiunddreißig sind natürlich nicht anders bestimmt als in den anderen Welten; freilich nur nach außen hin, wie oben weiter gezeigt wird. Innere Kraft kann da wie dort über alle rollenden Leitgestirne und Kreise hinausreichen, auch Überwolkenbreite durchdringen, und aus ätherischem Gewande dahinkehren wo kein neuer Tag mehr blendet. Oder mit den Worten der ruti, Ende des fünften Abschnitts der Kaṭhopaniṣat: Na tatra sūryo bhāti na candratārakaṃ nemādi, bis zum Ende der Nāradaparivrājakopaniṣat:
Sūryo na tatra bhāti na a ānko 'pi,
na sā punar āvartate – na sa punar āvartate:
Wo keine Sonne scheint und auch kein Mondesglanz,
Und keiner jemals wiederkehrt – und keiner jemals wiederkehrt.
660 duddiṭṭharūpaṃ vata bho addasāma mit S. Nachher kāyam brahmapurohitam als yena so. Auch im Mahāvastu II 314 usw. ist es der letzte Kreis vor dem Gotte selbst, wie bei DANTE, die zunächst vorgeahnte Sphäre, Faust v. 12094f.
[738] 661 Mit S santāni guṇāni (straff gespannte, das sind) pralle Seile.
662 Mit S janindatthi manussaloke zu lesen.
663 Zum jenseitigen Bedauern cf. das diesseitige Beneiden, die Reversseite des einigen Begriffs, Bruchstücke der Reden v. 823 nebst den Stellen aus der Smṛti. Mit anderen Worten: jene beiden waren, als konstante Größen, Grenzwert derselben variablen geworden, nach obigem Ansatz. Oder mit den Augen des Enthusiasten gesehn: es
Hat der Begrabene
Schon sich nach oben,
Lebend Erhabene,
Herrlich erhoben;
– – – – – – – – – – –
Ließ er die Seinen
Schmachtend uns hier zurück,
Ach, wir beweinen,
Meister, dein Glück!
Dieser laute lautere Neid ist freilich wohl etwas anderes als das verzweifelnde silentium quod secum viventibus livor indixerit, das bei uns SCHOPENHAUER nach SENECA behandelt: er ist die mächtig ergreifende Trauer und Traurigkeit, die zweimal in der Mittleren Sammlung zur Sprache kommt, S. 331 und 1006, wo der Jünger der höchsten Erlösungen in Sehnsucht gedenkt und sich fragt: »Wann doch nur werde ich das Gebiet erobert haben, das die Heiligen schon besitzen?«, und indem er so der höchsten Erlösungen sehnsüchtig eingedenk ist sich schmerzlich bewegt fühlt, allen Haß hinter sich lassend, so daß ihn da keine gehässige Anwandlung mehr ankommen kann.
664 Vergl. Bruchstücke der Reden v. 512, 1030.
665 Mit S iti ca nesaṃ hoti.
666 Eine solche Freude bezeigt Sakko immer nach Beantwortung jener schwierigen Fragen, die ihm, als einem hochstrebenden lauteren Geiste, angelegen sind, so auch z.B. in der 37. Rede der Mittleren Sammlung (S. 281). Es ist die Freude an bereinigter Erkenntnis, von der schon das Antlitz des Upakosalas erstrahlt, mukhaṃ bhāti, Chāndogyopaniṣat IV 14 2: jener bittersüße Genuß an den Dingen gründlich enttäuscht zu werden, der sich beim puthujjano oder gewöhnlichen Menschen allerdings nur in Enttäuschung verhärtet; während dem edler Erfahrenen Sakkos Befriedigung recht wie PETRARCAS Freude, Ecloga IX 50, erscheinen wird:
Nosse mali causas ingens solet esse levamen.
Vergl. noch in unserer 14. Rede oben S. 204 und 205 das Frohlocken Vipassīs bei der Erkenntnis von Entwicklung und von Auflösung. – Zur Sache: des EMPEDOKLES φιλια και νεικος, als Synkrise und Diakrise.
667 Vergl. Bruchstücke der Reden Anm. 865 die Hauptstelle aus dem Saṃyuttakanikāyo über den Willen, chando: »Alles Leiden wurzelt im Willen, stammt aus dem Willen: denn der Wille ist die Wurzel des Leidens.« Zum gründlichen Verständnis der Begriffe »wurzeln, sich entwickeln, eingepflanzt sein« dient Mittlere Sammlung 1050. Ein ähnlicher Ausdruck im Faustbuch von 1587, Ende des 15. Abschnitts [S. 48]: den Teuffel bey sich einwurtzeln lassen. – Cf. Anm. 699 u. 700.
668 Vergl. Lieder der Mönche v. 990 nebst den Nachweisen, zumal aus der Mittleren Sammlung, wo in der 18. Rede (S. 127f.) von Gotamo folgender Stempel gegeben [739] wird: »Wenn der Sonderheit Wahrnehmungen, wodurch auch immer bedingt, an den Menschen der Reihe nach herantreten und da kein Entzücken, kein Entsprechen, keinen Halt finden, so ist das eben das Ende der Lustanhaftungen, so ist das eben das Ende der Ekelanhaftungen, so ist das eben das Ende der Glaubensanhaftungen, so ist das eben das Ende der Zweifelanhaftungen, so ist das eben das Ende der Dünkelanhaftungen, so ist das eben das Ende der Anhaftungen der Daseinslust, so ist das eben das Ende der Anhaftungen des Nichtwissens, so ist das eben das Ende vom Wüten und Blutvergießen, von Krieg und Zwietracht, Zank und Streit, Lug und Trug: da werden diese bösen, schlechten Dinge restlos aufgelöst.« Wie dann die weitere Ausführung darlegt, kann diese bunte Welt der Erscheinungen eben dadurch aufgelöst werden, daß die Wahrnehmungen der Sonderheit, die zuletzt im Nichtwissen wurzelt, der Reihe nach bei den durch das Denkbewußtsein gehenden Dingen vergangener, gegenwärtiger und zukünftiger Zeiten ohne Unterschied restlos aufgehn. Dies wird zustande gebracht, indem man, wie es in der 111 Rede derselben Sammlung (S. 841) heißt, die Dinge der Reihe nach klar gesehn hat, und zwar Berührung, Gefühl, Wahrnehmung, Denken, Bewußtsein, Wille, Beschluß, Kraft, Einsicht, Gleichmut, Achtsamkeit: diese Dinge hat man der Reihe nach eingeordnet, läßt sie wissentlich aufsteigen, wissentlich standhalten, wissentlich untergehn; bis man nun erkennt: »So kommen denn diese Dinge ungewesen zum Vorschein, und gewesen verschwinden sie wieder.« So ist man diesen Dingen nicht zugeneigt und nicht abgeneigt, nicht angeschlossen, nicht angeheftet, ist ihnen entgangen, ihnen entronnen, ohne das Gemüt umschränken zu lassen. Dabei wird die Auflösung der Wahrnehmbarkeit gewonnen, »und des weise Sehenden Wahn ist aufgehoben.« Das ist die asketische Ästhetik, wie Gotamo sie lehrt; auf deutsch: die Übung in sinnlicher Wahrnehmbarkeit. Wie nahe einer solchen Anschauung, vom rein ästhetischen, d.i. erkenntnistheoretischen Standpunkte aus, KANT gekommen ist, zeigen zahllose Stellen seines Hauptwerks. In Beziehung auf unseren eben zuvor angeführten Text sei hier nur auf K R V II 2, 2, 3, 7 (ed. ROSENKR. S. 503f.) hingewiesen, wo der große Dianoiologiker die Reihe der Kräfte im menschlichen Gemüt unter die verschiedenen Arten von Einheit nach Begriffen des Verstandes zunächst einzubeziehen vorschlägt, nach Empfindung, Bewußtsein, Einbildung, Erinnerung, Witz, Unterscheidungskraft, Lust, Begierde, um »diese anscheinende Verschiedenheit so viel als möglich dadurch zu verringern, daß man durch Vergleichung die versteckte Identität entdecke«, usw. Die Wurzel dieser versteckten Identität aller Wahrnehmungen der Sonderheit liegt aber nach Gotamo im Nichtwissen, ist das Nichtwissen: daraus erwächst, sprießt und zweigt jede Unterscheidung, Sonderheit, Zweiheit mit ihren Folgen (»Krieg und Zwietracht, Lug und Trug«), kurz: der Nichtwissenswahn hervor, ästhetisch, d.i. dianoiologisch betrachtet, um der Sache ethisch desto besser beikommen zu können. Daher sagt der Meister, Bruchstücke der Reden v. 730, v. 916:
Nichtwissen heißt die tiefe Nacht
Darin man hier so lange kreist:
Erworben wer da Wissen hat
Geht nimmer neuen Werdegang.
Das Wurzeln hier im Sondern, Unterscheiden,
»Ich bin's, der denkt«, muß gänzlich sein entrodet,
Ein jedes Dürsten seiner Brust
Entfremden muß man lernen immer klargemut.
[740] Der Begriff des prapañcas und prapañcopa amas, Sonderheit und Aufheben der Sonderheit, ist bekanntlich auch in der ruti wohlüberliefert, in der Māṇḍūkyopaniṣat I 7, vetā vatarādi. Der kürzlich verstorbene Nayakathero, HIKKAḌUWE SUMAN GALA, hat mir einmal sehr tauglich dementsprechend papañceti als paṭivitāreti erklärt: sich hinausdehnen (wie ein Nebel). Es ist merkwürdig, daß vor über fünfzig Jahren schon RICHARD WAGNER dieses Verhältnis, aus Notizen bei KOPPEN und BURNOUF, richtig ersehn hatte. »Sie kennen«, schreibt er aus Paris am 3. März 1860 der WESENDONK, »die Buddhistische Weltentstehungstheorie. Ein Hauch trübt die Himmelsklarheit:
das schwillt an, verdichtet sich, und in undurchdringlicher Massenhaftigkeit steht endlich die ganze Welt wieder vor mir.« Eine so feine, bewundernswerte Auffassung war eben damals dem auch im ärgsten äußeren Trubel einsam Zusichgekehrten noch möglich gewesen; innere Unrast und Überschwenglichkeit unter schwammigen muffigen Geistern während der verfilzenden frommtümelnden Bayreuther Patriarchenzeit hat, wie man ja weiß, dann später selbst diesen freigeborenen Göttersohn gerade am ārischen Nazarener – wer lacht oder seufzt da nicht – als Mediochristen und schließlichen Deutschchristler verkümmern, urvergeßlich werden lassen. Keiner hatte hingegen auch nur ähnlich scharf umrissen die Prägung des gotamidischen Stempels wieder erreicht wie SHAKESPEARE, im Twelfth Night IV 2: »There is no darkness but ignorance«, der wörtlichen Wiedergabe des Merkspruchs Dhammapadam v. 243: avijjā paramaṃ malam – vielleicht nach dem altüberlieferten Wort des Gesprächs im Pantagruel V 7: »Ignorance est mere de tous maulx.« Vergl. Anm. 349.
669 Nulla verior miseria quam falsa laetitia: DIVUS BERNARDUS, Opp. 1621 fol. 2155 cap. 147. Vergl. Mittlere Sammlung Anm. 533 gegen Ende.
670 Certe tristitia saecularis omnium malorum spirituum est pessimus: I.c. 1254 C. Dazu wieder Mittlere Sammlung Anm. 368.
671 Eine vedische Parallele zu diesem Gleichmut ohne Gedanken, ohne Überlegung, d.i. »mit Unsinnen«, wie ECKHART sagt, Anm. 33. Vergl. noch Lieder der Mönche v. 606 nebst Anmerkung; ferner Wort und Antwort des THALES, bei DIOG. LAERT. I 35 i.f., Ουδεν, εφη, τον ϑανατον διαφερειν του ζῃν κτλ., und vorzüglich die lakonische Inschrift bei PLUTARCH, Pelopidas cap. 1. Ungemein schön hat auch unser HEINRICH SEUSE diese geistige Kraft »die höchste Schule und höchste Kunst rechter Gelassenheit« genannt, ed. BIHLMEYER p. 53, mit der Erklärung: »Diese Kunst will haben eine ledige Müßigkeit: so man je minder hier tut, so man in der Wahrheit je mehr hat getan.« – Bis zu welchem Grade die altbuddhistische Lehre vom Gleichmut (wohlverstanden: ohne Gleichgültigkeit, eben als die hohe Schule und Kunst der Gelassenheit) allmählich auch über die unteren Schichten und das gemeine Volk sich verbreitend die Jahrhunderte hindurch immer noch wirksam geblieben ist, zunächst schon rein äußerlich als der allgemein vornehme »gute Ton«, wird sehr zutreffend durch das Zeugnis eines gewiegten alten Seemanns bestätigt, der seine lange und vielseitige Erfahrung dahin zusammengefaßt hat: »I never observed in any of their countenances the slightest appearance of what we should call emotion; indeed, the most characteristic point I remember about the Hindoos, is tranquillity under every degree of suffering«: Captain BASIL HALL, Fragments of Voyages and Travels, London 1832, vol. III p. 74. Von den Indern aber haben bekanntlich zumal die Japaner die feine [741] Kunst und Kultur einer solchen Selbstbeherrschung übernommen und bei sich eingepflanzt, mit bestem Gedeihen.
672 Cf. Mittlere Sammlung S. 825 und unsere 14. Rede, oben S. 213.
673 Mit S anekadhātumhi nānādhātumhi loke. – Es ist eines der auszeichnenden Merkmale des gotamidischen Vortrags, daß die Ansichten und Meinungen der anderen Führer und Meister als je nach dem Standpunkte gelten gelassen werden, im Gegensatz zu jenen gewöhnlichen Häuptern der Schulen, deren da jeder versichert: »Dies nur ist Wahrheit, Unsinn anderes«. Die Welt zu betrachten, ohne Beschränktheit und Engherzigkeit, dazu leiten die Reden an, das zeigen sie und lehren sie immer aufs neue: am stärksten vielleicht in der letzten Ansprache des Meisters, oben in der 16. Rede, gegen Ende des 5. Berichts. Dergleichen Ausführungen finden sich insbesondere noch in der Mittleren Sammlung, 60. Rede (441f.), zumal 74. Rede (535f.), ferner in der 72., 95. und zahlreichen ähnlichen, die immer in ruhig besonnener Weise jedem das Seine lassen. Schon auf den ersten Blick zeigt nichts deutlicher die Höhe der indischen Kulturstufe als eben diese völlig ungetrübte Freiheit von Fanatismus und Intoleranz. Ein solches Verstehn und Begreifen, eine solche Weite des Gesichtskreises wurde in unseren Breiten erst viel, viel später erklommen, und natürlich auch nur von verwandten – obwohl noch so verschiedenen – freien, starken Geistern. Als eine artige Probe, die zugleich in der Ausdrucksweise an die längst verklungene Fuge unserer Texte erinnert, sei hier am besten und kürzesten eine Stelle aus DIDEROT vorgelegt, bald nach Beginn von Jacques le fataliste et son maître: »Et les voilà embarqués dans une querelle interminable sur les femmes; l'un prétendant qu'elles étaient bonnes, l'autre méchantes: et ils avaient tous deux raison; l'un sottes, l'autre pleines d'esprit: et ils avaient tous deux raison; l'un fausses, l'autre vraies: et ils avaient tous deux raison; l'un avares, l'autre libérales: et ils avaient tous deux raison; l'un belles, l'autre laides: et ils avaient tous deux raison; l'un bavardes, l'autre discrètes; l'un franches, l'autre dissimulées; l'un ignorantes, l'autre éclairées; l'un sages, l'autre libertines; l'un folles, l'autre sensées; l'un grandes, l'autre petites: et ils avaient tous deux raison.« So wird denn die bedingte Geltung aller Maßstäbe klar.
674 Mit S und C etc. sabbe samaṇabrāḥmaṇā.
675 Mit S Ye kho te devānaminda bhikkhū taṇhāsankhayavimuttā. Vergl. Mittlere Sammlung No. 37; auch No. 38 am Ende. In der ersteren Rede dort ist es gleichfalls der Götterkönig, der ebenso fragt und aufgeklärt wird. Diese Frage scheint demnach den Mittelpunkt des ganzen obigen Gesprächs darzustellen, wie dies auch sehr klar aus dem Saṃyuttakanikāyo vol. III 1 No. 4 hervorgeht, wo die Frage angeführt und mit dem Text von beiden Seiten in Einklang gebracht ist. Ursprüngliche Grundlage war ohne Zweifel der Schluß der 38. Rede.
676 Vergl. Bruchstücke der Reden vv. 750/751. – Zu puriso uccāvacam āpajjati cf. den selben Ausdruck bei Asoko, Felsenedikt VII, Girnār Zeile 2: jano tu ucāvacachaṃdo ucāvacarāgo.
678 Mit S asurā va parājayiṃsu. Im Majjhimanikājo I 253 4 parājiniṃsu.
679 Mit S so kho pana me.
680 Katham pana tvaṃ mit S. – Vergl. Mittlere Sammlung S. 677 einen ähnlichen Ausdruck, dem König Pasenadi gegenüber.
681 amānusam mit S, C etc. Im folgenden amūḷhapañhassa. In neuem Schoße unverstört erscheinen, d.h.: er wird in künftiger Geburt nicht etwa getrübten Geistes sein, nicht als ein Irrsinniger oder Schwachsinniger entstehn, nicht erblich belastet [742] erzeugt werden, nicht blind oder taub, stumm oder lahm; vergl. den entsprechenden Kommentar im ersten Kapitel des Sārasangaho (p. 14 meiner Textausgabe): tatoppabhuti na jaccandho hoti na jaccabadhiro na ummattako na eḷamūgo na pīṭhasappi. Solange man in der Wandelwelt umkreist, ist eine solche Wiederkehr, als die bestmögliche, fröhlich zu heißen, nach dem altvedischen Wunsche des Frommen im Sāmavidhānabrāhmaṇam III 7 1: Atha yaḥ kāmayetāmuhyantsarvāṇyājanitrāṇi parikrāmeyam ityādi: »Wer da nun wünschte ›Unverstört möchte ich alle Geburtstätten durchwandern‹ usw.« Sakko spricht also oben zu gleich wörtlich genau nach der ruti: ein untrüglicher Beweis für die Treue der von zwei fern abgelegenen Seiten hier zusammentreffenden Überlieferung. – Eine ähnliche Erkenntnis deutet das auf PYTHAGORAS zurückreichende Gleichnis an: Ουκ εκ παντος ξυλου 'Ερμης αν εγνοιτο: ein schönes Beispiel der Verwandtschaft, nach der Inscriptio Beneventana, cum Samothracibus Cabiris et Indico Sole atque Apolline Delphico; und daher auch für GOETHES Herbstwort, aus den Vier Jahreszeiten:
Was ist das Heiligste? Das, was heut und ewig die Geister,
Tiefer und tiefer gefühlt, immer nur einiger macht.
682 Die sechs Strophen, die Sakko da als Preisgesang vorgetragen hat, deuten dem Hörer zugleich das Verständnis der wohlbekannten Lehre an, daß der rechte Jünger imstande sei das Spiel doppelt zu gewinnen, d.h. beide Ziele zu erreichen, nämlich in diesem Leben schon sich wohl zu fühlen, solange er hier noch weilen kann, als auch für künftiges Dasein Heil zu wirken, ja selbst das Ende sich offenbar zu machen: nach hüben wie nach drüben ist er im höchsten und weitesten Begriffe zuträglich beflissen, indem er sich zur reifen Entfaltung erzieht. Und wenn es nun ein Jenseits oder kein Jenseits mehr für ihn geben wird: sicher hat er schon heute die Einkehr in sich gefunden, sicher ist er bereit. Eine umfassende Darstellung dieser echt gotamidischen Denkweise, die Sakko oben, wie erwähnt, als wohlbekannt in seiner Huldigung preist, findet man in der 60. und 129. Rede der Mittleren Sammlung. Die so doppelseitig empfundene Zuversicht unseres Götterkönigs ist übrigens auch in schottischer Kürze auf dem Epitaph ausgesprochen, das ROBERT BURNS einem Freunde gewidmet hat:
If there 's another world, he lives in bliss;
If there is none, he made the best of this.
683 sambuddhā iti maññamāno, mit S: sambuddhā ti maññamāno zu lesen; yassa, sc. kālassa etc.
684 Zum Stechen des Durstes, Pfeil des Durstes, das große Gleichnis in der 105. Rede der Mittleren Sammlung. DE LORENZO erinnert hier mit Recht an den einstimmenden Ausdruck in einem Canto des MAGNIFICO, LORENZO DE' MEDICI, mit der oft gehörten Strophe, in MOLINIS Florentiner Ausgabe von 1825 Band III Seite 169:
E che giova aver tesoro,
Poichè l'uom non si contenta?
Che dolcezza vuoi che senta
Chi ha sete tuttavia?
Dasselbe hat unser GOTTFRIED gemeint, Tristan v. 11679, wo er sagt: »Diu endelose herzenôt«; BÜRGER spricht dafür von »dem durstenden Herzen«. Näheres folgt noch Anm. 697 und 698.
[743] 685 Mit S tuyhaṃ dassāmi. – Vergl. die 19. Rede.
686 S bahupakāro wie M auch bei TRENCKNER, Majjhimanikāyo p. 541 zu p. 135 10; desgl. bahuprakāraṃ prapadyate, Rāmāyaṇam II 88 Ende, usw.
687 Der dreimalige Weihegruß entspricht der hochheiligen vedischen Vyāhṛti, dem Flüstern der drei geheimnisvollen Laute bhūr bhuvaḥ svar, wodurch der Andächtige alle Gunst erwirkt, Manus 6 70 etc. Das Streichen über die Erde, Inbegriff von Größe und Geduld, stellt eine gleichsam unverbrüchliche Hingabe dar, atapathabrāhmaṇam XIV 1 2, 10 etc.; cf. auch schon die »holdselige Erde«, pṛthivī su evā im Ṛgmantram X 18 10, und die zaubertiefen 63 Strophen des Bhaumasūktam in der Atharvasaṃhitā XII 1. – Ähnlich Ilias XIV 272, sowie die zart indisch empfundene Dankesbezeugung Fausts, v. 4681:
Du, Erde, warst auch diese Nacht beständig.
Die Berührung der Erde, gleichsam um den unerschütterlichen Entschluß zu bekräftigen, ihn verbürgend zu bezeugen, wurde von den Steinmetzen und Malern des Mahāyānam gern veranschaulicht: es ist die berühmte bhūmispar amudrā mit der abwärts gesenkten rechten Hand; nach dem Hauptstück des Lalitavistarapurāṇam stets wiederholt. Ein wohlgelungenes älteres Beispiel der Art ist die 1 m hohe Büste des Meisters im Wandelgang des Mahābodhi-Denkmals zu Buddhagayā, edel geformt an Gliedern, das Antlitz heiter, hell, gelassen, im echt indischen Stil gearbeitet, etwa aus dem 3. Jahrhundert nach Asoko, wahrscheinlich noch früher anzusetzen. FOUCHER gibt eine recht gute Phototypie, in seiner Etude sur l'iconographie bouddhique de l'Inde, Paris 1905, p. 17, nebst einer ausführlichen Erklärung nach einheimischen Quellen sowie dem Nachweis, daß es ebendiese »statue miraculeuse« war, die HIUEN-TSIANG auf seiner Reise, um 640, aufgesucht und als altehrwürdiges Monument betrachtet hat, jene längst schon vom Volk allumher verehrte Darstellung des Meisters im Augenblick der vollkommenen Erwachung: ebenso in der Gandhārer Kunst wie in Amarāvatī und weiter überliefert.
688 Vergl. Anm. 332, ferner 3. Rede S. 75, Mittlere Sammlung 1065; aññesañcādi ist aññadatthu Glosse, in den Itinerarkommentar des Divyāvadānam (p. 394) überleitend, vaipulyaprasangena. Der alte Merkspruch, als Summe der Lehre, wurde bei uns vielleicht am tiefsten von GRACIAN eingesehn, der wirklich wie eine Titelüberschrift dazu das Wort geprägt hat von der »Berichtigung der entzifferten Welt«, del desengaño en el mundo descifrado, Ende des Criticòn, Antwerpener Ausgabe 1702 S. 388 b. – Ein gleichartiges Signaculum, jedoch weit jünger, erst aus Texten wie Mahāvaggo und Mahāvastu nachweisbar, hat im Mahāyānam späterhin an Stelle des echten Merkspruchs mehr und mehr Verbreitung gefunden und ist dann in der nördlichen Überlieferung, von Afghanistan bis nach China und Japan, schlechthin zur buddhistischen Glaubensformel, zum richtigen Credo geworden, auf zahllosen Inschriften an Kuppelmalen, Säulen, Platten, Postamenten, Statuen etc. bis zur Gegenwart erhalten geblieben. Es ist der Vers Ye dharmā hetuprabhavādi, Mittlere Sammlung p. XXXVI genau nach der Inschrift wiedergegeben, die auf der Rückseite des granitenen Meisterbildnisses eingegraben ist, das mir vom alten Stūpas in Buddhagayā zugebracht wurde, und er lautet also:
Die Dinge, die veranlaßt sind,
Den Anlaß dieser hat der Herr
Gelehrt, und wie sie gehn zur Neige:
Das hat gesagt der Große Asket.
[744] 689 Zur alten Überlieferung und Lage der Stadt cf. Mittlere Sammlung Anm. 344. Wörtlich bedeutet Kammāsadammam ›Die bunte Kuh‹, oder ›Das bunte Rind‹, ein Name, den, sonderbar genug, bekanntlich NIETZSCHE seiner zarathustrischen Stadt beigelegt hat. Der Bauplan einer solchen kleineren altindischen Stadt ist erst kürzlich durch MARSHALLS Ausgrabungen bei Bhīṭā, südwestlich Allahābād an der Yamunā, genau erkannt worden. Er gleicht vollkommen dem greko-italischen, wie er uns in Pompeji am besten erhalten ist: enge Gassen, ab und zu ein Verkaufsladen, die Häuser mit dem Atrium in der Mitte, die Reihe der Gemächer an den Seitenflügeln herum, im Keller die Schatzkammer, alles einfach, edel, solid in gebrannten Ziegeln ausgeführt, im Rechteck und im Quadrat; die Überwölbung ist leider zerstört. Diese Ruinen von Bhīṭā, eines offenbar ganz unbedeutenden Ortes am Gestade der Yamunā, nur ein paar Stunden von einer mächtigen Residenz- und Hauptstadt entfernt, sind bisher die einzigen aus so früher Zeit wieder zutage geförderten. Sie reichen bis in die Zeit der Mauryer, 2. Jahrhundert vor Chr., zurück, unter zweitausendjähriger Humus verschollen und vergessen geblieben. Durch ein Zusammentreffen glücklicher Umstände hat MARSHALL im Winter 1909 bis 1910 gerade dieser Stelle seine Aufmerksamkeit zugewandt und die alsbald energisch durchgeführten Nachgrabungen glänzend belohnt gesehn. Darum eröffnet er denn auch seinen Bericht mit den wohlbegründeten Worten: »The excavations at Bhīṭā, near Allahabad, which I am about to describe, signalize a new departure in Indian Archaeology; for they mark the first occasion on which a serious effort has been made to explore the remains of an ancient Indian town«: cf. Journal of the Royal Asiatic Society 1911 p. 127 nebst Grundriß und Phototypie, Tafel I und II.
690 Der gerade Weg, ekāyano maggo, nämlich zum Mittelpunkt, ist aus den Upanischaden übernommen, nach dem Gleichnisse vom Meer als dem Mittelpunkt für alle Gewässer, dem sie schlechthin zuströmen, in der Bṛhadāraṇyakā II 4 11, und vom Herzen als dem Mittelpunkt für alle Sinne, dem sie einzig taugen, in der Chāndogyā VII 5 2. Gotamo hat nun das vedische Gleichnis auf die vier Pfeiler der Einsicht angewandt: diese werden als der Mittelpunkt der Lehre dargestellt.
691 Das planmäßige Üben der ānāpānasati, der Bedachtsamen Ein- und Ausatmung, hat Gotamo von der älteren Asketik übernommen und zur Vollendung gebracht. Sie gilt auch bei ihm als die sicherste Grundlage und Vorstufe zu höheren Ergebnissen, wie dies zumal in der 118. Rede der Mittleren Sammlung, sowie auch in der 62. genau bis zur letzten Entatmung entwickelt ist. Da ist jene Methode zielbewußt durchgeführt, von der die Ansätze auch bei unseren großen Lichtbrüdern zu finden sind; so z.B. wenn HEINRICH SEUSE in seinem Leben, ed. BIHLMEYER Kap. 40 S. 164, 167, sagt: »Was ist eines wohlgelassenen Menschen Übung? Das ist ein Entwerden.« Und: »In dem Untergang werden alle Dinge vollbracht.« – Der tiefe und der kurze Atemzug ist noch im Yogasūtram 2 49-50 ebenso überliefert: prāṇāyāmo dīrghasūkṣmaḥ, und ist auch gegenwärtig aller Nachfolger Eingang zur Praxis geblieben. Der erstaunlich rasche Erfolg und Nutzen solcher Übungen wird in der Regel schon beim ersten Versuch alsbald erfahren, bei Vertrauen und gutem Willen: wie das z.B. bei PIETRO DELLA VALLE, dem nüchternen und sehr aufmerksamen Reisenden, der Fall war. In seinem Brief aus Surate vom 22. März 1623, cap. XVII i.f., berichtet er ebenso knapp als bestimmt von der Wissenschaft der Yogins und ihren geistigen Übungen, und insbesondere der höchst merkwürdigen, jedoch ganz naturgemäßen Behandlung des menschlichen Atmens, worin sie wirklich eigenartige und ungemein feine Beobachtungen angestellt hätten, die er bei sich selbst, weil er sie erproben wollte, als wahr [745] erfunden habe. Oder besser mit seinen eigenen Schlußworten: nella quale hanno fatto in vero curiose e minutissime osservazioni, che io stesso volendole provare ho sperimentato esser vere. Das Urteil dieses vornehmen Mannes, auf der Stütze eigener Erfahrung erworben, ist angesichts seiner Zeit und Erziehung nicht minder ehrenvoll für ihn als erfreulich für uns, die wir der Möglichkeit einer viel tiefer dringenden Vorbereitung und Prüfung nicht ermangeln: einer Kenntnis eben auf Grund der oben im Text einfach, sicher und völlig ausreichend angegebenen Methode, bei der alle Geheimniskrämerei und Verzwacktheit als irreführend und schädlich vom Meister vermieden wurde. Siehe noch Ende der 848. Anm. und besonders Anm. 1034.
692 Eine gleiche Anschauung schon in der Kaṭhopaniṣat 3 7: amanaskaḥ sadā ' ucih, na sa tat padam āpnoti, saṃsārañ cādhigacchati; sehr genau aber unserem Text oben entsprechend und wohl auf ihn zurückzuführen dann in der Maitryupaniṣat 1 3 und 3 4: arīram idam ... asthibhi citaṃ māṃsenānuliptaṃ carmaṇā 'vanaddhaṃ viṇmūtrapittakaphamajjāmedovasābhir anyai cā' 'mayair bahubhiḥ paripūrṇaṃ, ko a iva vasunā. Vergl. übrigens die Variante Hamlets: »What a piece of work is man! how noble in reason! how infinite in faculties! in form and moving how express and admirable! in action how like an angel! in apprehension how like a god! the beauty of the world! the paragon of animals! And yet, to me, what is this quintessence of dust?«, II 2 314-320, Hier klingt jene »Überlieferung der Weisen« hindurch, wie sie SOKRATES angegeben, Gorgias p. 493, daß το μεν σωμα εστιν ήμιν σημα, das Beidrehn von Leib zu Leiche; wie ja auch corpus, corps so gilt.
693 Bei diesem Gleichnis ist nebenher beachtenswert, daß eine Kuh zu schlachten in Indien seit über zweitausend Jahren bekanntlich als ungeheuerliches Verbrechen gilt, worauf der Tod als Strafe steht. Unser Text oben bespricht aber das Schlachten der Kuh wie eine ganz selbstverständliche, allgemein bekannte Gepflogenheit, und genau ebenso in dem noch ausführlicheren Schlächtergleichnisse der Mittleren Sammlung, S. 1059. Daraus ergibt sich, daß unsere Textfassung um Jahrhunderte vor Asoko zurückliegen muß, in eine Zeit hinaufreicht, wo das Schlachten der Rinder zum öffentlichen Fleischverkauf wie im Westen ein Gewerbe war. Seit den Edikten Asokos, um 250 vor Chr., und gar erst später, war eine solche Ernährung durch strenge Verbote unmöglich gemacht und dem Volke längst zum Abscheu geworden: nur die Erinnerung an eine ferne Vorzeit, an den ehemaligen Brauch der gavā anās, der Kuhfresser, war geblieben: cf. Mittlere Sammlung Anm. 527 und Bruchstücke der Reden v. 308-312. Die Überlieferung unserer obigen Textstelle deckte sich demnach ungefähr seit Asoko nicht mehr mit der wirklichen Anschauung, kann daher von den Hörern nur als barbarischer Rest aus dem Altertum empfunden worden sein. Gleichwohl wurde auch dies automatisch unverändert bewahrt und weitergegeben: ein außerordentlicher Beweis für die Verehrung der Meisterworte und ihre unverbrüchlich getreue Überlieferung. – Der Umstand, daß Gotamo ein so derbes Gleichnis aus der Anschauung beibringen mochte, hat ein Gegenstück beim scharfsichtigsten, stärksten, gründlichsten aller Lebensmaler, der es gleichfalls nicht verschmäht hat, auch eine Ochsenanatomie darzustellen, packend, ergreifend, aufrüttelnd in seiner einzigen Kunst, auf einem Gemälde, wenn ich nicht irre, im Louvre.
694 Vergl. GOETHE bei Betrachtung von SCHILLERS Schädel: »Im ernsten Beinhaus war's« usw. bis zum gleichen sinnfälligen Ausdruck: »Die Hand, der Fuß zerstreut aus Lebensfugen.« Eine Leichenwacht, die der unsrigen oben in allen Zügen Schritt um Schritt ebenbürtig nachkommt, hat der heilige BERNHARD stets dem Jünger als Inbegriff praktischer Weisheit empfohlen: Juxta lapidem super quo lavantur [746] corpora te meditando compone, et diligenter cogita quo tractentur usu sepeliendi, nunc enim in tergum, nunc in faciem versantur. Quomodo nutat caput, cadunt brachia, rigent crura, iacent tibiae: quomodo induantur, consuantur, deferantur humanda. Quomodo componantur in tumulo, quomodo pulvere contegantur, quomodo vorentur a vermibus, quomodo quasi saccus putrefactus consumantur. Summaque tibi sit philosophia meditatio mortis assidua. Hanc ubicumque fueris, et quocumque perrexeris, tecum porta, et in aeternum non peccabis. Opp. ed. Par. 1621 fol. 1135 cap. XIV, pariter 1140; 2158 E: Ad illos festino qui morte corporis hinc exierunt. Cum eorum sepulchra respicio, non invenio in eis nisi cinerem et vermem, foetorem et horrorem. Quod ego sum, ipsi fuerunt: et quod ipsi sunt, ego ero. Ist HOLBEINS Christusleiche in Basel.
695 Dieses Schlußergebnis ist bereits im Bṛhadāraṇyakam deutlich genau so angezeigt: bhasmāntaṃ arīram, V 3: vollkommen gleich τετραπαλαι σποδιη »nur noch ein Aschenrest«, im Epigramm des KALLIMACHOS auf den Tod des halikarnassischen HERAKLEITOS, bei DIOGENES LAERTIOS IX 1 13. Auf eine ähnliche Fassung, nicht so knapp gehalten, vielmehr in gesteigerter Folge wie oben dargeboten, im Hercules Oetaeus, Ende, woher die berühmten Schlußverse der Totengräberszene im Hamlet abstammen, nach dem »to this favour she must come«, ist in der Mittleren Sammlung Anm. 415 eingehend hingewiesen: und jene Strophe SENECAS scheint wieder eine Ausführung des LUKREZISCHEN Verses, III 1032/33, zu sein:
Scipiadas, belli fulmen, Carthaginis horror,
Ossa dedit terrae proinde ac famul infimus esset.
Ein Jahrhundert später hatte dann JUVENAL in schönster Vollendung beides vereinigt, das mythische Gefäß mit historischem Inhalt erfüllt, und alles in einem mächtigen Bilde noch näher veranschaulicht, Sat. X 146-150:
... data sunt ipsis quoque fata sepulcris.
Expende Hannibalem: quot libras in duce summo
Invenies? Hic est, quem non capit Africa Mauro
Percussa Oceano Niloque admota tepenti,
Rursus ad Aethiopum populos altosque elephantos.
BYRON hat das Bild der Ode an NAPOLEON vorangestellt und in der 12. Strophe, ganz unserem obigen Texte gemäß, erklärt:
Weigh'd in the balance, hero dust
Is vile as vulgar clay;
Thy scales, Mortality, are just
To all that pass away.
An Kraft der Anschauung und des Ausdrucks kommt aber vielleicht nichts näher als das ebenso gradweise immer klarer gezeigte Ergebnis jener Reise zu allen Kaisergräbern, das ABRAHAM A SANCTA CLARA bei seinem Omnes morimur vorträgt: Ich hab gesehen die Leiber – nicht die Leiber, ich will sagen die Cörper – nicht die Cörper, ich will sagen die Bainer – nicht die Bainer, ich will sagen den Staub – nicht den Staub, ich will sagen das Nichts der gecrönten Kayser und Monarchen.
696 Durch den bloßen Wunsch kann ein solches Begehren freilich nicht erfüllt werden: »heute – morgen – übermorgen soll es sein«; vielmehr bedarf es dazu gar schwerer, emsiger Vorarbeit: gleichwie der Bauer sein Feld erst richtig gepflügt, gejätet, [747] besät, bewässert und entwässert haben muß, aber das Grünen, Körnen und Reifen der Frucht nicht für heute, morgen und übermorgen anbefehlen kann. Denn nicht eitel Begehren, Arbeit schafft die Ernte. Aṇguttaranikāyo III, Loṇaphalavaggo No. 1 (vol. I.p. 239/40). – Vergl. Chāndogyopaniṣat VIII 1 6: Tad ya ihātmānam ananuvidya vrajantyetāṃ ca satyān kāmān, teṣāṃ sarveṣu lokeṣv-akāmacāro bhavati. Das selbe besagt LUKREZENS großartiger Kolophon zum dritten Buche:
Denique tanto opere in dubiis trepidare periclis
Quae mala nos subigit vitai tanta cupido?
Certa quidem finis vitae mortalibus adstat,
Nec devitari letum pote, quin obeamus.
Praeterea versamur ibidem atque insumus usque,
Nec nova vivendo procuditur ulla voluptas:
Sed dum abest quod avemus, id exsuperare videtur
Cetera; post aliud, cum contigit illud, avemus,
Et sitis aequa tenet vitai semper hianteis.
Für sehr feine Ohren sei hierzu der Chorspruch der Drei gewaltigen Gesellen angeschlossen:
Das alte Wort, das Wort erschallt:
Gehorche willig der Gewalt!
Und bist du kühn, und hältst du Stich,
So wage Haus und Hof und – dich.
Diese Strophe ist übrigens, nebenbei gesagt, die meisterliche Übersetzung und Vollendung eines Spruchs, den der Principe constante in seiner erschütternden Ansprache bekräftigt, nach Mitte der Jornada tercera:
Triste ley, sentencia dura
Es saber que en cualquier caso
Cada paso (¡gran fracaso!)
Es para andar adelante –.
Als Inbegriff der Lehre hat noch einmal mit jugendlicher Kraft RICHARD WAGNER unseren Gedanken erfaßt, als er wenige Monate vor seinem Tode, nach der Lektüre von OLDENBERGS »Buddha«, der kürzlich erschienen war und die erste gründliche Darstellung aus den Quellen darbot, immer mit dem vortrefflichen Werke beschäftigt und darüber Gespräche führend, auf einem der täglichen Spaziergänge in Venedig, angesichts der herrlichen Bauten und Denkmale gleichsam erklärend sagte: »Von dem, was man liebt, getrennt, mit dem, was man haßt, vereint sein – wie gut haben da die Buddhisten das Leiden gefaßt, daraus besteht eigentlich die Welt, das hat diese Paläste eingegeben und all den Pomp, um sich darüber zu täuschen«: in GLASENAPPS Biographie. 6. Bd. S. 699. Da hatte wiederum einmal, wie sonst noch gelegentlich, der urkräftige Feuergeist, doch nicht erstickt vom eingeschlürften christlichen Vergessenheitstrank, blitzend durchgeschlagen, als der alte έλικωψ.
697 Der Wohlseinstrieb, Durst nach Wohlsein, vibhavataṇhā, ist unzugehörig, bez. auf Grundlage des hier wie so oft in die Irre schweifenden Kommentars von OLDENBERG, Buddha, 5. Aufl. S. 150, als »Vergänglichkeitsdurst«, von PISCHEL, Leben und Lehre des Buddha S. 28, gar als »Durst nach (ewigem) Tode« verkannt worden: die [748] 44. Rede der Mittleren Sammlung, S. 332, nebst Anm. 35, deckt das exegetische Mißverständnis auf. Vibhavo = vibhūti, d.i. Wohlsein, Reichtum, Machtfülle, ist hier der einzig mögliche sprachgebräuchliche Begriff, wie er sich übrigens auch aus dem Jātakam gut nachweisen läßt, I p. 145, II p. 283 etc., als mahāvibhavo, bahuvibhavo, usw.; und ebenso reichlich schon in der frühen ruti, aus der ich, nur beispielsweise, Pra nopaniṣat V 4 anführe: sa somaloke vibhūtim anubhūya punar āvartate. Der Wohlseinstrieb, vibhavataṇhā, ist der gesteigerte Daseinstrieb, bhavataṇhā: der Geschlechtstrieb, kāmataṇhā, ist das Urphänomen dazu. Diese Ansicht, daß nämlich aus dem Geschlechtstrieb das ganze Dasein mit allen Welten und Göttern hervorgesprossen sei, hatte schon ein Seher der Vorzeit in einem Spruche der Ṛksaṃhitā verkündet, X 1294: kāmas tad agre samavartatādhi usw., mit tiefer dichterischer Ergriffenheit, natürlich ohne weitere Schlüsse zu ziehn, oder doch nur solche kosmogonischer Art. Der Spruch ist altberühmt und war gewiß auch von Gotamo gehört worden, wahrscheinlich schon in seiner Jugend, beim Vortrag vedischer Haus- und Hofpriester und ihrer Schüler, an denen es in Kapilavatthu nicht gefehlt hat. Vergl. die 3. Rede S. 60. – Die vorher gekennzeichnete Gnügensgier, der Gnügensreiz, nandirāgo, wird in einem zugehörigen Gleichnisse des Saṃyuttakanikāyo (vol. IV p. 173/4) einem verkappten Mörder verglichen, der mit gezücktem Dolche nachschleicht: so ist osahagatā, overbunden, zu verstehn, als eine solche Begleitung. Cf. Bruchst. d.R.v. 664 A.i.f.
698 Der hier gegebene Grundriß umfaßt den Kreis aller Daseinsmöglichkeit mit dem Durst im Zentrum als springendem Kernpunkt. Vergl. Bruchstücke der Reden v. 740/41 und zu v. 992 die Anmerkung aus dem Saṃyuttakanikāyo. Diese eigenartige, durchaus gotamidische Ansicht und Lehre ist später in der Mahopaniṣat als längst bekannt vorausgesetzt und zu einem kurzen Merkspruch verdichtet worden, ed. Bombay III v. 24:
Ciram tiṣṭhati naikatra
tṛṣṇā capalamarkaṭī,
kṣaṇam āyāti pātālaṃ
kṣaṇam yāti nabbasthalam.
Er hält nicht aus an einem Ort,
Der Durst, als Affe gaukelnd fort,
Im Nu der in die Tiefe springt,
Im Nu sich zu den Wolken schwingt.
Bei uns ist der Durst bis in das Paradies DANTES eingedrungen und da gepriesen als »la concreata e perpetua sete« (II 19); wo hingegen SHAKESPEARE ihn als »a thirsty evil« erkannt hat (Meas. I 2 139), und Faust den heiligen Bronnen sucht,
Woraus ein Trunk den Durst auf ewig stillt.
699 Bei dieser Weckung des Willens, chando, findet statt was KANT bei seiner Darstellung der Freiheit des Willens so tief entdeckt und so klar aufgezeigt hat: daß nämlich hier das tätige Wesen, wie er sagt, von aller Naturnotwendigkeit unabhängig und frei sein mag, da in ihm keine Veränderung, welche dynamische Zeitbestimmung erheischt, angetroffen wird. Von ihm würde man »ganz richtig sagen: daß es seine Wirkungen in der Sinnenwelt von selbst anfange, ohne daß die Handlung in ihm selbst anfängt.« So kommt jenes Vermögen zustande, »durch welches die sinnliche Bedingung einer empirischen Reihe von Wirkungen zuerst anfängt. Denn die Bedingung, [749] die in der Vernunft liegt, ist nicht sinnlich und fängt also selbst nicht an. Demnach findet alsdann dasjenige statt, was wir in allen empirischen Reihen vermißten: daß die Bedingung einer successiven Reihe von Begebenheiten selbst empirisch-unbedingt sein konnte.« Kritik der reinen Vernunft, Transszendentale Elementarlehre II 2. Abteilung 2. Buch 2. Hauptstück 9. Abschnitt Nr. III, in den Kapiteln »Möglichkeit der Kausalität durch Freiheit« und »Erläuterung der kosmologischen Idee einer Freiheit« usw. Vergl. noch hiermit die Anmerkung 136. Diese Erkenntnis ist Sāṃkhyasūtre II 32 als krama o 'krama a cendriyavṛttiḥ vortrefflich auf die kürzeste Formel gebracht.
700 Wie solche Einigung auf dem Wege gradweise aufsteigender Schauung erworben werde, ist nach eigener Erfahrung auch bei Meister ECKHART angedeutet, der diese höchsten und letzten Ergebnisse wiederholt gezeigt hat, unseren Begriffen sehr nahe kommend z.B. Seite 105 der von JOSTES gesammelten Bruchstücke, in den Collectanea Friburgensia fasc. IV 1895; wo denn am Ende unsere abschließende vierte Schauung als die oberste Staffel erscheint, sogar mit denselben Worten gekennzeichnet als »des Herzens Ruhe und Frieden, daß kein Lieb noch Leid es mag bewegen noch betrüben.« Dahin zu gelangen hatte er vorher, gleichfalls wie oben bei uns, freilich in weitem Abstande, wenigstens nach der uns erhaltenen Überlieferung, von der unerschütterlich gegründeten Darstellung Gotamos, als das Mittel hierzu das unermüdliche Vorschreiten, die rüstige Ausdauer, kurz: die Kraft des Willens angegeben, S. 65: »Denn der Wille ist also frei, daß ihn niemand binden kann; und was du nicht willst, das ist auch nicht.« Und dann S. 71: »Alle Reichheit, und alle Armut und Seligkeit, liegt am Willen. Der Wille ist so frei und so edel, daß er von keinem leiblichen Ding nimmt, sondern aus seiner eigenen Freiheit wirkt er sein Werk.« Das wird nun von Meister ECKHART des weiteren erläutert, indem er sich auch auf PLATON beruft; zugleich aber stimmt hier sein Vortrag, nach Fassung wie nach In halt, mit der oben zur 416. Anmerkung beigebrachten Stelle aus KANT vollkommen überein: und zwar wiederum so, daß je und je der selbe Gedanke genau das selbe Wort gewählt und angewandt hat, synthetisch bei ECKHART, bei KANT analytisch.
701 Die hier ausführlich dargelegten vier heiligen Wahrheiten sind bisweilen kurz in einen Satz zusammengefaßt, wie Saṃyuttakanikāyo vol. V p. 425 (– 436): »Vier heilige Wahrheiten, ihr Mönche, gibt es: und welche vier? Das Leiden als heilige Wahrheit, die Leidensentwicklung als heilige Wahrheit, die Leidensauflösung als heilige Wahrheit, den zur Leidensauflösung führenden Pfad als heilige Wahrheit.« Diese kurze Fassung ist denn auch, Wort um Wort gleich, im reinsten Pāli auf einer steinernen Inschrift überliefert, die während der Ausgrabungen im Februar 1907 in Sārnāth, bei Benāres, zwischen zwei kleinen Kuppelmalen von STEN KONOW aufgefunden wurde und im 9. Bande der Epigraphia Indica p. 291/2 vorzüglich kollotypiert und besprochen ist. Die Schriftzeichen weisen auf das 4.-5. Jahrhundert nach Asoko hin: hieraus folgt, wie schon der Entdecker sehr richtig geschlossen hat, daß der klassische Pāli-Kanon auch im Norden Indiens noch um diese Zeit wohlbekannt war; um so mehr als eben in Sārnāth, dem uralten einstigen Waldhain bei Benāres, wo Gotamo zuerst die Lehre vom Leiden und der Leidensauflösung einigen Jüngern verkündet hatte, zahlreiche Bildsäulen des Meisters mit der ganz bestimmten lehrenden Haltung der Hände, der dharmacakramudrā, und manche Darstellungen der Szene im Hochrelief errichtet wurden, jetzt im Indischen Museum zu Kalkutta. Es sind darunter Statuen von hoher künstlerischer Vollendung, im rein indischen Stil: realistisch nüchtern und zugleich überweltlich erhaben. – Vergl. Mittlere Sammlung Anm. 519; Lieder der [750] Mönche Anm. 676. Den dort angegebenen wichtigeren Parallelen kann noch SCHILLERS verschleiertes Riesenbildnis von Sais angereiht werden, mit dem dagegenlächelnden Kommentar aus dem letzten Gesange der Sappho LEOPARDIS:
Geheimnis ist alles,
Nur eins nicht, und zwar unsre Qual.
702 Dieser Abschluß ist am Ende der 25. Rede unserer Sammlung als »Löwenruf« wiedergegeben und lautet dort also: »Willkommen sei mir ein verständiger Mann, kein Heuchler, kein Gleißner, ein gerader Mensch. Ich führ' ihn ein, ich lege die Satzung dar. Der Führung folgend wird er so Schritt um Schritt jenes Ziel, um dessen willen edle Söhne gänzlich vom Hause fort in die Hauslosigkeit ziehn, die höchste Vollendung der Heiligkeit noch bei Lebzeiten sich offenbar machen, verwirklichen und erringen, in sieben Tagen.« Ja es ist, bei einer anderen Darlegung, eine noch kürzere Frist angegeben, für den schon tüchtig Bewährten, Ende der 85. Rede der Mittleren Sammlung, S. 656, wo es heißt: »Sei es um einen Tag: mit diesen fünf Kampfeseigenschaften begabt kann ein Mönch, der den Vollendeten zum Lenker hat, am Abend eingeführt am Morgen den Ausgang finden, am Morgen eingeführt am Abend den Ausgang finden«: worauf dann Bodhi der Königsohn, an den die Rede gerichtet ist, innig entzückt und begeistert ausruft: »O herrlich Erwachter, o herrliche Wahrheit, o herrlich verkündete Wahrheit, wo da einer am Abend eingeführt am Morgen den Ausgang finden kann, am Morgen eingeführt am Abend den Ausgang finden kann!« Ein solcher Siegeslauf ist auch in Smṛti und ruti als yogavinayas angegeben, auf dessen Staffeln der rüstig und unermüdlich vorschreitende Kämpfer sehr bald zur Vollkommenheit gelangen kann; so z.B. im Bhāratam XIV 19 v. ult. ṣaṇmāsaṃ nityayuktasya yogaḥ pravartate, oder in der Amṛtanādopaniṣat, deren sechster Abschnitt mit der Verheißung schließt:
Icchayā ''pnoti kaivalyaṃ
ṣaṣṭhe māsi na saṃ ayaḥ:
Nach Wunsch erwirbt er Allgewalt
Im sechsten Monde ganz gewiß.
Sogar Büßerinnen haben einen so raschen Wandel durchzuführen vermocht, nach den lebendigen schönen Bekenntnissen in den Liedern der Nonnen, zumal v. 156 und 174 auch 41, 44, 120, 180. – Zu kaivalyam Allgewalt, nämlich der erworbenen ethischen Allmacht des Willens, cf. oben Anm. 419 i.f.; kevalī alleigen, Bruchstücke der Reden v. 490, passim. Die äußere Anleitung dazu findet sich in der Mittleren Sammlung, Ende der 70. und 32. Rede: »Dem gläubigen Jünger, ihr Mönche, der im Orden des Meisters mit ernstem Eifer sich übt, geht die Zuversicht auf: Gern soll Haut und Sehnen und Knochen einschrumpfen an meinem Leibe, auftrocknen Fleisch und Blut: was da durch Mannesgewalt, Manneskraft, Mannestapferkeit erreicht werden kann, nicht bevor es erreicht ist wird die Kraft nachlassen. Dem gläubigen Jünger, ihr Mönche, der im Orden des Meisters mit ernstem Eifer sich übt, mag eins von beiden zur Reife gedeihen: Gewißheit bei Lebzeiten oder, ist ein Rest Hangen da, Nichtwiederkehr.« Und: »Da setzt sich ein Mönch nach dem Mahle, wenn er vom Almosengange zurückgekehrt ist, mit verschränkten Beinen nieder, den Körper gerade aufgerichtet, und pflegt der Einsicht: Nicht eher will ich von hier aufstehn, als bis ich ohne anzuhangen das Herz vom Wahn erlöst habe.« Der gerade Weg nun zu diesem Mittelpunkt, das sind die vier Pfeiler der Einsicht.
[751] Meister ECKHART hat den Bau der Brücke so gezeigt, ed. JOSTES p. 73: Um hinüberzugelangen muß der Mensch erst von Herzen gelassen, sanft werden, demütig (otmuedik = ottāpī, Anm. 164 i.f.), sodann steten Fleiß üben (sikkhati sikkhāpadesu), drittens behende, kampfbereit sein (āraddhaviriyo), viertens schweigend forschen (ariyena tuṇhībhāvena). Denn einen rechten weisen Menschen erkennt man an seinem Schweigen. Das fünfte ist willige Armut (sallekhena viharati). Das sechste ist ein fremdes Land. Wer in seinem Hause wie fremd und verbannt, ellend, umgeht, hat rechte Armut (suññatā). Mit diesen sechs Dingen erwirbt man die Weisheit, damit man selig wird in diesem Leib: d.h. man erlangt schon bei Lebzeiten, diṭṭhe 'va dhamme, die Gewißheit: nicht mehr ist diese Welt.
703 Die Roseneiche, siṃsapā, ist Dalbergia sisu, einer der ganz besonders schönen und mächtigen Laubbäume Mittelindiens. – Kumārakassapo wurde vom Meister als der reichste Redekundige seiner Jünger bezeichnet, Anguttaranikāyo I 14, 3, 9. Auf ihn ist noch die 23. Rede der Mittleren Sammlung zurückzuführen, und unter seinem Namen sind zwei Strophen in den Liedern der Mönche überliefert. Das Beiwort kumāro bedeutet so viel als der jüngere und unterscheidet ihn vom Großen Kassapo, Mahākassa po, dem vorzüglichsten der Waldeinsiedler: vergl. Mittlere Sammlung 245f. Zur Zeit dieser Rede war auch der »Jüngere Kassapo« schon hochbejahrt geworden, »alt und ehrwürdig«, wie oben alsbald berichtet wird. Die kasuistische Bezugnahme auf das Beiwort im Vinayapiṭakam, Mahāvaggo I No. 75, zeigt späteres Gepräge. Auch Hemacandras Gönner hieß ja, alt geworden, immer noch König Kumārapālas. Desgleichen war der Titel des yuvarājā, d.i. des Kronprinzen oder Thronfolgers, natürlich auch wenn dieser schon in vorgerückteren Jahren stand, Mahākumāras, wie z.B. auf der Pipliānagar-Inschrift, Journ. Bengal Asiatic Society vol. VII p. 736.
704 Solche königliche Schenkungen an Priestergeschlechter und deren Nachkommen finden sich bekanntlich zu vielen hunderten über ganz Indien von altersher inschriftlich beglaubigt, meist auf einem paar Kupferplatten, deren urkundlicher Text genau der vedischen Anweisung entsprechend ausgestellt und mit dem königlichen Wappen oder Siegel gezeichnet ist. Zahlreiche Beispiele nach den Indices und Appendices der Epigraphia Indica. Auf eine auch für uns interessante Inschrift der Art sei aber hier näher eingegangen. Es sind dies die zwei Kupferplatten von Bālerā bei Satyapuram, dem heutigen Sāñcor, im Gebiet von Jodhpur, Rājputāna. Der Gründer der berühmten Caulukyer Dynastie von Aṇhilvāḍ, Mūla rājā I, läßt da verlautbaren, daß er einem gewissen hochgelehrten und strengbewährten Priester ein Dorf zu eigen gegeben habe, Varaṇakagrāmo, mit seinem ganzen Umkreis, mit seinem reichen Baumkranze, versehn mit Wald-, Weide- und Wasserplätzen, sakāṣṭhatṛṇodakopetaḥ; welch letzterer Vermerk also wörtlich unserem obigen satiṇakaṭṭhodakam, »mit Weide-, Wald- und Wasserplätzen«, im altüberlieferten Kanzleistil nachfolgt: an sich belanglos ist es wichtig, weil diese Schenkung aus dem Jahre 995 n. Chr. stammt, daher zeigt, wie zähe noch etwa anderthalb Jahrtausende nach unserer obigen Epoche der idiomatische Ausdruck, der sonst nicht vorkommt, standgehalten hatte. Das Plattenpaar ist, nach einem Abdruck D.R. BHANDARKARS, von STEN KONOW im 10. Bande der Epigraphia Indica, p. 76-79, wiedergegeben und erklärt. Vergl. ib. in älteren königlichen Schenkungsurkunden p. 75 1. 13 und p. 88 1. 44 unseren terminus brahmadeyyam und sadhaññam ebenso tadellos als brahmadeyam und sadhānyam bestätigt. Das etwas dunkle Wort sattussado bedeutet nun nicht nach dem Kommentar einmal »sieben Erhöhungen habend«, und ein andermal »sieben Getreidesorten tragend«, sondern ist an beiden Stellen = sat-tuṣya-daḥ, d.i. also eigentlich »wahre Freude gewährend«, d.h. so viel [752] als »gar heiter anzuschauen«: cf. Mittlere Sammlung, Anm. 246. Die ne pālische Übersetzung saptotsadaḥ im Divyāvadānam p. 620, worauf RHYS DAVIDS hinweist, Dialogues of the Buddha I p. 108 n. 1, ist ebenso mißverständlich wie die glossierende Erklärung im dritten Bande des Dīghanikāyo, 30, 1 13. Analog tussaṃ gahetvā Bruchstücke der Reden Anm. 679, nach außen celukkhepena gezeigt.
705 khalu = ›und zwar‹ hat zuerst FRIEDRICH KNAUER erkannt, in seiner musterhaft sorgfältigen Ausgabe des Gobhilīyagṛhyasūtram p. XXI.
706 Zu dieser fröhlichen Begrüßung eines Mannes wie Kumārakassapo cf. Mittlere Sammlung, Anm. 533, 1. Absatz. Einen so hohen Ruhm und Preis zu verstehn dient auch ein Wort, das TAULER gesagt haben soll: daß es nämlich unter hunderttausend Menschen nicht einen erfahrenen geistigen Führer gebe, nach MOLINOS, Guida spirituale, libr. II Νο. 53; ein Ausspruch, der schön zu Hamlets Meinung vom Ehrlichsein paßt, und als Hyperbel bei JUVENAL, XIII 26/7, so lautet:
Rari quippe boni, numero vix sunt totidem quot
Thebarum portae vel divitis ostia Nili.
707 Das still sich zur Seite setzen ist mit ein Ausdruck der Verehrung und der ruti gemäß, nach Aita reyabrāhmaṇam II 32 3: »Denn das Auge ist es der Andacht: die stille Verehrung.« Auch das Wort upaniṣat, die Upanischad, bedeutet ja nichts anderes als ein solches lautlose Sichhinsetzen zu einem Gespräch oder einer Versammlung, die des rechten Redners gewärtig ist. Vergl. die Nachweise Mittlere Sammlung Anm. 162 u. 186, sowie andere fein verwandte Stellen ibid. Anm. 532. Möglich allerdings und sogar wahrscheinlich, daß unter jenen still zur Seite Sitzenden sich auch manche befunden haben, die schon damals nur aus Klugheit stumm blieben, nach dem Empfinden, das am besten BOILEAU verrät, Sat. IX 48:
Le plus sûr est pour nous de garder le silence. –
Die aneinander gefalteten Hände am rechtwinklig gebeugten Arm gegen jemand emporzuheben gilt bei unseren Besuchern oben als Zeichen der dargebrachten Verehrung. Es ist ein Brauch, der heute noch, bei Buddhisten, wie bei Brāhmanen, genau so beobachtet wird wie einst, als añjaliṃ paṇāmeti nach unseren Texten, und añjaliṃ karoti oder prāñjalis tiṣṭhati nach ruti und Smṛti. Daß diese ehrerbietige Haltung, wie man sie überall in Indien Meistern, Lehrern und überhaupt höheren Personen gegenüber stets bei der ersten Begrüßung sehn kann, auch jetzt noch streng dem alten Vorbild entspricht, ist durch die Darstellung solcher Szenen in der Skulptur bestätigt. Auf den Hoch- und Flachreliefen der Kuppelmale ist diese Art der Huldigung unzähligemal veranschaulicht, schon in Barāhat aus dem 3.-2. Jahrhundert vor Chr., dann in Sāñci, ebenso in der Gandhārer Kunst (besonders eindrucksvoll ist da z.B. das Hochrelief aus Ṣāhbāzgarhī, in Anm. 657 näher bezeichnet), und außerordentlich edel und anmutig auf den späteren, in ihrer Eigenart und Vollendung sicher zuhöchst stehenden Reliefen von Amarāvatī. JOSEF STRZYGOWSKI hat denn auch diese mit klarem Blick als kunstgeschichtlich von bedeutendem Wert erkannt, nach eingehender Prüfung und Besprechung der dem Wiener kunsthistorischen Institut zur Verfügung gestellten Originalphotographien GOLUBEWS. Dabei hat mich STRZYGOWSKI auf den merkwürdigen Umstand hingewiesen, daß jene verehrende Stellung mit den aneinander gefalteten Händen wohl auch in der christlichen Kunst wiedergegeben ist, und zwar am genauesten entsprechend von BENOZZO GOZZOLI, wo sie bereits vollkommen [753] dem in Indien einheimischen Typus der Darstellung gleicht. Ohne Zweifel hatte nun GOZZOLI sie von GIOTTO übernommen, der sie auf der Legende von San Francesco und auch sonst häufig anwendet. GIOTTO aber hatte sein Vorbild an den ebenso stilisierten Engeln der Madonnen des CIMABUE, und dieser Vater der italienischen Malerei war in seiner Jugend von griechisch-byzantinischen Künstlern unterwiesen worden. Auf dem Fresko des Giudizio am Camposanto zu Pisa, links untere Seite, scheint mir sogar eine noch ältere, auf eine noch frühere byzantinische Tradition zurückweisende Wiedergabe ebenjener gekennzeichneten verehrenden Stellung, die gerade in Pisa auch auf der Madonna des BARNABA DA MODENA unverkennbar sich zeigt, überliefert zu sein: und da wir auf den Pisaner Fresken schon zweimal eine Verarbeitung ganz bestimmter indischer Anschauungen, durch Vermittlung der ägyptischen Thebaïs (cf. oben Anm. 316 und 625) erkannt haben, liegt es auch im gegebenen dritten Fall recht nahe, an die so oft auf dem bekannten syrisch-alexandrinischen Weg erfolgte Übernahme aus der ursprünglich indischen und hierbei durchaus landestümlichen Kunstperiode Asokos und seiner Nachfolger zu denken.
708 iminā pi kho te auch mit S. – Zur Anschauung von Mond und Sonne als himmlische Wesen cf. 13. Rede 172. Ebenso bei den Jainās, s. oben Anm. 641 letzter Absatz. Vergl. übrigens im Tasso den verwandten Ausdruck von der Welt die
ihren Weg
Wie Sonn' und Mond und andre Götter geht.
Es ist da wie dort und sonst eine Art verkörperter Geistverehrung, GIORDANO BRUNO in nuce. Nb den Begriff der Metakosmien, Anm. 293.
709 Von ähnlichen Abmachungen zwischen Freunden ist auch im Abendland öfters die Rede, als von einer nicht ganz ungewöhnlichen Sache. Ein Bericht, der in seiner munteren Einfalt unserem obigen sehr nahekommt, findet sich im Decamerone, in der 10. Novelle des 7. Tages, mit deren Erzählung der König diesen Tag beschließt. Zwei junge Leute in Siena, sagt er, waren innig befreundet, besuchten auch zusammen Kirchen und Predigten, und hatten da über Lohn und Strafe reden hören, die den Abgeschiedenen in der anderen Welt bereitet sei. Darüber wollten sie nun gewisse Kunde haben, und weil es anders nicht ging, versprachen sie sich gegenseitig, daß wer von ihnen zuerst stürbe zu dem Überlebenden, wenn er es vermöchte, zurückkehren würde um ihm die gewünschte Aufklärung zu melden: und das besiegelten sie mit einem Schwur. – Nun hat zwar BOCCACCIO, wie längst bekannt, manche indische Legende auf dem syrisch-arabischen Umweg überkommen und verarbeitet; im vorliegenden Fall wird aber kaum an historischen Zusammenhang, vielmehr an eine gemeinsame Stufe geistiger Entwicklung zu denken sein. Der König des Decamerone und Pāyāsi der Kriegerfürst sind verwandt als Gestalten eines gleichartigen Rinascimento. Pāyāsis versuchsweise Erfahrung und Ansicht, daß es nach dem Tode keine Rückkehr gebe, ist übrigens zugleich der Ausdruck eines ihm gewiß bekannt gewesenen, gern genannten Spruches aus der ruti, im Bṛhadāraṇyakam Ende des 4. Buches erhalten:
Der Mensch, vom Tode hingestreckt,
Aus welcher Wurzel wüchs' er neu?
– – – – – – – – – – – – – – – – –
Geboren war er, wird nicht mehr,
Wer könnt' ihn wieder schaffen her?
[754] Hier ist die Person des einzelnen gemeint, die allerdings bei jeder Auflösung unwiederbringlich verlorengeht, während die dauernden Lebenskräfte immer erneute Gestalten erzeugen, so daß der Verstorbene, auch wenn er wiederkehrte, da etwa als Geist wiedererschiene, keineswegs mehr der selbe, vielmehr schon ein anderer wäre; wie doch bereits in diesem Leben und seinem rastlosen Flusse der Jüngling vom Greise gar merklich verschieden wird, unbeschadet der wechselnden Schaffenstriebe. Daher ist der alte vedische Spruch mit der Ansicht Pāyāsis wohl zu vereinen und besteht ebenso zu Recht wie das Wort Hamlets vom unentdeckten Land, aus dessen Kreis kein Wanderer zurückkehrt, trotz oder besser: wegen der eben nur wechselweise gültigen Geisteserfahrung des Prinzen. Es ist zwar kein anderer, aber nicht mehr der selbe.
710 Mit S te te sādhūti paṭissutvā. – Der drastische Brauch, zum Tode Verurteilte vor der Hinrichtung unter schrillem Trommelgewirbel von Straße zu Straße, von Platz zu Platz zu treiben, dem Volke zur Abschreckung, besteht heute noch in Montenegro.
711 āmuttamaṇibharaṇassa, so mit S; nimmujjitukāmyatā wie bhottukamyatā in der 5. Rede des Majjhimanikāyo, wo S mit M richtig okamyatā hat. Ebenso dann paṭikūlo, bez. paṭikulyatā.
712 Zur Metaphysiologie des Duftes cf. Mittlere Sammlung Anm. 530, sowie Dhammapadam v. 56 gegenüber Hamlet III 3 36: O, my offence is rank, it smells to heaven. Nach HIPPODAMAS:
Ω ϑειοι, ποϑεν εστε, ποϑεν τοιοιδ' εγενεσϑε;
ανϑρωποι, ποϑεν εστε, ποϑεν κακοι ώδ' εγενεσϑε;
Wie ja schon Telamon, der Vater des Ajax, es gesagt hat, daß Götter mit Menschen nicht gemein sein wollen, bei CICERO, De natura deorum III 32. Vergl. noch das Wort MENANDERS, oben Anm. 321 Ende.
713 Auf eine nicht unähnliche Weise hat die Seherin von Prevorst sich JUSTINUS KERNER gegenüber ausgesprochen: »Selige Geister«, sagte sie einmal, »können sich nicht hörbar machen, spuken nicht. Unselige Geister sind dieß am meisten zu thun fähig.« Ausg. Stuttg. 1832 I 235. KERNER selbst berichtet II 60, es »war der Glaube LUTHERS an die Möglichkeit eines Wiedererscheinens Verstorbener, und selbst an Geisterspuk, sehr groß, wie auch seine Schriften uns mehrere ihm selbst widerfahrene Geistererscheinungen aufbewahren. Auch MELANCHTHON war der vollen Überzeugung, daß Verstorbene sich noch Lebenden zu offenbaren vermögen, wovon er aus seiner eigenen Familie ein auffallendes Beispiel anführt.« Er fährt dann S. 63 fort: »Nicht selige Geister sind es, die aus diesem Zwischenreiche erscheinen, nicht reine, durch himmlisches Licht erleuchtete Geister; nein, es sind Hinübergegangene aus der gemeinen Menschenwelt, denen ihre Werke, ihre Begierden und Gewohnheiten, die Irrtümer, die sie in dieser Welt hatten, nachfolgten.« Im obigen Fall ist nun freilich am besten das Orphische Wort GOETHES anzuwenden:
Ein Flügelschlag – und hinter uns Äonen!
714 Mit S besser cirakālakatā pi. – Nach den obigen Angaben beträgt die Lebensdauer im Bereiche der Dreiunddreißig, menschlichen Begriffen angepaßt, 36 Millionen Erdenjahre: das ist also ein Platonisches Jahr plus 10,000 und multipliziert mit 1000. Eine solche Daseinsdauer ist uns, als Biologen der Elektronen und Lichtäthermonaden, die wir ja längst über den promethidischen Zeus hinaussehn haben lernen, freilich nicht mehr allzu erstaunlich; sie ist auch geringfügig im Vergleich zur Lebensgrenze höherer Götterwesen. Brahmā z.B. der noch bei weitem nicht zu den höchsten Sphären [755] gehört (vergl. Anm. 21), besteht 100 Jahre, wo jeder Tag und jede Nacht je ein Kappo (kalpas) ausmacht, darin das Kaliyugam oder Eiserne Zeitalter als Einheit 10000 mal enthalten ist: eine solche eherne Äon währt aber 432000 Erdenjahre, das Lebensalter eines Brahmās, selbst wieder geringfügig gegen die zentillionische Maßeinheit (1000000100) der ferneren Sphärenläufe, erstreckt sich demnach über 311 Billionen Jahre. Zur Versinnlichung solcher fast undenkbarer Begriffe dient recht gut eine Stelle aus dem 16. der Kosmologischen Briefe von LAMBERT, dem ausgezeichneten Mathematiker und Freunde KANTS. Es hört sich in der Tat wie ein begleitender Kommentar zu unseren indischen Äonen an, wenn da, ungefähr in der Mitte des Briefes, über die Zeitbahnen der Fixsterne gesprochen wird: »Auf diese Art«, schreibt LAMBERT, »werden Sie Sonnen finden, die ihren Lauf von System zu System, oder gar von Milchstraße zu Milchstraße fortsetzen. – Es wird die Frage seyn, ob ein Platonisches Jahr zureiche, bis unsere Sonne einmal in ihrem Kreyse herum kömmt; oder ob sie in einem solchen Jahre kaum ein Zeichen von ihrem Thierkreyse durchlaufe? Da die Sonne nahe bey dem Mittelpuncte des Systems ist, so mag dieses Jahr noch klein seyn gegen demjenigen, welches die äußersten Sonnen des Systems zu ihrem Umlaufe gebrauchen. Wie wird erst das Jahr aussehen, in welchem ein System herum kömmt; und in welcher Zeit wollen wir die Milchstraße im Kreyse herum führen? Zeiten von dieser Dauer wollen wir Augenblicke der Ewigkeit nennen.« Als Augenblick eines derartigen Augenblicks der Ewigkeit gilt heute die astronomische Einheit des Lichtjahrs mit seiner neunbillionen Kilometerweite. Ein merkwürdig analoges Zeitmaß ist schon bei SEUSE zu finden, im 11. Kapitel des Büchleins von der ewigen Weisheit, in einem Gleichnisse, das ihm irgendwie östlich zugekommen sein mußte und späterhin ziemlich verbreitet war. Es sieht recht indisch aus, fast wie dem Saṃyuttakanikāyo (vol. II p. 181) entnommen, und besagt: Wenn da ein Mühlstein wäre, so breit wie alles Erdreich und ringsherum so groß, daß er an den Himmel allenthalben heranreichte, und es käme ein kleines Vögelein je über hunderttausend Jahre und pickte von dem Stein soviel ab wie der zehnte Teil eines Hirsenkörnleins ist, und wieder über hunderttausend Jahre soviel, daß es alle zehnmal hunderttausend Jahre immer soviel wie ein ganzes Hirsenkörnlein vom Stein abgebröckelt hätte: da würde doch einst des Steines ein Ende sein; aber kein Ende ist der Zeit und Qual – »daz mag nit sin.« – Wie der indische Kalender annimmt hat das Kaliyugam, in dem wir uns gegenwärtig befinden, kaum erst zu dämmern begonnen: die Kulmination dieses übelartigen Zeitalters, mit der ihr eigentümlichen fortschreitenden Entartung aller geistigen Kultur wird erst um das Jahrtausend 36 beginnen (= 33. Jahrtausend nach Christus), über 300000 Jahre andauern, allmählich dann wieder zur Abenddämmerung abflauen, worauf der Turnus der anderen Perioden, des goldenen, silbernen, kupfernen Zeitalters im Kreislaufe wieder aufdämmernd sich weiterwälzt, wieder bis zum folgenden Kaliyugam abdämmernd, und so weiter im Wirbel der Trillionen. Vergl. FLEETS übersichtliche Ausführungen, Tafeln und Formeln im Journal of the Royal Asiatic Society 1911 p. 479-496, der mit Recht darauf hinweist, daß dieser echt indische Begriff der Weltperioden auf den Inschriften Asokos deutlich vorgetragen ist, auf dem vierten und fünften Felsenedikt; welche zwei Stellen übrigens schon in unserer Anm. 20 eben in diesem Zusammenhange gebührend hervorgehoben und noch weiterhin verglichen wurden – auch dem Winke nach, den EMPEDOKLES angab:
και γαρ και παρος ην τε και εσσεται, ουδε ποτ' οιω
τουτων αμφοτερων κεινωσεται ασπετος αιων.
[756] Dergleichen sphäroïdale Gedankengänge und -spiele sind, nach ihren sicheren Gesetzen, ohne Zweifel am schönsten unmittelbar empfunden und dargestellt in BACHS – der Name tut nichts zur Sache – Credo der H-Moll-Messe; eine Bemerkung, wie ich wohl weiß, die nur bei wirklich vertrauter, inniger Kenntnisnahme ihre Komik verliert, und dann erst den Ausruf WAGNERS, nach einer solchen Anhörung, verstehn lehrt: »Das sind elementare Planetenkräfte, physisch belebt.«
715 Das himmlische Auge des Menschen, der Blick über den Horizont hinaus, ist bereits im Jaiminīyam Upaniṣadbrāhmaṇam klar angedeutet, I 43, wo es heißt: yo 'yaṃ cakṣuṣi puruṣa ... eṣa paro divo dīpyate, etc. Cf. noch die Stellen aus dem Bṛhadāraṇyakam sowie jene von einem unserer eigenen Illuministen, die zu v. 378 der Bruchstücke der Reden angegeben sind. Nicht minder tief und zugleich ganz modern HERAKLIT, bei SEXTUS EMPIRICUS, adv. Math. VII 126: Κακοι μαρτυρες ανϑρωποισιν οφϑαλμοι και ωτα, βαρβαρους ψυχας εχοντων. Freilich sagt wohl auch der Wahrspruch des LUKREZ, IV 382/3, ernst genug:
Hoc animi demum ratio discernere debet,
Nec possunt oculi naturam noscere rerum.
Aber wie es zu fassen und was daraus zu machen sei, hat uns – von Meister ECKHART und den Seinen abgesehn – erst Indien in vollendeter Pracht und bis auf den Grund erschlossen. Gewissermaßen als ein schwaches Gegenbild hierzu ist das Zweite Gesicht, wie bekannt, manchmal entwickelt. Jenes hohe geistige Gesicht aber erblickt eben die Dinge so rein wie ein scharfsehender Mann, nach dem schönen Gleichnisse unserer 2. Rede (S. 56), der am Ufer eines Alpensees steht und durch das lautere ungetrübte Wasser bis herab auf den Kies und Sand und die Fische, wie sie dahingleiten oder stillestehn, alles erschauen kann: wie ein Abbild, dessen Sinn er versteht. Diese geistige Deutung der höheren Sehkraft des einen Auges, eben des himmlischen, das über die gewöhnlichen Verhältnisse hinauszublicken vermag, ist sogar in volkstümlicher Darstellung nach Sprüchen einer Legende des Mahājanakajātakam (ed. FAUS-BØLL Nr. 539, vol. VI p. 66 v. 165-167) auf einem Relief am Kuppelmal von Barāhat mit überlegenem Humor veranschaulicht. Man sieht da, wie ein Bogner einen krummen Pfeil mit dem linken Auge visiert um ihn wieder gradezuziehen, da die Schlichtung und Schlichtheit ja nur mit dem einen Auge zu prüfen und auszukunden ist; bei welcher Beschäftigung er, auf die Frage eines ihm lächelnd gegenüberstehenden Asketen, den tieferen Aufschluß dazu metaphorisch in Merksprüchen gibt: daß nämlich der Mensch mit seinen zwei immer gleichsam über das Ziel hinausschweifenden Augen nur zerstreut und verwirrt werde, weil er doch nicht zuzweit sondern lediglich selbst die Schlichtung und Einheit ausfinden, die gerade Linie erkennen und einhalten, in himmlische Welt gelangen könne. Die genaue Beziehung dieser Skulptur und ihrer Inschrift aus dem 3.-2. vorchristl. Jahrhundert zu unseren überlieferten Pālistrophen im Jātakam ist von HULTZSCH im Journal of the Royal Asiatic Society 1912, S. 404f. sorgfältig beschrieben und erklärt worden, mit guter Wiedergabe des Reliefs nach der Aufnahme CUNNINGHAMS in dessen Stūpa of Bharhut T. XLIV 2. Dieses Relief ist dann, mehr allgemein und typisch betrachtet, zugleich, wie das auch sonst vorkommt, hier aber ganz offenbar sich zeigt, als eine pars pro toto zu erkennen, das heißt eine Illustration zu einer bestimmten Klasse von Gleichnissen, als deren berühmtestes jenes vom hobelnden Wagner gilt, am Schlusse der 5. Rede der Mittleren Sammlung (S. 33f.), mit der selben Vorführung der Personen und Entwicklung des Gesprächs zwischen dem Handwerker und dem dabeistehenden Asketen, bis zur abschließenden [757] Umdeutung auf das geistige Auge; wie denn auch die einst so gern wiederholten Strophen 19, 29, 878 der Lieder der Mönche und ebenso im Wahrheitpfad v. 80, 145 dazugehören: ein derart beliebt gewordenes Bild, daß es später noch im Sāṃkhyasūtram usw. einen Ehrenplatz erhielt, wo es z.B. IV 14 erscheint als iṣukāravannaikacittasya samādhibāniḥ, ›dem Bogner gleich eins im Geist erzielend wird man unverstört.‹
716 Mit S upamāya pi, wie auch C etc.
717 S richtig natthi tuyh'ettha kiñci, pitu me santako bhoti, dāyajjaṃ niyyādehi. Genau nach Manus X 105: Jyeṣṭha eva tu gṛhṇīyāt pitryaṃ dhanam a eṣataḥ. Der älteste Sohn ist Universalerbe und hat als solcher alle anderen zu erhalten, an Vaters statt. Unter den obigen Umständen ad absurdum geführt.
718 S uppātesi für uppāṭesi wie richtig Majjhimanikāyo vol. II p. 110, ed. CHALMERS. Zur Anordnung der Wohnräume im altindischen Haus cf. oben Anm. 689; die prächtige, augenfällig klassisch anmutende Mittelhalle auf Säulen, dazwischen die emporgerollten golddurchwirkten Teppiche, im Hintergrunde der Eingang ins dunkle innere Gemach, vorn eine Gruppe reichgeschmückter edler Frauen in langen weißen faltigen Schleiern mit Mädchen in zarten bunten Gewändern, ist gut veranschaulicht auf dem auch künstlerisch wertvollen Miniaturgemälde zum Rāmcaritmānas des Tul'-sīdās im kostbar verzierten und ungemein sauber ausgeführten Manuskript von 1647, das dem Mahārājā von Benāres gehört: nach einer Photographie wiedergegeben von GRIERSON als Titelbild zu seiner Modern Vernacular Literature of Hindustan, Kalkutta 1889. – Die so qualvoll erzwungene Neugier bei unserer Parturientin erinnert in Hohn und Tücke an die nicht minder peinvolle Drangsal, in der sich, wie der Schalksmund erzählt, die schwangere Päpstin Johanna befunden, als ihr ein Teufel zusprach, BAYLES Dictionaire, Amsterdam, 1740, III fol. 585a:
Papa pater patrum, papissae pandito partum.
719 Der vorzeitige, meist durch Verhungern freiwillig herbeigeführte Tod ist nach altüberlieferter Büßerregel, Manus VI 31, bei höheren Asketen beliebt und in Ansehn gewesen, auch im Mahābhāratam gepriesen, ja gilt heute noch vielfach, zumal bei den Jainās, als die strenge Norm. Vergl. BÜHLERS Vortrag »Über die indische Secte der Jaina«, Wien 1887, S. 12 und 37 Anm. 10. Genau solchen Grundsätzen entsprechend beenden auch die eifrigen buddhistischen Asketen in Tibet und China ihr Leben: ein jüngster Bericht im Journal of the Royal Asiatic Society 1911 p. 713f., von PERCEVAL YETTS, dem ausgezeichneten Kenner Chinas und insbesondere des chinesischen Buddhismus, beigebracht. Kassapo aber hat schon damals diesen Brauch mit richtiger Begründung abgewiesen. Er zog jene gesetzte Frömmigkeit vor, von der auch unser GOTTLIEB KONRAD PFEFFEL sanft zu rühmen wußte, daß sie »den Dulder mit dem Schicksal aussöhnt und ihm den Mut gibt, bis ans Ende auszuharren.« Oder wie FERNANDO DE HERRERA es mit großartigem dichterischen Schwunge sagt, lib. II son. 132:
Muero y vivo en la vida y en la muerte,
Y la muerte no acaba ni la vida,
Porque la vida crece con la muerte. –
Gleichwohl wird das mit Absicht herbeigeführte Ende, der Freitod des Asketen, gelegentlich auch in unseren Texten, und zwar von Gotamo selbst, als untadelhaft dargestellt, so Mittlere Sammlung S. 1051, Bruchstücke der Reden Anm. 1146; vergl. auch [758] Saṃyuttakanikāyo vol. V p. 320. In den Liedern der Mönche kann man einen verwandten Spruch, der dem von HERRERA langehin mächtig vorangeklungen ist, wiederholt bei den tüchtigsten und bedeutendsten Jüngern vernehmen, v. 20, 196, 606, 1002:
Ich freue mich des Sterbens nicht,
Ich freue mich des Lebens nicht:
Geduldig trag' ich ab den Leib,
Gewitzigt weise, wissensklar.
Pāyāsi freilich hat zuvor seine unverkennbare Geringschätzung gegen die Asketen und Priester merken lassen, die tugendhaft sind, edle Vorsätze haben und zu leben begehren, nicht sterben wollen, Wohlsein wünschen und Wehe verabscheuen, die zwar von der Nichtigkeit und Flüchtigkeit des Daseins immer brav reden, dabei aber hübsch am Leben bleiben und alt werden, also offenbar im Widerspruch mit ihrer Lehre stehn: bei seiner einseitig gültigen, bloß weltmännischen Erfahrung scheint er ja Recht zu haben, wenn er sie für Leute hält »unbußhaft, die wie Büßer tun«, assamaṇe samaṇamānine, nach Suttanipāto v. 282, oder kurz gesagt: für fanfarons de vertu, wie es Tartufe I 6 heißt. Kassapos Erklärung zeigt jedoch genügend den Unterschied an, auch insofern.
720 So richtig S. Vergl. Mittlere Sammlung 399 Ende. Dieselben Traumgesichte hatte auch Yājñavalkyas erwähnt, das Leben wie einen scheinvollen Schlaf und Schlummer deutend, im Gespräch mit Janakas, dem Fürsten der Videher, Bṛhadāraṇyakā 4. Buch 3. Abschnitt. Es ist nicht unwahrscheinlich, daß Kassapo im Gespräch mit unserem Kriegerfürsten auf jene altberühmte Stelle mit Bezug nehmen mochte. – Aus einer ähnlichen Stimmung und Betrachtung spricht der Herzog in Maß für Maß, III 1 31-33:
Thou hast nor youth, nor age,
But, as it were, an after-dinner's sleep,
Dreaming on both.
Diese Erkenntnis vom träumenden Leben hat später der Denker zu Endegeest am Eingang eines Dialogs als Kern seiner Weltansicht ungemein sauber vorgelegt: Cogito, ais. – Nego. Somnias te cogitare. – Hoc ais, voco Cogitare. – Male vocas. Ficum ego ficum voco. Somnias. Hoc habes. – CARTESII Dissertatio de prima philosophia § 7. Hiermit ist, scheint mir, die yājñavalkische und kantische Erkenntnislehre so glatt wie möglich zur Strecke gebracht; wie es ja, auf solche Weise zusammengreifend, einmal hypothetisch in der Kritik der reinen Vernunft heißt, man könnte sagen: daß alles Leben eigentlich nur intelligibel sei, weder durch Geburt angefangen habe, noch durch den Tod geendigt werde, nichts als eine bloße Erscheinung, und die ganze Sinnenwelt ein bloßes Bild sei, welches unserer jetzigen Erkenntnisart vorschwebt, und, wie ein Traum, an sich keine objektive Realität habe: Transszendentale Methodenlehre, 1. Hauptstück 3. Abschnitt gegen Ende.
721 passissasi mit S, C etc. – Vergl. die vedische Sage von Viṣṇus dem Schützer als Zwerg, Vāmano ha Viṣṇur āsa, wie atapathabrāhmaṇam I 2 5, 5 usw.; auch die mehr oder minder dämonischen Gestalten, schirmende Zaubermacht gewährenden Erdgeister, Ouerxe und Zwerge als Hüter vor Tempeleingängen, in der alten Skulptur gern im Relief dargestellt. Es sind Giant-dwarfs, nach SHAKESPEARES Ausdruck, Riesenzwerge an Macht. Die Fächelfrauen und Fräulein, celāvikā pi komārikā pi, die den König zu[759] betreuen und zu bedienen haben, sind nach Manus VII 219 ebenso, als zur höfischen Sitte gehörig, vorgeschrieben: Parīkṣitāḥ striya cainaṃ vyajanodakadhūpanaiḥ, veṣābharaṇasaṃ uddhāḥ spṛ eyuḥ susamāhitāḥ: als altes Herkommen, wie er selbst es beobachtet hat, durch MEGASTHENES bestätigt, bei STRABON p. 710: Τῳ βασιλει δ' ή μεν του σωματος ϑεραπεια δια γυναικων εστιν: »Die persönliche Pflege des Königs obliegt den Frauen«; und er fügt, ebenso zutreffend, alsbald noch hinzu, daß sich die Leibwache und die übrige Mannschaft außerhalb der Tore befinde. Pāyāsis, des Kriegerfürsten und königlichen Prinzen, Angabe wie er behütet werde, und wer ihm unmittelbar zunächst sei, wenn er der Ruhe pflegt, ist demnach, abgesehn von der Beziehung auf den gegebenen Fall und die Schlußfolgerung, dem vedischen Zeremoniell bei Hofe durchaus gemäß.
722 Ein Leichnam wird bekanntlich bei der wässerigen Zersetzung, wann das Blut gerinnt, sogleich durch Anziehn von Feuchtigkeit, Anschwellen usw. wirklich, sogar bis um ein paar Kilo, schwerer. Die Jainās, die unseren ganzen Bericht von Pāyāsi sehr schön bearbeitet und erweitert haben, in ihrem eigenen Bericht über Paësi, wie er bei ihnen heißt, weichen hier ab, wie ihre Naturkenntnisse ja auch sonst mehr oberflächlich sind: der Kriegerfürst läßt den Verbrecher erst lebendig und dann tot abwägen, und es ergibt sich dabei kein Unterschied; daraus folgert er, daß Leib und Leben ein und dasselbe sei, also kein Lebensgeist bestehe. Eine ungemein sorgfältige Wiedergabe des gesamten, ebenso reichhaltigen als wichtigen Stücks dieser jinistischen späteren Überlieferung verdanken wir LEUMANN: siehe den Nachweis in der nächsten Anmerkung.
723 addhamato = ādhmātaḥ. Daher dann uddesapariyāyena der sankhadhamūpamo. – Die Strafe des Erstickens wurde durch Erwürgen, Erdrosseln, wie beim Bayrischen HIESEL, oder bloß durch Erhängen vollzogen, an sich das selbe. Vergl. bandhanam = vadhaḥ; auch Therīgāthā 191, 345 vadhabandhapariklesam. Einen erweiterten Kommentar gibt MERLINUS COCCAIUS, De patria diabolorum, Biblioth. St. Victor fol. 141. Mit was für einer rein phantastischen Willkür die beiden RHYS DAVIDS gegen den Text vorgegangen sind, zeigt sich, wie regelmäßig, auch hier: diesmal aber unter besonders leichtfertigen Umständen, da ihr Vorgänger, den sie weder nennen noch überhaupt zu kennen scheinen, längst das Richtige getroffen hatte. Es heißt oben: »Wohlan denn, ihr Leute, ihr sollt diesen Mann, unverletzt an Haut und Gewebe, Fleisch und Sehne, Knochen und Knochenmark, zu Tode bringen«; und diese Stelle hat der tüchtige Straßburger Indolog ERNST LEUMANN in seiner von ihm zuerst veröffentlichten, paraphrasierenden Übersetzung unserer ganzen 23. Rede so wiedergegeben: »ich ließ ihn, ohne daß ihm dabei ein Härchen gekrümmt wurde (anupahacca chaviñ ca cammañ ca u.s.w.) umbringen«, Actes du sixième congrès international des orientalistes, tenu en 1883 à Leide, troisième partie, section seconde, p. 479. Hieraus hat dann, fünfzehn Jahre später, der zweite Bearbeiter dieser Rede, der Jesuitenpater und nicht unbegabte Sanskritiker JOSEPH DAHLMANN, den Satz, freilich ohne nähere Angabe, ziemlich wörtlich übernommen: »ich ließ ihn umbringen, ohne daß ihm dabei ein Härchen gekrümmt wurde«, Buddha, ein Culturbild des Ostens, Berlin 1898, S. 159. Da kommen nun die beiden RHYS DAVIDS, fast dreißig Jahre nach jener ersten, schon richtigen Wiedergabe, und schwätzen, ohne sich irgend umgesehn oder was gelernt zu haben, schlechtweg in den Tag hinein, bringen eine Version, würdig ihrer sonstigen Flausen und Schwänke: »Well, my masters, kill this man by stripping off cuticle and skin and flesh and sinews and bones and marrow«, Sacred Books of the Buddhists vol. III, Dialogues of the Buddha, part II, London 1910, p. 361. Es ist also – [760] wir sind das bei solchen Forschern (billigerweise sei hinzugefügt: und noch so manchen wendischen Gaubrüdern) lange gewohnt – nur Gänsegeschnatter der Klerisei, wie BÜRGER dergleichen nennt, d.h. Wort und Sinn des Textes mißverstanden und in das Gegenteil verkehrt worden, und zwar schon bei einem nicht gar schwerbegreiflichen, grob äußerlichen Gegenstand und seiner Behandlung und Darstellung; weil eben die lieben Amateursozietäre bei selbständigen Schritten sich hübsch in acht nehmen müssen vor verborgenen Fallstricken, da man nie wissen kann. Und gut angebracht wäre zunächst Hinzes fragende Sorge:
Glaubt Ihr, sagte der Kater, es sei hier sicher zu kriechen?
Denn es haben mitunter die Pfaffen auch Böses im Sinne.
724 muñcanīyo, nach S muñcaniyo, zu lesen. Dann wieder kassa mit S und M. Zur Pflege und Wertschätzung der Musik cf. die Nachweise Anm. 523, 651 und 921; zur Blasmusik im besonderen und allgemeinen: Mittlere Sammlung Anm. 312 – Nach dem prächtigen Bardenlied »Kyng Estmere«, aus dem Anfang des 15. Jahrhunderts, in PERCYS Reliques I Nr. 6, heißt es 233-236 ähnlich vom Spiele des minstrel:
He strucke upon his harpe agayne,
And playd both fayre and free;
The ladye was so pleasde theratt,
She laught loud laughters three.
725 Dieses Gleichnis entstammt einer wohlbekannten Stelle des Bṛhadāraṇyakam (II 4 9): Sa yathā ankhasya dhmāyamānasya na bāhyāñcchabdāñcchaknuyād grahaṇāya; ankhasya tu grahaṇena ankhadhmasya vā abdo gṛhītaḥ. Es ist also treu überliefert, ohne Zweifel im Bewußtsein, daß es von Yājñavalkyas selbst gegeben wurde: wie ja auch Gotamo gelegentlich Worte dieses großen Weisen anführt, cf. die Anm. 401 u. zumal 402 sowie Mittlere Sammlung Anm. 411.
726 Das von Pāyāsi immer wieder vorgebrachte Gleichnis aus dem Strafrecht ist zuerst in der Chāndogyopaniṣat gegeben, im letzten Abschnitt des sechsten Teils: Puruṣaṃ hastagṛhītam ānayanti: ap āhārṣīt steyam akārṣīt, para um, asmai tapata. Ebendort, im zwölften Abschnitt, ist der Grundgedanke zur oben folgenden Ausführung Pāyāsis zu finden. Um seinem Sohne vetaketus den Ātmā oder das Selbst nachzuweisen, heißt ihn der (als Vorgänger des Yājñavalkyas überlieferte) Seher Uddālakas eine Feige pflükken, sie spalten, sodann eines der winzigen Körner zerschneiden, und fragt ihn nun, was er darin sehe: der natürlich sieht gar nichts darin; worauf ihn der Vater belehrt, daß eben aus dem Unwahrnehmbaren der so mächtige Baum entstanden sei: dieses Feinste aber, das ist der Ātmā, das ist das Selbst, das bist du. – Unser Kriegerfürst ist freilich von dem einmal eingeschlagenen Wege nicht mehr abgewichen, wo denn der schöne Begriff der Upanischad, weit in den Hintergrund entrückt, kaum noch erkennbar bleibt; so daß Pāyāsis furchtbar vergröberte Psychometrie sich eher jenen Versuchen annähert, die nach SWIFT die Naturforscher der Universität von Lagado eifrig betrieben haben, als sie aus dem stercus hominis das nutrimentum originale wiederherzustellen hofften. Auch könnte man sagen, Pāyāsi habe die Seele, wie der Freimaurer die Freude, »durch den Riß gesprengter Särge« sehn wollen. Oder er habe den Knoten zerhauen wie unser Meister der freien Künste JOHANN AMBROSIUS HILLIGE in seiner Anatomie der Seelen: nämlich so durchschneidend, daß man mit LISCOW »bekennen muß, die Vernunft habe an ihm ihren Mann gefunden, und sei nimmer so gemißhandelt worden«.
[761] 727 Der Gebrauch des vedischen Feuerzeugs, aus Holzscheit und Reibholz bestehend, ist in der 119. Rede der Mittleren Sammlung (S. 895) von Gotamo selbst dargestellt, gelegentlich der Ausführung eines Gleichnisses anderer Art; ebenso auch an der berühmten autobiographischen Stelle der 36. Rede (270-271). – Der Feuerdienst vedischer Einsiedler ist in der 3. Rede (S. 69) sehr gut näher bestätigt. Cf. auch Bruchstücke der Reden No. 30.
728 So S, C etc.
729 Solche Zugführer waren oft zugleich reiche Kaufherren: in dieser doppelten Eigenschaft hat z.B. ein gewisser Nāgo den Jüngern der vier Weltgegenden eine Felsenkammer zu Schirm und Obdach gestiftet, bei Kuḍā, auf einer Inschrift aus dem 2. Jahrh. n. Chr.: Archaeological Survey of Western India vol. IV p. 88, Tafel XLVI; ebenda nennt sich noch mit einer gleichen Schenkung die Frau des Zugführers Ve[g]hamit[t]o, sowie ferner mit einer dritten Bergesgrotte der Sohn des Zugführers Acaladāso. Desgleichen sind andere Gilden, auch Ärzte, Priester und hohe höfische Würdenträger daselbst vertreten.
730 ākiritvā mit S und M.
731 Mit S richtig hariyissasi.
732 Die Parabel vom Schweinefutter, oder vielmehr Dreck für Schweine, sieht auf den ersten Blick einer derben Eulenspiegelei zum verwechseln ähnlich. Wenn man aber genauer hinschaut, eröffnet sich, wie so oft bei unseren Gleichnissen, ein arthāntaranyāsas, ein tiefer gegründeter Sinn, der nach innen gelegen den eigentlichen Kern ausmacht, weit gewichtiger als die bloß vermittelnd vorgezeigte Hülle, die an sich freilich nicht minder gültig ist und zu Recht besteht. Kassapo kleidet hier, im Gespräch mit einem dilettierenden Hofmanne, den Gedanken ebenso leicht kennbar ein, wie es Gotamo z.B. mit dem schmutzigen Mantel, dem ölrußgeschwärzten Schinderhemde, einem Priester gegenüber getan hat, in der 75. Rede der Mittleren Sammlung. Auch dort ist das Tertium comparationis die Natur, deren Trug und Ekel vom Blindgebornen nicht wahrgenommen wird, ihm als »gar fein, ohne Flecken und sauber« vorgetäuscht, bis er, durch eine Kur allmählich sehend geworden, alsbald voll Entsetzen den Unrat merkt und den scheußlichen Mantel abwirft: ein wohlbekanntes, berühmtes Gleichnis, auf das Kassapo vorher, oben S. 405 jedem Hörer damals sofort verständlich, schon angespielt hatte. Die Drecklast sowie das Schinderhemd sind also verwandte Metaphern, geeignet auch Ānandapulakadevasenern oder göttlichen Wonnegrunzern ein klein wenig die Augen zu öffnen und den Mund ein Weilchen verhalten zu lassen nach dem sattsam überfließenden und immer fader wiedergekäuten Gefasel über die Weltseele und ihre Herrlichkeiten, wo doch, ernstlich untersucht, selbst der höchste ātmā = gūtho, Kot ist; so daß eben nur Prälaten und Brüllaten mit ihrem Truthahngekoller, oder fools of nature daran Gefallen finden mögen, ohne zu fragen:
Say, why is this? wherefore? what should we do?
Auf ähnliche Weise ist das oben sich dann anschließende Bild vom armen Würfelspieler mit seinem krassen Schwarz arthāntaranyāsena zu betrachten, so daß eben das Licht von innen hervorblitzt, nach dem Ende der 129. Rede der Mittleren Sammlung. – Cf. noch Anm. 337.
733 paccoharissāmi zu lesen, nach S pajoharissāmi; C pajahissāmi.
734 Richtig mit S akkhadhuttakūpamo. – Hiermit hat Kassapo die letzte Stufe geistiger Erniedrigung angedeutet: denn das Elend, in das der Spieler, einmal in die [762] Tiefe gesunken, ohne Rückhalt, ohne Scheu, infolge seiner jämmerlichen Zuversicht auf einen glücklichen Ausgang, wie oben gezeigt, früher oder später gerät, ist grenzenlos um ihn bereitet und führt ihn allmählich oder geradewegs über Verzweiflung, Verbrechen und Mord schon hienieden in höllische Welt, wo es keinen gerechten Wandel, kein hilfreiches Wirken, kein Erbarmen und Mitleid mehr gibt: »einer den anderen auffressen ist dort der Brauch, den Schwachen ermorden« (Mittlere Sammlung S. 962) nach dem Gesetze des betrogenen Betrügers und seiner teuflischen Rache. Was unser Gleichnis oben, zugleich mit der Beziehung auf den geistigen Vabanque Spieler, in meisterlicher Kürze dargestellt hat, ist in einer erstaunlichen Szene des Mṛcchakaṭikam breit ausgeführt, wo der arme Würfler – bekanntlich ein uralter indo-europäischer Typus – gänzlich entblößt und verkommen, immer mehr Pech und Drangsal, Schimpf und Schmach, Grimm, Wut und Verfolgung erfährt, bis er endlich, in einer entscheidenden Katharsis erschüttert, sich packt und – Bettelmönch wird, von dannen zieht mit dem Siegesruf: »Der Würfelspieler ist zum Sakyerasketen geworden«, gegen Ende des zweiten Aufzugs; eine Szene, nebenbei gesagt, die da Kenner der Höhen und Tiefen des menschlichen Gemüts in ihrer glühenden Lebenswahrheit nicht minder ergreift als die ganz analoge, wann der unter der Wucht seines Schmerzes völlig niedergebrochene Tannhäuser Ende des zweiten Aktes plötzlich frohlockend zur Pilgerschaft aufbricht. Grundmotiv ist hier wie dort und oben die Verzweiflung als Ausgangspunkt einer Wendung nach faustischer Art, v. 608/11.
735 adhigacchi mit S, C etc. Dann mit S sāṇabhārikūpamo.
736 Vergl. Mittlere Sammlung Anm. 60. Es scheint, nach dieser echt indischen Diatribe, daß Pāyāsi der Kriegerfürst als Skeptiker und esprit fort Kumārakassapo gegenüber sich ungefähr so habe zeigen wollen wie es bei uns, in der Zeit einer ähnlich frondierenden Dialektik, DIDEROTS letzter Ausspruch empfohlen hat: »Le premier pas vers la philosophie, c'est l'incrédulité.« Ohne das tiefe Gemüt und den scharfen Verstand eines Dhammarājās und Weltbeherrschers wie Asoko oder auch Khāravelo und Kaṇiṣkas es späterhin waren, glich er nach Anlage und Fasson etwa unserem tapferen großen FRIEDRICH, ohne feineres Wissen und auch ohne gründliche Kenntnis und Bildung, und war daher wie dieser ein wohlaffektionierter Liebhaber der philosophie pour le monde, des lokāyatam, des āstram des Sensualismus pur et simple, wie ihn Cārvākas Bārhaspatyas, der indische Baron HOLBACH, als Système de la nature längst in ebenso guter Absicht und ebenso beschränkt aufgestellt hatte: ›Priesterkunde ist eitel, es gibt nur Materie und ihre Entwicklung‹: 1. Rede S. 41, Sarvadar anasaṃgrahas Kap. 1. nach der jedenfalls altüberlieferten Carakasaṃhitā. Die beste Rechtfertigung solcher kritischen Geister, vom gelangweilten Hofmann an, der in Mußestunden und -nöten Auchdenker ist, bis zum vollendeten Alleszermalmer, findet man übrigens, unverrückbar begründet, im Saṃyuttakanikāyo und im Niddeso, woher die Stellen zu v. 853 der Bruchstücke der Reden angegeben, bez. übersetzt sind. Außerdem aber hat Pāyāsi hier unverhohlen seine große Vorliebe für Gleichnisse bekundet, von denen er nicht genug zu hören bekommen konnte, als richtiger Sohn seines Landes; wie denn auch der weit größere Kriegerfürst, Asoko, auf seiner 4. Felseninschrift anzeigt, daß er, eben jetzt bei seiner Wallfahrt, für Paukenschall, vielmehr Schall der Lehre dem Volk allerhand herrliche Gleichnisse habe aufweisen lassen, nämlich jene wohlbekannten Bilder aus den Reden Gotamos, als wie vom Palast (Mittlere Sammlung S. 87, vergl. oben S. 403), von der Elefantenspur (Mittlere Sammlung 207), von den Feuerscheiten (Mittlere Sammlung 270f.), sowie andere himmlische Bilder, añāni ca divyāni rūpāni: wo rūpam natürlich gleich opammam ist, und nicht etwa himmlisches Zeichen, Meteorstein [763] usw. bedeutet; welch letzteres neuerdings wieder vorgeschlagen wurde, Journal Royal Asiatic Society 1911 p. 785-788, obwohl die rechte Erklärung auch hierzu schon geraume Zeit vorliegt, Anm. 80 und 185. Gehalt und Stil der asokischen Inschriften lassen sich doch wohl nicht in allzu kärgliche Begriffe einbringen.
737 Mit S dukkhette dubbhumme avihatakhāṇukaṇṭake und mit C und barmanischen Handschriften besser asārādāni. Dann auch mit S na evam.
738 S sukhette, okaṇṭake, sukhasayitāni richtig. Auch C etc. immer okhette. – Das selbe Gleichnis bei Manus X 69: Subījañca va sukṣetre jātaṃ sampadyate yathā: hier dem obigen wie später noch genau entsprechend: vergl. BÖHTLINGKS Indische Sprüche s.v. sukṣetre. Der Hauptgedanke selbst, vom unblutigen Opfer, ist als Thema unserer fünften Rede, S. 92-103, von Gotamo mit aller Ausführlichkeit behandelt, mit vollendeter Meisterschaft entwickelt worden: Kassapo hat nur einen knappen Auszug davon gegeben, vergl. zumal a.a.O. Seite 97. Brüderlich nahe kommt der Lobgesang MARTIALS auf DECIANUS, von LESSING in seiner Abhandlung über das Epigramm I § 2 mit Recht hochgepriesen; es ist geradezu wie eine Wiedergabe der selben Worte, was man da hört, unisono in unseren Schlußakkord einstimmend:
Nolo virum, facili redimit qui sanguine famam:
Hunc volo, laudari qui sine morte potest.
Kurz, wie es einmal LESSING als eigene Antithese vortrefflich ausspricht, im fünften Gespräch zwischen Ernst und Falk: »Was Blut kostet, ist gewiß kein Blut werth.« Nämlich in Hinsicht auf Gewalt und Zwang.
739 Mit Mandalay dhorakāni zu wählen.
740 Zu samāgañchim als futurisch cf. TRENCKNERS Pāli Miscellany p. 73. – Uttaro will mit solchem geheimkundigen Vorbehalt, als einem Weihspruch oder magischen mangalam, Pāyāsi davor behüten, daß ihm seine Gabe dereinst nicht etwa ebenso ruppig vergolten werde. So kann, meint Uttaro, der leoninische Vertrag, den Pāyāsi wie die meisten Machthaber ohne weiterzudenken eingegangen ist, doch noch zum besten Pāyāsis bloß auf dieses Leben beschränkt werden, indem der eine Teil, die Empfänger, zwar nur die Abfälle erhält, der andere Teil aber, der Spender, immerhin Wohltäter bleibt; zugleich also das wenn auch noch so kärgliche Almosen den Armen zugute kommt, und die Schmach, daß es eben nur das ist, als der schlechte Teil und Ruf dem Reichen schon bei Lebzeiten ausgereift und damit erschöpft sein soll: wie das der Text oben alsbald überaus fein und zart weiter andeutet. Uttaro der junge Priester kennt ja gehörig die vedische Überlieferung. Dieser gemäß redet er, so wie es bei Manus IV 226-235 vorgetragen wird. Er faßt das ganze zusammen, zumal nach der vorletzten Strophe, v. 234: Yena yena tu bhāvena yad yad dānaṃ prayacchati, tat tat tenaiva bhāvena prāpnoti pratipūjitaḥ, wozu Kullūkas, als ob er unser Verhältnis oben miterklären wollte, noch bemerkt: yad yad dānaṃ dadāti, tenaiva bhāvenopalakṣitas tat tad dānaṃ phaladvāreṇa janmāntare pūjitaḥ san prāpnoti, welche durchaus folgerechte Erläuterung dann in der letzten Strophe nach beiden Seiten hin bestätigt wird.
741 Vergl. Mittlere Sammlung S. 836. – Die jinistische Sage, vergl. oben Anm. 722, verbrämt das Ende Pāyāsis noch mit einigen romanhaften Schnörkeln, die deutlich die spätere Fassung mit ihrer so beliebten, erbaulich angepaßten Form erkennen lassen. Der Kriegerfürst wird nämlich so fromm, daß er alle Freude am Leben verliert, sich um Reich und Herrschaft usw. nicht mehr kümmert. Das behagt nun seiner königlichen Gemahlin ganz und gar nicht, daher sie ihn auf heimtückische Weise vergiftet. Pāyāsi, alsbald von tödlichen Schmerzen gepeinigt, merkt den Verrat: und [764] ohne der schlotternden Königin auch nur in Gedanken zu zürnen, zieht er sich in ein leeres Gemach zurück, um dort noch heiliger Andacht zu pflegen. Mit verschränkten Beinen, das Antlitz gen Osten gewandt, setzt er sich nieder, hat alles freudig verlassen, und gibt auch noch seinen Leib dahin, mit den letzten Atemzügen gesammelten klaren Geistes versterbend – und sogleich in himmlische Welt eingekehrt. – – So ergreifend nun auch dieser echte, wirkliche Typus des frommen Jainas hier geschildert ist: dem Charakter Pāyāsis, wie wir ihn kennen, scheint er weniger zu entsprechen als unser kurze, bestimmte, recht allgemein menschliche Bericht; weil ja, der Rājataraṃgiṇī gemäß, rājñaḥ sato 'pi nā vāsaḥ.
742 Mit S yo pan' etassa dāne.
743 Gavampati ist noch aus dem Saṉyuttakanikāyo vol. V p. 436/7 bekannt. Auch wird ihm ein Spruch der Lieder der Mönche, v. 38, beigelegt. Nach Mahāvaggo I 9 war er unter den ersten zehn Jüngern, die gleich zu Beginn der Botschaft Gotamos dem Meister nachgefolgt sind. Er soll bald nach dem Tode des Herrn gestorben sein, laut einer in Nepāl und Tibet erhaltenen Angabe, KERNS Buddhismus II 296.
744 Mit S Saccāham bhante. Zur geistigen Geburt und Erscheinung solcher Verstorbener und ihrer problematischen Mitteilbarkeit cf. Anm. 591. – Über die Verteilung von Gaben und Spenden und die vier möglichen Arten derselben handelt die 142. Meisterrede der Mittleren Sammlung. Hieran schließt sich auch das Gespräch, das Gotamo mit Sāriputto vor den zu Besuch gekommenen Anhängern aus Campā geführt hat, im Aṉguttaranikāyo, Sattakanipāto Nr. 49, wo die Art und Weise einer Gabe je nach ihrem Beweggrund und ihrem Erfolg angedeutet wird, und es dann, insgesamt, heißt: Mancher spendet da eine Gabe aus Absicht auf Entgelt, oder er gibt sie aus Liebe und Zuneigung, oder um sich öffentlich auszuzeichnen, oder in der Hoffnung auf jenseitigen Lohn, oder auch weil er aus Grundsatz wohltätig ist, oder weil es von Vaters und Großvaters Zeiten her so bei ihm gehalten wurde und nun unschicklich wäre mit dem alten Hausbrauch zu brechen, oder auch weil er sich sagt: »Ich habe Einkünfte, jene haben keine Einkünfte: das steht mir, der ich Einkünfte habe, nicht an, daß ich denen, die keine Einkünfte haben, nichts geben sollte«; oder er gedenkt auch wohl: »Wie da einst bei den Sehern der Vorzeit jene großen Opfer dargebracht wurden, als wie etwa bei Aṭṭhako, Vāmako, Vāmadevo, Vessāmitto, Yamataggi, Aṉgiraso, Bhāradvājo, Vāseṭṭho, Kassapo, Bhagu, so soll nun auch bei mir verschenkt und verspendet werden«; oder auch weil er die Erfahrung gemacht hat: »Wenn ich da Gutes tue, wird mein Herz erheitert, und ich fühle mich froh und zufrieden«; und endlich auch spendet wohl mancher, dem es Herzenserfordernis, Herzensbedürfnis ist Gabe zu geben; wer so Gabe gegeben hat, der gelangt, bei der Auflösung des Körpers, nach dem Tode, empor zur Einkehr in den Kreis der heiligen Götter: und solche Tat hinter sich lassend, solche Macht, solchen Ruhm, solche Herrlichkeit, kehrt er nicht wieder, nicht mehr zurück in diese Welt. Vergl. noch Bruchstücke der Reden v. 509 mit der gotamidischen Verklärung des yoyajati nach der Ṛksaṃhitā VIII 31 1.
Asoko hat den ganzen, vielseitig ausgeführten Gedankengang solcher und zahlreicher ähnlicher Stellen am Ende des VII. Felsenedikts, nach seiner Art so kurz wie möglich, damit beschlossen: »Denn wer auch eine reiche Gabe nicht geben kann: sich selbst beherrschen, das Herz läutern, erkenntlich und rechtschaffen sein, bleibt immer gültig.«
745 Api nu tāhaṃ mit S.
746 So mit S, vergl. Anmerkung 507. Hochstadt, Uttarakā, die Thūlierburg, ist [765] in den Vorbergen des Himālayo, im südöstlichen Nepāl, an den Grenzen der kusinārischen Maller und der Licchavier zu suchen. Nicht weit davon war Uccenagaram, Hohenheim, das Uccānagaram des Kalpasūtram der Jainās: jene Stadt, die zugleich mit Rāmagāmo eine der Residenzen der Koḷiyer war, der nächsten Nachbarn der Thūlier, nach dem Bericht unserer 16. Rede, S. 299. Waren aber die Koḷiyer von Rāmagāmo Anhänger Gotamos, so hatte sich die Zweiglinie in Uccenagaram dem Meister der Jainās, Nāthaputto, zugewandt, nach ihren alten Inschriften zu Mathurā, Epigraphia Indica vol. I p. 381-389 Nr. I, IV, V, XIII, XIV, vol. II p. 205-209 Nr. XXIV, XXXIV, XXXVII. Die Lage dieser Städte ist für künftige Ausgrabungen noch genauer bestimmbar nach den Angaben in der Anm. 508. In der siṇhalesischen Überlieferung ist die Thūlierburg als Uturu angegeben; die reichlichen Sagen, die sich daranschließen, haben natürlich keinerlei geschichtlichen Wert. Sie gehören nur zur Klasse des Ālokārāmo. Das ist der Name einer hochgelegenen Felsenklause bei Mātale. Nahe dem Gipfel gewaltiger moosbewachsener Granitblöcke ist dort in der Felsenklamm eine breite Schlucht, von Palmen umstanden, und darin eine geräumige alte Einsiedelei, Ālokārāmo geheißen, der lichte Hain, Lichtenhain, von āloko Lichtblick, Helligkeit, und ārāmo Hain, Garten; und da der Platz hoch über der Ebene liegt, gilt noch zugleich die ältere Bedeutung Luginsland, Lugeck, wie Lueg ein sehr ähnlicher enger Felspaß im Pongau genannt wird: und so wie bei unserem lugen, auslugen, zunächst rückbezogen auf das wurzelverwandte lokate, ālokayati erblicken, umherblicken, wozu auch indogermanisch  leuchten gehört, lux, luna, λευκος, ferner lucus, locus, der freie weite Raum, litauisch laukas, englisch look, normannisch luquer. Jener treffende Name Ālokārāmo, Lichtenhain oder Luginsland, ebenso einleuchtend wie oben im Text unser Uttarakā, Hochstadt, genügte nun als solcher den Scholiasten keineswegs: es mußte vielmehr noch hinzuerläutert und kommentiert werden. Daher gab mir Ratanapālo, ein liebenswürdiger gelehrter Mönch, der in der Klamm dort hauste, als ich den Ort einmal aufsuchte, sehr gütig die dazugehörige Legende zum besten. Einst hatte sich der große Buddhaghoso hierher zurückgezogen, um ungestört seine Kommentare zu schreiben. Tag und Nacht arbeitete er daran, so fleißig, daß endlich Sakko der Götterkönig, gerührt von soviel Hingabe, aus seinem Himmel der Dreiunddreißig auf den Felsen herabkam und Helligkeit, āloko, verbreitete, damit Buddhaghoso fürderhin nicht mehr nächtens bei düsterer Lampe weiterzuarbeiten brauchte: daher der Name Ālokārāmo, der Lichte Hain. Ist typisches Beispiel für derartige Erklärungen, in Zeilon wie anderwärts. Nebenbei: Ceylon statt Zeilon zu schreiben steht Deutschen so an wie Florence für Florenz. MARCO POLO hatte längst schon, lautrichtig und ohne sich irgend zu schämen, Seilla gesagt, ebenso CAMÕES (VII 19) Ceilão, PIETRO DELLA VALLE in seinen Briefen aus Indien so gut wie möglich Zeilan geschrieben. Aber die biederen Sachsengänger und Scharwenzler treten untertänig zurück, raffen sich bestenfalls zu einem halbverzagten, halbverschämten »Zeylon« oder »Ceilon« auf; auch sagen sie ja noch immer die »Upanishads« oder noch hübscher die »Upanishad's«, obzwar SCHOPENHAUER die Upanischaden vor beinahe hundert Jahren, 1818, bereits gefunden hatte. Der war eben Vorbildner, kein Nachbeter. – In Utta rakā waren, kaum anders als gegenwärtig, berühmte Wallfahrtsstätten, wo Büßer der ärgsten und tollsten Gelübde und Kasteiungen beflissen sich quälen. Vergl. Bruchstücke der Reden Anm. 1043, und Mittlere Sammlung, Anm. 68. Diese verrückten ›Heiligen‹, bei denen des Denkens Faden zerrissen ist, sind zumeist bekannt als Pā upatās, Jünger des Herrn der Herde, nach iva-Pa upatis, dem göttlich verwilderten Einsiedler, der lange vor Gotamo schon dort oben im Gebirge seine [766] Heimstätte hatte, insbesondere im Tempel zu Pa upatināth, und ebenso auch weit im Nordwesten, auf dem hochgelegenen Felsenheiligtum zu Harasnāth, s. Anm. 748; Haras der Vernichter und ivas der Beglücker ist ein und derselbe. Wer sich da diesen uralten Zottigen (ke ī, Ṛgv. X 136) zum Vorbild erwählt, muß immer noch, der strengen Observanz gemäß, als catukuṇḍiko leben, d.i. wie ein kuṇḍo, eine Art Salamander-Reptil, auf allen vieren dahinkriechen, nur auf den Knieen und Ellbogen sich weiterbewegend. Solche Selbstquäler heißen dann auch »Krokodilbüßer, Schlangenbüßer«, weil sie das Gehaben von Krokodil oder Schlange zeitlebens als Buße bewahren. Das ist die Reptilpönitenz, die ajagaravṛtti, genau ausgeführt nach den Regeln der Sannyāsupaniṣat, II Mitte. Etwas milder ist das Hunde-und Kuhgelübde, wobei dem Bekenner doch eine größere Freiheit der Bewegung möglich ist, auch getreu nach der Vorschrift übernommen, z.B. wie sie die Paramahaṃsaparivrājakopaniṣat gibt; auf allen vieren gehn und auf die Erde hingeworfene Nahrung nur mit dem Munde auflesen ist aber die gleiche Pönitenz. Davon ist denn im Text oben bei uns alsbald die Rede, und in der Mittleren Sammlung S. 420 wird von zwei zugehörigen Kastiganten berichtet, die Gotamo auch dort am nepālischen Alpenhang aufsuchen: der eine läßt sich wie eine Kuh seitwärts nieder, während der andere sich wie ein Hund eingerollt hinsetzt. Das Kuhgehaben nachzuahmen mag für Hindus noch hingehn, weil Rinder als reine Tiere gelten. Aber hündische Sitte zu pflegen ist das ärgste an Selbsterniedrigung, weil der Hund zumeist verachtet wird; es sei denn daß damit auch zugleich die unverbrüchliche Treue, die bis zum Tode währende Anhänglichkeit an das einmal erwählte Gelübde sinnenfällig bezeugt werden sollte. Von einer solchen Vorstellung ist ja sogar Meister ECKHART ausgegangen. Der Mensch soll seinen göttlichen Herrn lieben wie einen recht lieben Freund. Er soll sich ein Gleichnis nehmen »an dem Hunde, der ein unvernünftig Tier ist. Der ist seinem Herrn also getreu, alles was seinem Herrn entgegen ist, das haßt er, und wer seines Herrn Freund ist, den hat er lieb«, ed. PFEIFFER p. 69. Freilich hat es aber auch bei uns im Abendlande nicht daran gefehlt, daß dergleichen geistig gemeinte Bestimmungen schmählich vergröbert wurden: wie das z.B. die heute noch übliche Echternacher Springprozession zeigt, wo man alljährlich zu Pfingsten ein ähnliches Tiermenschentum beobachten kann, Unsinn, der sich als verdienstliche Qual gebärdet. Aus derartigen Irrgängen der Vernunft suchte wiederum wie einst Gotamo sorgsam Meister ECKHART wegzuleiten, den Sinn zu zeigen, »den etliche Leute nicht wohl verstehn: das sind die Leute, die sich behalten mit Eigenschaft in Pönitenz und auswendiger Übung (daß die Leute für groß geachtet sind, deß erbarme Gott!), und sie bekennen doch so wenig der göttlichen Wahrheit. Diese Menschen heißen heilig von den auswendigen Bilden, aber von innen sind sie Esel«, ed. PFEIFFER p. 280; und hierzu noch die wichtige Ergänzung mit dem verstärkten Abschluß bei JOSTES p. 91f.: »Und das sollt ihr verstehn, daß alle auswendigen Werke, die der Mensch üben mag, die Natur wohl bezwingen, aber sie ertöten sie nicht. Sterben der Natur liegt an geistlichen Werken.« Aber die Leute, die sich mit auswendigen Übungen abgeben, sind »sehr geachtet in den Augen der Welt, und das kommt von Gleichheit. Denn die Leute, die nichts anderes verstehn als leibliche Dinge, die achten groß das Leben, das sie begreifen mögen mit den Sinnen. Also wird geliebt ein Esel von dem anderen.« – Unser Sunakkhatto nun bestätigt das recht gut und damit die allgemein sprichwörtliche Erfahrung, nach Dhammapadam 318, Therīgāthā 107: avajje vajjamatī, vajje cāvajjadassī, Unedles werthalten, Edles unwert: vergl. Lieder der Nonnen Anm. 107; im klassischen Einklang mit LUKREZ I 641/44 etc. von J.B. ROUSSEAU, Épitres I 1 249/50, so vorgebracht:
leuchten gehört, lux, luna, λευκος, ferner lucus, locus, der freie weite Raum, litauisch laukas, englisch look, normannisch luquer. Jener treffende Name Ālokārāmo, Lichtenhain oder Luginsland, ebenso einleuchtend wie oben im Text unser Uttarakā, Hochstadt, genügte nun als solcher den Scholiasten keineswegs: es mußte vielmehr noch hinzuerläutert und kommentiert werden. Daher gab mir Ratanapālo, ein liebenswürdiger gelehrter Mönch, der in der Klamm dort hauste, als ich den Ort einmal aufsuchte, sehr gütig die dazugehörige Legende zum besten. Einst hatte sich der große Buddhaghoso hierher zurückgezogen, um ungestört seine Kommentare zu schreiben. Tag und Nacht arbeitete er daran, so fleißig, daß endlich Sakko der Götterkönig, gerührt von soviel Hingabe, aus seinem Himmel der Dreiunddreißig auf den Felsen herabkam und Helligkeit, āloko, verbreitete, damit Buddhaghoso fürderhin nicht mehr nächtens bei düsterer Lampe weiterzuarbeiten brauchte: daher der Name Ālokārāmo, der Lichte Hain. Ist typisches Beispiel für derartige Erklärungen, in Zeilon wie anderwärts. Nebenbei: Ceylon statt Zeilon zu schreiben steht Deutschen so an wie Florence für Florenz. MARCO POLO hatte längst schon, lautrichtig und ohne sich irgend zu schämen, Seilla gesagt, ebenso CAMÕES (VII 19) Ceilão, PIETRO DELLA VALLE in seinen Briefen aus Indien so gut wie möglich Zeilan geschrieben. Aber die biederen Sachsengänger und Scharwenzler treten untertänig zurück, raffen sich bestenfalls zu einem halbverzagten, halbverschämten »Zeylon« oder »Ceilon« auf; auch sagen sie ja noch immer die »Upanishads« oder noch hübscher die »Upanishad's«, obzwar SCHOPENHAUER die Upanischaden vor beinahe hundert Jahren, 1818, bereits gefunden hatte. Der war eben Vorbildner, kein Nachbeter. – In Utta rakā waren, kaum anders als gegenwärtig, berühmte Wallfahrtsstätten, wo Büßer der ärgsten und tollsten Gelübde und Kasteiungen beflissen sich quälen. Vergl. Bruchstücke der Reden Anm. 1043, und Mittlere Sammlung, Anm. 68. Diese verrückten ›Heiligen‹, bei denen des Denkens Faden zerrissen ist, sind zumeist bekannt als Pā upatās, Jünger des Herrn der Herde, nach iva-Pa upatis, dem göttlich verwilderten Einsiedler, der lange vor Gotamo schon dort oben im Gebirge seine [766] Heimstätte hatte, insbesondere im Tempel zu Pa upatināth, und ebenso auch weit im Nordwesten, auf dem hochgelegenen Felsenheiligtum zu Harasnāth, s. Anm. 748; Haras der Vernichter und ivas der Beglücker ist ein und derselbe. Wer sich da diesen uralten Zottigen (ke ī, Ṛgv. X 136) zum Vorbild erwählt, muß immer noch, der strengen Observanz gemäß, als catukuṇḍiko leben, d.i. wie ein kuṇḍo, eine Art Salamander-Reptil, auf allen vieren dahinkriechen, nur auf den Knieen und Ellbogen sich weiterbewegend. Solche Selbstquäler heißen dann auch »Krokodilbüßer, Schlangenbüßer«, weil sie das Gehaben von Krokodil oder Schlange zeitlebens als Buße bewahren. Das ist die Reptilpönitenz, die ajagaravṛtti, genau ausgeführt nach den Regeln der Sannyāsupaniṣat, II Mitte. Etwas milder ist das Hunde-und Kuhgelübde, wobei dem Bekenner doch eine größere Freiheit der Bewegung möglich ist, auch getreu nach der Vorschrift übernommen, z.B. wie sie die Paramahaṃsaparivrājakopaniṣat gibt; auf allen vieren gehn und auf die Erde hingeworfene Nahrung nur mit dem Munde auflesen ist aber die gleiche Pönitenz. Davon ist denn im Text oben bei uns alsbald die Rede, und in der Mittleren Sammlung S. 420 wird von zwei zugehörigen Kastiganten berichtet, die Gotamo auch dort am nepālischen Alpenhang aufsuchen: der eine läßt sich wie eine Kuh seitwärts nieder, während der andere sich wie ein Hund eingerollt hinsetzt. Das Kuhgehaben nachzuahmen mag für Hindus noch hingehn, weil Rinder als reine Tiere gelten. Aber hündische Sitte zu pflegen ist das ärgste an Selbsterniedrigung, weil der Hund zumeist verachtet wird; es sei denn daß damit auch zugleich die unverbrüchliche Treue, die bis zum Tode währende Anhänglichkeit an das einmal erwählte Gelübde sinnenfällig bezeugt werden sollte. Von einer solchen Vorstellung ist ja sogar Meister ECKHART ausgegangen. Der Mensch soll seinen göttlichen Herrn lieben wie einen recht lieben Freund. Er soll sich ein Gleichnis nehmen »an dem Hunde, der ein unvernünftig Tier ist. Der ist seinem Herrn also getreu, alles was seinem Herrn entgegen ist, das haßt er, und wer seines Herrn Freund ist, den hat er lieb«, ed. PFEIFFER p. 69. Freilich hat es aber auch bei uns im Abendlande nicht daran gefehlt, daß dergleichen geistig gemeinte Bestimmungen schmählich vergröbert wurden: wie das z.B. die heute noch übliche Echternacher Springprozession zeigt, wo man alljährlich zu Pfingsten ein ähnliches Tiermenschentum beobachten kann, Unsinn, der sich als verdienstliche Qual gebärdet. Aus derartigen Irrgängen der Vernunft suchte wiederum wie einst Gotamo sorgsam Meister ECKHART wegzuleiten, den Sinn zu zeigen, »den etliche Leute nicht wohl verstehn: das sind die Leute, die sich behalten mit Eigenschaft in Pönitenz und auswendiger Übung (daß die Leute für groß geachtet sind, deß erbarme Gott!), und sie bekennen doch so wenig der göttlichen Wahrheit. Diese Menschen heißen heilig von den auswendigen Bilden, aber von innen sind sie Esel«, ed. PFEIFFER p. 280; und hierzu noch die wichtige Ergänzung mit dem verstärkten Abschluß bei JOSTES p. 91f.: »Und das sollt ihr verstehn, daß alle auswendigen Werke, die der Mensch üben mag, die Natur wohl bezwingen, aber sie ertöten sie nicht. Sterben der Natur liegt an geistlichen Werken.« Aber die Leute, die sich mit auswendigen Übungen abgeben, sind »sehr geachtet in den Augen der Welt, und das kommt von Gleichheit. Denn die Leute, die nichts anderes verstehn als leibliche Dinge, die achten groß das Leben, das sie begreifen mögen mit den Sinnen. Also wird geliebt ein Esel von dem anderen.« – Unser Sunakkhatto nun bestätigt das recht gut und damit die allgemein sprichwörtliche Erfahrung, nach Dhammapadam 318, Therīgāthā 107: avajje vajjamatī, vajje cāvajjadassī, Unedles werthalten, Edles unwert: vergl. Lieder der Nonnen Anm. 107; im klassischen Einklang mit LUKREZ I 641/44 etc. von J.B. ROUSSEAU, Épitres I 1 249/50, so vorgebracht:
[767] Rien n'est moins rare: un sot, dit la satire,
Trouve toujours un plus sot qui l'admire.
Oder auf gut mecklenburgisch: »Kein Narr is so dumm, hei findt einen, dei em vör klauk höllt.« Am Boden zu kriechen usw. ist sicherlich eine harte bittere Peinigung: aber eine elende, vermaledeite, die nichts weniger als Bewunderung verdient; die eben nur, wie der auch in einem traurigen Menschentum und -drangsal sich hinschleppende Humanist WILHELM XYLANDER jammervoll sagte:
Abjectum cogat serpere praeter humum.
Die staunende Bewunderung gilt nicht mehr dem Pilger und Büßer, sondern ganz und gar nur dem furchtbaren Anblick, den Edgar im Lear zeigt, II 3 Anfang, als Bedlam beggar (vergl. Anm. 1073):
To take the basest and most poorest shape,
That ever penury, in contempt of man,
Brought near to beast: my face I'll grime with filth;
Blanket my loins; elf all my hair in knots,
And with presented nakedness out-face
The winds, and persecutions of the sky.
So stellt denn Korakkhattiyo, nach dem Bericht im Text, auch eines der schrecklichsten Bilder zum kataskeuastischen Gnomikon dar, das der Kronide an die göttlichen Rosse des Achilleus richtet, Ilias XVII 446/7: wonach der Mensch das unseligste von allem ist, was da auf Erden atmet und kriecht. Glücklich die Rosse, die Hunde, im Vergleich zu jenen Rinder- und Hundelehrlingen. Hingegen ziemt dem echten Asketen Gang und Betragen wie es in der 91. Rede der Mittleren Sammlung S. 693 gezeigt wird. Und das ist das selbe wie es die Regel ST. BERNHARDS angibt: Sit praeterea incessus tuus maturitate plenus, gravis et honestus: videlicet non fractis gressibus ambules, aut scapulas dextrorsum aut sinistrorum vergendo, non erecta cervice, non prominente pectore, seu etiam inclinato capite super humerum: quae omnia aut levitatem redolent, aut elationem ostentant, aut hypocrisim sapiunt. Incedens ergo, stans et sedens, faciem semper habeto deorsum, revolvens in animo tuo, quod pulvis es et in pulverem reverteris: et cor sursum, etc. Formula honestae vitae, Opp. ed. Par. 1621 fol. 1134. Kurz fol. 1734: Et ne defigas oculos tuos longius ante te quam protenditur proceritas corporis tui: quia hoc multum impedit vagationes animi. Hiermit ist aber der abschließende Satz aus der oben genannten Rede der Mittleren Sammlung rein wiederholt, 693: Er schaut nicht hinauf, er schaut nicht herab, läßt die Blicke nicht hin- und herschweifen, er blickt vier Spannen weit vor sich: so hat er höhere, unbehinderte Wissensklarheit gewonnen.
747 Atha khvāhaṃ besser mit S.
748 Der Unbekleidete, acelo, acelako, gehört mit zur Gesellschaft der Nackten Büßer: er trägt aber noch einen Schurz um die Lenden, während die ājīvikā und die jinistischen digambarā, »die den Himmelskreis zum Gewande haben«, auch diese letzte Rücksicht auf bürgerliche Begriffe verworfen, abgetan, die ganz »fessellosen« Nackten Büßer sind. Eine steinerne Inschrift am hochgelegenen Felsentempel Schivas bei Harasnāth, 100 km nordwestlich von Jaypur, Rājputāna, nennt den also entfesselten nackten Nachfolger »einen Büßer, der in sich gegangen ist, mit dem Himmelskreise fleckenlos bekleidet«, digamalavasanaḥ saṃyatātmā tapasvī: Epigraphia Indica II 123 [768] v. 33. Auf diese Art und Weise hoffen sie dem saṃsāro oder der Wandelwelt entrinnen zu können: und Schivas wird mit einem seiner tausend Namen gern als der saṃsārasārathis, der Leiter aus der Wandelwelt, gepriesen, im ivanāmasahasram überliefert, cf. Anm. 388; eben darum aber nennen sie sich auch sāṃsārikās auf der Inschrift zu Harasnāth v. 31, eine allerdings seltsame Bezeichnung, die dem vortrefflichen Herausgeber KIELHORN, wie er 1. c.p. 128 n. 70 sagt, unerklärlich geblieben war. Gleiche Genossenschaft haben die christlichen Adamiten gebildet, die wahrscheinlich von den Nackten Büßern erfahren hatten. Denn auch sie wollten durch Überwindung alles Schamgefühls ihre Vollendung bezeugen: ευχονται γυμνοι ὁλῳ τῳ σωματι, berichtet EPIPHANIOS von ihnen und ähnlichen Ordensbrüdern. Später sind ihnen noch manch andere nachgefolgt, bis zu den Picarden, Taboriten usw. herab, die die Meinung hegten: »Wer einen Schurz trägt ist sündig«, oder wie die ersteren sagten: »Wer Hosen anhat ist nicht frei«, nach BAYLES Dictionaire, III. Supplement 1753 fol. 159a s.v. Picards. Bei den weiblichen Genossenschaften hatte dementsprechend das Tragen der Femoralia zu entfallen. Der Frankfurter hat solche ekstatische Exhibitionisten wohl gekannt; er nennt ihr Betragen »das ruchlos freie Leben«, und er sagt von ihnen: »das sind böse, falsche Geister, die wähnen und sprechen, sie seien vollkommen«, Deutsche Theologie, Kap. 18 u. 39. Der Anstoß, den diese Sekten in unseren Ländern gegeben, hat ihnen grausame Folter, Galgen und Scheiterhaufen gebracht, den päpstlichen Bann mit der kaiserlichen und königlichen Vertilgung durch Feuer und Schwert: wo hingegen in Indien der Aberwitz eben nur als das was er ist angesehn und beschränkt wurde, ohne irgendwelchen kirchlichen Fanatismus. Asoko z.B. hatte, wie für all die verschiedenen Ordensgenossenschaften, ausdrücklich auch für den Unterhalt solcher Büßer gesorgt, hat ihnen volle Freiheit gelassen; er wußte, es muß auch solche Käuze geben, die ājīvikā und die nigaṇṭhā, die Freilebenden und die Fessellosen, wie er sie auf dem VII. Edikt der Säuleninschriften, Delhi Zeile 4f., richtig angibt. Auch hat er ihnen an geeigneten, schön gelegenen Orten im Gebirge sorgsam geglättete geräumige Felsenkammern, kreisförmig, oval, rechteckig, im Ausmaß bis über 10 x 5 x 3 Meter, zum Aufenthalt herrichten lassen, nach den drei Inschriften zu Barābar, im granitenen Urgestein der Hügel westwärts von Rājagaham, der alten Residenzstadt, in sechs Stunden bequem zu erreichen; oder von Buddhagayā gradaus nördlich über Gayā einen guten Tagesmarsch immer die hellen Auen der Phalgu entlang und dann durch die Talmulde rechts bergauf: Klausen, die im Wandel zweier Jahrtausende von brāhmanischen, buddhistischen und endlich muhammedanischen Einsiedlern bewohnt wurden, und die heute noch alljährlich von vielen Tausenden von Wallfahrern andächtig besucht werden. Ganz in der Nähe, am östlichen Abhang der Nāgārjunī-Kuppen, hat auch Asokos Enkel, König Dasaratho, auf drei weiteren Inschriften ebenso die »ehrwürdigen Ājīvikā« mit Grottenstiftungen bedacht, »zum Aufenthalt während der Regenzeit«, vāṣaniṣidiyāye, d.i. aufzulösen in varṣao oder vārṣaniṣādanāya, Indian Antiquary 1891 p. 364f., CUNNINGHAM, Archaeological Survey of India I 40-53, Tafel XVIII, XIX; Epigraphia Indica II 270. Der Ruhm dieser unbekleideten Büßer war in der alten Welt weitverbreitet, man hat darüber sogar in Rom gesprochen: CICERO erzählt von ihnen, daß sie ihr Leben nackt zubringen, nudi aetatem agunt, Tuscul. Quaest. lib. V, cap. 27; hernach berichtet AUGUSTINUS aus guter Quelle, daß sie in den schattigen Einsamkeiten Indiens nackt philosophieren, per opacas quoque Indiae solitudines, cum quidam nudi philosophentur, etc., De civitate Dei lib. XIV cap. 17. Dem Orden Gotamos, der Anstand und möglichste Unauffälligkeit – daher das fahle Gewand – als Grundlage äußerer Zucht betrachtet, [769] recht wie feine Sitte je schlichter desto besser wählt, konnten und können dergleichen Nackte Büßer, Fessellose, Freie Brüder usw. nur als bemitleidenswerte Schwärmer und Unsinnige gelten. Solche falsche Askese ist es, die der Buddhismus überall abgelehnt hat, als Verblendung und Aftertugend. Vergl. Mittlere Sammlung S. 521. Der Anstand der äußeren Erscheinung freilich macht es nicht aus, cucullus non facit monachum: wer da als Jünger im Orden des Meisters etwa gierig, gehässig, zornig, heuchlerisch, gleisnerisch wäre und nicht den geraden Weg des Asketentums wandelt, der gleicht, sagt Gotamo, »einer Mordwaffe, zur Schlacht geeignet, zweischneidig, blinkend geschliffen und mit einer Kutte umhangen, umhüllt«, Mittlere Sammlung 312. Nur der ist ein Mönch, der da liebreiche Herzensablösung geübt, gepflegt, ausgeführt, ausgebildet, angewendet, durchgeprüft, durchaus entrichtet hat. Und würde er gleich von einem Feinde verfolgt und angegriffen, wenn auch ein noch so gewaltiger Gegner etwa gedächte dessen Gemüt verstören zu können: so viel Mühe und Plage sich der ihm gegenüber auch immer gäbe, es wäre geradeso als wenn ein Mann eine scharfe Messerschneide mit der Handfläche oder mit der geballten Faust abwehren, wegschlagen, zurückstoßen wollte. »Darum aber hat man, ihr Mönche«, beschließt Gotamo dieses ergänzende Gleichnis, »sich also zu üben: ›Liebreich wird von uns Herzensablösung geübt, gepflegt, ausgeführt, ausgebildet, angewendet, durchgeprüft, durchaus entrichtet werden‹: so habt ihr Mönche euch wohl zu üben.« Saṉyuttakanikāyo ed. Siam. vol. II, pag. 235, PTS 265.
749 Mit S etc. Acelo kira Korakkhattiyo.
750 Man kann, wenn man will, die Art dieses Vorgangs auch wohl auf eine recht nüchterne Weise, nach der äußeren Möglichkeit hin, erklären: da nämlich Leichen von plötzlich, oder wie es oben heißt »unversehns« Gestorbenen, die etwa nach einigen Tagen beklopft oder gerüttelt werden, nicht selten Töne, eine Art Wehklagen, wie es scheint, von sich geben, zumal wenn der Körper emporgehoben und in eine andere Lage gebracht wird; ein Geräusch, das durch den Austritt der Luft aus dem Thorax entsteht. Dergleichen konvulsivische Exspirationen eines Leichnams noch mehrere Tage nach dem Ableben sind der Forensis wohlbekannt; vergl. z.B. ORFILAS Lehrbuch der gerichtlichen Medizin, 4. Aufl. III 2, 158. Unser Sunakkhatto mag daher etwas Ähnliches mit Korakkhattiyo erfahren und sich die Sache dann suggestiv ausgelegt haben, bei dem »scheußlichen Gestank und dem Gekreisch wie von Alraunen, die man aufwühlt«, gemäß dem Grausen Juliets vor der Gruft der Capulets. Ein Gegenstück, ebenso schauerlich dargestellt, findet man am Ausgang der Aeneis, beim Tode des Turnus:
ast illi solvuntur frigore membra
Vitaque cum gemitu fugit indignata sub umbras.
Breiter ausgeführt, und wie ein Spiegel unserem Bilde gemäß, am Ende des Orlando Furioso, wo Rodomonte, als ein anderer Korakkhattiyo, fluchend in den Orkus hinabfährt:
Alle squallide ripe d'Acheronte,
Sciolta dal corpo più freddo che ghiaccio,
Bestemmiando fuggì l'alma sdegnosa,
Che fu sì altiera al mondo e sì orgogliosa.
Das Vorbild der beiden letzten ist sehr alt, leicht metaplastisch aus der Ilias übernommen, wo häufig gesagt wird: die mächtigen Köpfe dem Hades zuschicken, ιφϑιμους [770] κεφαλας Αιδι προϊαψειν, z.B. XI 55. Wenn man aber etwa, wie unser Text oben es meint, eine wirkliche, spukhafte Mitteilung in der Art von Hamlets »poor ghost« rechtzufertigen suchte, eine von jenen zwischenweltlichen Kundschaften, die von den Überbleibseln ausgegangen wäre, so hätte man allenfalls an so was zu denken wie an den revenant des Jägers, der sich der Seherin von Prevorst gezeigt hat und ihr zu verstehn gab: »wie unsere Gesinnungen sind, so siehest du uns«, bei KERNER, 2. Aufl. II 224. Vergl. noch Anm. 713; auch Anm. 591. Am besten vielleicht wird man, als gestrenger Geschichtsforscher, das Erlebnis mit Korakkhattiyo zu den wohlgemeinten Schnörkeln rechnen. – Die Rotte der Schwarzen Köpfe ist in unserem 20. Stück näher gekennzeichnet, S. 360, als
Die Schwarzen Köpfe, furchtbar wild,
Unholde, brüllend wie der Sturm, usw.
Ihre Genealogie reicht in die Atharvasaṃhitā zurück, wo sie VI 80, 2 mit gewissen Sternenwelten in Beziehung stehn. WHITNEY und LANMAN haben sich damit beschäftigt in den Harvard Oriental Series vol. VII, Cambridge Mass. 1905, p. 341, in ihrer ausgezeichneten Übersetzung und Erklärung der atharvischen Lieder.
751 yāvajīvam acelo assaṃ mit S etc. Nur von Fleisch und Branntwein zu leben ist für einen indischen Selbstquäler natürlich eines der krassesten und widerlichsten Gelübde. Diese absonderliche Art von Kasteiung scheint also damals schon dort oben im Gebirge so gepflegt worden zu sein wie es späterhin die berüchtigte Tāntrikī ruti, im Gegensatz zur Vaidikī, allerwärts empfohlen hat und mit besonderem Erfolg in Tibet: der yogī soll, auf der höchsten Stufe angelangt, die fünf M pflegen, und zwar māṃsa-matsya-madya-mudrā-maithunam, d.i. Fleisch essen, Fisch essen, Branntwein trinken, Zauberei treiben und mit ausgesucht liebenswerten Jungfrauen Verkehr haben. Das ist endlich die Fülle der Geheimnisse, die der Guhyasamājas, eines der beliebtesten tantrischen Werke in Nepāl, anzugeben weiß: nach RĀJENDRALĀLAMITRA, The Sanskrit Buddhist Literature of Nepal, Calcutta 1882, p. 261 u.f., zitiert von WINTERNITZ, Geschichte der indischen Literatur, 2. Band, 1. Hälfte, Leipzig 1913, S. 274. Mir selbst ist im Kloster Bhutia Basti, gar herrlich dort oben an einem Abhang der nepālischen Gipfelriesen gelegen, nach einem zweistündigen Gespräch mit DONSAMDUP, einem sehr schlauen Lama, der sich prächtig auf das Augurenlächeln verstand, die gleiche geheime Offenbarung zuteil geworden. Der noch junge Priester, er war 27 Jahre alt, saß da vor mir zuhäupten in der matt erleuchteten, weihrauchduftenden Halle, umrahmt von den 333 Bänden des Bkah-hgyur (Kandschur) und Bstan-hgyur (Tandschur). Er war sechs Jahre im Herzen von Tibet gewesen und hatte sich die Auslegungen der alten Lamas und Mahātmās ganz angeeignet, war überzeugt von der Grundwahrheit des Leidens und von der Scheinsal der Außenwelt, die durch und durch māyā ist, ein Gemächte des Wahns. Aber als Würze kam dann zur echten, tief asketischen Lehre die tantrische Mystik hinzu; und als die sich eingefressen hatte, war eben gleich alles verstunken und verdorben, ein Meisterstück mephistophelischer Kunst: »verschwunden ganz der Erdensohn, und dann die hohe Intuition, ich darf nicht sagen wie zu schließen.« So war denn auch DONSAMDUP Wirklicher Geheimer Rat geworden, rahasyatattvamantrī. In der Vorrede zum ersten Halbhundert der Mittleren Sammlung p. XXX ist noch mehr von diesem Musterbeispiel zur Geschichte der Theosophistik mitgeteilt. Den schroffsten Gegensatz dazu bekunden die Jainās im westlichen und südwestlichen Indien, die da Enthaltsamkeit wiederum so spitzfindig betreiben, daß z.B. wenn einer der ihrigen auch nur von ungefähr mit einem gegorenen Getränk in [771] Berührung gekommen ist, er ein Bad nimmt. – Unter den im Text oben beschriebenen hündischen Büßern gibt es nun aber an den Orten, wo einst der Schauplatz unserer Rede war, auch heute noch solche, die sogar die entsetzliche Kasteiung befolgen, sich von menschlichen Leichenteilen zu ernähren: z.B. den Schädel von einer Verbrennungsstätte aufzulesen, nach und nach zu verzehren und fernerhin die Hirnschale als Almosennapf zu gebrauchen; sie nennen sich Māhe varakāpālikās, die Hirnschädler des Großen Herrn, des Büßerfürsten Schivas Hirnschädelgetreue, kāpālikavratās.
Die folgende Geschichte von der Umwandlung Kalāramajjhakos gibt eine sachkundige Erläuterung des solonischen Τερμα δ' ὁρᾳν βιοτοιο, eines Ausspruchs, den ST. FRANZISKUS wiederholt hat: Nemo laudandus cuius incertus est exitus, nach CELANO, Vita secunda cap. 73. Sein oder Gewesensein, das ist hier die Frage; und gegenständlich ist der ursprüngliche Habeascorpus-Akt unterlegt: Haben oder Gehabtwerden, wie PETRARCA es recht sieht: Plures multo sunt qui habentur quam qui habent, De remediis utriusque fortunae lib. I dial. 53, nach SENECAS Habere nos putamus, habemur: Wir glauben zu haben, und werden gehabt, Epist. VIII. Es ist übrigens bei uns oben zugleich das gewöhnliche Beispiel zu einer allenthalben bekannten Erscheinung, die gut im Pantagruel IV 64 in den Spruch verkürzt wird: De jeune hermite vieil diable; also der umgekehrte Gemeinplatz, den GOETHE der Frau VON KRÜDENER gewidmet hat, mit dem nicht minder kräftigen Ausdruck: Hurenpack, zuletzt Propheten. Oder nach der wohltemperierten Weise, die HAMANN in den Sibyllinischen Blättern II 23 anschlägt: »In fine videtur cuius toni, heißt es nach einer alten musikalischen Regel.« Wie denn eigentlich die ganze Episode vom Lebenslauf unseres nur allzu hundemäßig eifrigen Büßers, bei dem schließlich alles anders als nach Vorsatz und Plan ausgeht, eine Parabel ist zum Lukanischen Brennpunkt, Pharsalia VII 133, Sua quisque pericula nescit, Keiner weiß was ihn bedroht; wobei sie auch sozusagen den Generalbaß zum Weltmotiv von Ritter Kurts Brautfahrt abgibt, mit ihrer gleichstimmigen Melodie:
O verteufelte Geschichte!
Heldenhafter Lebenslauf!
Jeder Ironie bar, so gelassen wie möglich, sagt STERNE: What is the life of man? Is it not to shift from side to side? – from sorrow to sorrow? – to button up one cause of vexation, – and unbutton another?, Tristram Shandy CXVII i.f. Im Geiste PLATONS erkannt als der επισυνδεσμος απαραβατος της εἱμαρμενης, von SCHILLER so verdeutscht:
Doch mit des Geschickes Mächten
Ist kein ew'ger Bund zu flechten,
Und das Unglück schreitet schnell.
Ein konkretes Gegenstück, das immer zeitgemäß bleibt, gibt LAMMERT in seiner Geschichte der Seuchen, Hungers- und Kriegsnot usw., Wiesbaden 1890, S. 121, aus dem Jahr 1632, als die Schweden die Pest nach Amorbach verschleppt hatten: »Wenn morgen wieder eine Leiche vorübergefahren wird«, sagte ein Knecht beim Mähen zu seinem Herrn auf der Seewiese, »dann gehe ich fort von hier.« Am anderen Tage wurde dieser Knecht selbst als Pestleiche vorübergefahren nach Reichertshausen. Wie da unter solchen Umständen nur äußerste Behutsamkeit etwa doch sich bewähren könnte, ist gleichnisweise im Saṉyuttakanikāyo dargestellt, ed. Siam. vol. IV, p. 233 (PTS 189 fehlerhaft, lies sato va mit S etc.). Ein Jünger, der, wie er geht und steht, sich [772] von trauriger Begehrlichkeit, von schlechten, unheilsamen Dingen nicht überkommen lassen will, hat ein Betragen nachgeahmt und erworben wie ein Mann, der in dorniges Dickicht geraten ist: vor sich hat er Stacheln, hinter sich Stacheln, rechts und links hat er Stacheln, unter sich Stacheln, über sich Stacheln; nur vorsichtig hinschreitend, vorsichtig ausweichend mag er sich wohl in achtnehmen, daß ihn kein Dorn durchbohre. Ebenso nun auch wird, was in der Welt lieblich erscheint, ergetzlich erscheint, im Orden des Heiligen »Dickicht« genannt. Es ist die selbe Anschauung, wie DANTE seine Wanderschaft beginnt:
Nel mezzo del cammin di nostra vita
Mi ritrovai per una selva oscura,
Che la diritta via era smarrita.
Eh quanto, a dir qual era è cosa dura
Questa selva selvaggia ed aspra e forte
Che nel pensier rinnova la paura!
Tanto è amara, che poco è più morte.
Das Leben des Menschen als Dickicht erkannt: als ein Dornenwald, wo schlimmer Ausgang, grausiger Tod jedem bevorsteht, wie bei unserem Kaḷāramajjhako in der Mitte seines Lebenswandels, jedem über kurz oder lange droht, der dem Dorngestrüpp nicht zu entweichen versteht. Dem Jünger im Orden des Meisters werden namentlich zehn verschiedene Arten von Dorn gezeigt, die er auf seinem Wege durch das wild verwachsene Dickicht der Welt finden und meiden lernt. Hat er Einsamkeit liebgewonnen, ist ihm Geselligkeit ein Dorn. Hat er das Merkmal der Unschönheit eifrig zu beachten, ist ihm das Merkmal der Schönheit ein Dorn. Hat er die Tore der Sinne zu hüten, ist ihm Festgepränge ein Dorn. Lebt er züchtig enthaltsam, ist ihm Weiberbesuch ein Dorn. Zur ersten Schauung gelangt, ist ihm Geräusch ein Dorn. Zur zweiten Schauung gelangt, ist ihm Sinnen und Gedenken ein Dorn. Zur dritten Schauung gelangt, ist ihm Freude ein Dorn. Zur vierten Schauung gelangt, ist ihm das Atmen ein Dorn. Zur Auflösung der Wahrnehmbarkeit gelangt, ist ihm Wahrnehmung und Empfindung ein Dorn. Und Gier, Haß und Irre ist Dorn. »Ohne Dornen, ihr Mönche, sollt ihr sein, ohne Dornen, rein von Dornen, ihr Mönche, sollt ihr sein: ohne Dornen, ihr Mönche, sind Heilige, ohne Dornen, rein von Dornen, ihr Mönche, sind Heilige«, Aṉguttaranikāyo, Dasakanipāto Nr. 72, ed. Siam. p. 120f. Hieran schließt sich noch der Spruch, daß der Wald nicht in den Bäumen sondern im Willen zu suchen und zu fällen sei: denn im Willensdickicht wohnt der Graus, Dhammapadam v. 283; nach Etymologie, Wortgebrauch und weiterer Beziehung untersucht in meiner Übersetzung »Der Wahrheitpfad«, Leipzig 1893, S. 73 u. 155f. Dies hatte auch FRANZISKUS wohl erkannt, da er die Dornen des BENEDIKT, die sich dieser in der Felsenklause des Sagro speco bei Subiaco zur Kasteiung einst gepflanzt hatte, bei seinem Besuche ganz leicht in Rosen zu verwandeln wußte: denn auch er war ein Heiliger ohne Dornen, rein von Dornen, und auch sein Dickicht, das er endlich überwunden, war nicht in Dorn und Wald gelegen.
752 Auf ähnliche Weise spricht Saccako der junge Nigaṇṭher zu den Vajjīnern, in der 35. Rede der Mittleren Sammlung S. 255. Unsere obige Stelle von Pāṭikaputto ist mit den gleichen parataktischen Disjunktivsätzen in den nördlichen Kanon übergegangen, bis in das mongolische Ueligerün Dalai, wo im 13. Kapitel die gegnerischen Asketenmeister zu den Fürsten so sprechen: Wenn der Asket Gotamo eine überirdische Machtbezeugung ausführen wird, werden wir zwei ausführen. Zeigt er zwei, wir [773] zeigen vier; zeigt er vier, wir zeigen acht, zeigt er acht, wir zeigen sechzehn; zeigt er sechzehn, wir zeigen zweiunddreißig; so viel auch immer der Asket Gotamo an überirdischen Machtbezeugungen ausführen sollte, wir werden da immer das doppelte und dreifache ausführen, I.J. SCHMIDT, Forschungen im Gebiete etc. der Völker Mittelasiens, vorzüglich der Mongolen und Tibeter, St. Petersburg 1824, S. 261. Gerade an solchen nebensächlichen Zügen ist oft die erstaunlich getreue, wörtlich übereinstimmende Wiedergabe nach dem ursprünglichen Pāli-Kanon erwiesen: wobei hier das Mongolische doch nur aus dem Tibetischen, also nicht einmal aus dem sekundären Sanskrit übertragen war. – Die Art wie Pāṭikaputto, Saccako und Genossen Eindruck zu machen hoffen ist in Indien und anderwärts bei jeder Fakultät wohlbekannt. GONGORA weist sie ähnlich auf, zwar nur bei der medizinischen seiner Zeit; es ist aber nicht eben schwer sie je und je gleichbetätigt zu merken, nach der 11. Letrilla, mit ihrem ṭhānam etaṃ vijjati, n'etaṃ thānaṃ vijjati = bien puede ser, no puede ser:
Daß ein Arzt sei um so gewichtiger,
Je mehr er verschreibt als ein tüchtiger,
Das kann wohl sein;
Doch daß nicht mehr Kenntnis wird haben,
Wer da mehr hat als andre begraben,
Das kann nicht sein.
753 Mit S Bhagavatā p'assa (sic), und odhāritā.
754 pāvaḷā, prāvarā, von prāvaraṇam; vergl. Anm. 748 den Lendenschurz. Ein Ordensgenosse Pāṭikaputtos, der aus der 8. Rede schon bekannte Unbekleidete Kassapo, rührt uns einmal im Gespräch mit dem Hausvater Citto durch das treuherzige Geständnis, er habe während seiner dreißigjährigen Pilgerschaft kein anderes Wohlbefinden erfahren als der Regel gemäß nackt zu gehn, geschoren zu sein und den Lendenschurz aufzubinden: aññatra naggeyyā ca muḍṇeyyā ca pāvaḷanipphoṭanāya ca, Saṉyuttakanikāyo IV 300. Diese wortkargen Genossen gehören zur Klasse der eḷamūgā, der traurigen Schweiger, der Dumpfen und Stumpfen, die da taub und stumm sind – σιγησας ήνικ' εδει λεγειν sagt DEMOSTHENES; oder man kann den Satz auch ebenso richtig umgedreht anwenden, sich der Meinung anschließen: si tacuisset, philosophus mansisset. Immerhin gelten solche Urteile zunächst nur vom äußeren Menschen: denn es mögen sich wohl auch unter den anscheinlich so Dumpfen und Stumpfen gar manche befinden, die da wie NESTOR, einer der Altväter in der thebaïschen Wüste, von dem urbüßertümlichen Gedanken geleitet werden: »Du mußt erst zu einem Esel werden, willst du göttliche Weisheit haben«, ein Wort, das SEUSE gebilligt hat, ed. BIHLMEYER p. 105. Vergl. Manus II 110 usw. jaḍavalloka ācaret, Lieder der Mönche v. 501:
Mit scharfem Auge schein' er blind,
Mit scharfem Ohre schein' er taub,
Mit scharfem Witze stumm und stumpf,
Mit scharfen Sinnen blöde, blach:
Und will ihn Ruh' bedünken recht,
Bedächtig rasten wird er dann.
Als erster hat LAO-tse diese Ansicht gezeigt, seine Welt- und Menschenkunde weist dahin aus, im Tao-te-king ed. JULIEN Nr. 20, 45, 67, 70 Ende.
755 Abhabbo pana kho āvuso acelo zu lesen.
[774] 756 Mit S besser appeva nāmāhaṃ (sic) sakkuṇeyyam.
757 Die Glosse migarājā ist aus den nachfolgenden Strophen herübergenommen.
758 amaññi kotthu, migarājā 'ham asmi auch mit S. – Das Gebaren des Schakals ist hier recht anschaulich vorgeführt, wie es ja überhaupt die Inder auszeichnet, daß sie den Charakter der Tiere vorzüglich kennen und darstellen: und zwar nie mit der bei uns beliebten garstigen Übertreibung wie etwa im Reineke, sondern immer durchaus natürlich, wenn auch fein stilisiert. Eine Meistersammlung dieser Art bietet das Jātakam, jene Sagenbildung mit dem lustigen Fabelgeäst an dem schwersinnigen Stamme, von dem späterhin das Pañcatantram, der Hitopade as u.a.m. zu bunten Kränzen gepflückt und nach allen Richtungen verteilt und verstreut worden sind. So tiefe und nüchterne Tierbeobachtung und -kunde auf dem heimischen Grund und Boden kann man annähernd nur noch bei den Griechen finden, die übrigens auch dabei, wie längst bekannt, indisches Erbgut empfangen hatten. Man denke nur an AESOP, bis zu BABRIOS und AELIAN herab. Deutlich geht dieses Verhältnis aus der schönen Zusammenfassung hervor, die PORPHYRIOS im dritten Buche seiner Schrift »Kein Tier zu essen« gibt, wo er, unsere neuesten Forschungsergebnisse schon vorwegnehmend, sagt: »Die Natur hat allen Wesen, denen sie Sinn und Auffassung gab, auch Verstand dazugegeben, ja sogar eine Sprache verliehen, eine innere und eine äußere. So haben denn auch APOLLONIOS der Tyaneer, MELAMPOS, TEIRESIAS, THALES die Äußerungen der Tiere wohl zu unterscheiden und zu verstehn vermocht; wobei nicht zu verwundern ist, daß wir sie nicht verstehn, die wir ja auch von den Sprachen der meisten Völker keine Ahnung haben. Den Tieren eignet also auch Verstand, und man kann den Menschen nicht etwa einzig darum von ihnen absondern: vielmehr nur insofern bei ihm der Verstand auf das höchste entwickelt ist, bei den Tieren aber unvollkommen.« Besser noch werden wir Nordländer das vielleicht einsehn, wenn wir eine Anmerkung KANTS hier gebührend beachten, aus dem 90. § der Kritik der Urteilskraft, wo die Vernunft des Menschen an dem Verstande der Tiere gemessen wird, und es heißt: »Aber aus der ähnlichen Wirkungsart der Thiere (wovon wir den Grund nicht unmittelbar wahrnehmen können) mit der des Menschen (dessen wir uns unmittelbar bewußt sind) verglichen, können wir ganz richtig nach der Analogie schließen, daß die Thiere auch nach Vorstellungen handeln (nicht, wie Cartesius will, Maschinen sind), und, unerachtet ihrer specifischen Verschiedenheit, doch der Gattung nach (als lebende Wesen) mit dem Menschen einerlei sind. Das Princip der Befugnis, so zu schließen, liegt in der Einerleiheit des Grundes, die Thiere in Ansehung gedachter Bestimmung mit dem Menschen, als Menschen, so weit wir sie äußerlich nach ihren Handlungen mit einander vergleichen, zu einerlei Gattung zu zählen. Es ist par ratio.« Diese par ratio nun aber ist auch an unserem Schakal oben im Text, um seiner selbst willen sowie als Gleichnis in weiterer Beziehung, gar wohl zu merken.
Die Bezeichnung »Löwenruf«, sīhanādo, wird gern gebraucht um die Darlegung der Lehre zu kennzeichnen, so in der 11. und 12. Rede der Mittleren Sammlung, insbesondere erklärt in unserer 8. Rede, S. 124f.; auch Bruchstücke der Reden v. 684, 1015. Sie gilt zugleich bei hervorragenden Jüngern, bei Sāriputto z.B. in der 16. Rede, Mitte des 1. Berichts, und in der 28. am Anfang, schön auch bei Bhāradvājo, Lieder der Mönche v. 177. Umfassend ist das Gleichnis im Saṉyuttakanikāyo angewandt, ed. Siam. vol. III, p. 75 (PTS 84): Wenn der Löwe, der König der Tiere, am Abend das Lager verläßt, reckt er und streckt er sich, blickt ringsum nach den vier Himmelsgegenden aus, läßt dreimal den Löwenruf erschallen und zieht dann auf Beute dahin. Die nun da von den gewöhnlichen Tieren den Ton der Löwenstimme vernehmen, die geraten zumeist in Angst, [775] Aufregung und Entsetzen; sie fliehn von Höhle zu Höhle, von Busch zu Busch, von Wald zu Wald, und die Vögel streichen in den Lüften. Sogar die Elefanten des Königs, die in den Burgen und Schlössern fest angebunden stehn, zerreißen die Riemen und Seile, zerstampfen sie, lassen aus Angst Harn und Kot fallen und suchen dahin und dorthin zu enteilen. So hochmächtig ist der Löwe über die gewöhnlichen Tiere, so hochgewaltig, so hochüberragend. Ebenso nun auch ist es, wenn da der Vollendete in der Welt erscheint, der Heilige, vollkommen Erwachte, der Wissens- und Wandelsbewährte, der Willkommene, der Welt Kenner, der unvergleichliche Leiter der Männerherde, der Meister der Götter und Menschen, der Erwachte, der Erhabene, der die Lehre darlegt: »So ist die Form, so entsteht sie, so löst sie sich auf; so ist das Gefühl, so entsteht es, so löst es sich auf; so ist die Wahrnehmung, so entsteht sie, so löst sie sich auf; so sind die Unterscheidungen, so entstehn sie, so lösen sie sich auf; so ist das Bewußtsein, so entsteht es, so löst es sich auf.« Die nun da etwa Götter sind, von langer Dauer, in Schönheit wonnereich leben, an ihren herrlichen Wohnstätten bis zu fernen Zeiten bestehn, auch diese vernehmen den Ton der Lehre, die der Vollendete darlegt, und geraten zumeist in Angst, Aufregung und Entsetzen: ›Vergänglich, ach, sind wir ja doch nur, und hatten uns für unvergänglich gehalten! Unbeständig, ach, sind wir ja doch nur, und hatten uns für beständig gehalten! Nicht ewig, ach, sind wir ja doch nur, und hatten uns für ewig gehalten! Auch wir sogar sind also nur vergänglich, unbeständig, nicht ewig, der Persönlichkeit anheimgefallen.‹ So hochgewaltig ist der Vollendete über die Welt mit ihren Göttern, so hochmächtig, so hochüberragend. – Das deutet Jāliyoim Text oben mit an. Denn dieser Jünger des Asketen Dārupattiko, welcher damals in großem Ansehn stand, hatte gelegentlich auch Gespräche mit dem Asketen Gotamo geführt, also schon eine genauere Kenntnis von der Lehre des letzteren sich erworben; er war ihr, wie es scheint, nicht unfreundlich entgegengekommen, nach dem Bericht unserer 7. Rede, S. 114. Der Name Jāliyo, »Der mit dem Netz«, läßt vermuten, daß er vormals zu einer Laiengenossenschaft der Nāthaputtiyā nigaṇṭhā, der Freien Brüder Nāthaputtos, gehörte, da diese nur durchgeseihtes Wasser zu trinken pflegen; eine Regel, die bei den ordinierten Jainās unverbrüchlich eingehalten wird, und die schon in der Saṃnyāsopaniṣat II 3 dem Büßer zur Pflicht gemacht ist: pavitraṃ dhārayejjantusaṃrakṣaṇārtham, ein Sieb mög' er haben zum Schutze der Lebewesen. Nun ist aber solch ein pavitradhārī oder Siebträger eben nichts anderes als ein jāladhārī oder schlechthin jālyaḥ, jāliyo, da ja pavitram, wie Nārāyaṇas im Kommentar zur Upanischad richtig angibt, jala odhane zu verstehn ist, zur Reinigung des Wassers. Man kann daher nach dem jvalādigaṇas zu Pāṇinis III 1, 140 mit Recht jalao = jālao ansetzen und im Namen Jālyas, Jāliyo einen Hinweis auf jālam den Filter sowie auf jalam das Wasser in regelrechter vṛddhi gewahren.
759 Es ist natürlich mit S etc. kaṭasīsu zu lesen, nicht kaṭa-sīsu, wie der Herausgeber der Pāli Text Society verbessern zu müssen glaubt: denn kaṭasīsu ist der loc. plur. von kaṭasi, Leichenfeld; ein Ausdruck, der auf das wohlbekannte Meisterwort zurückweist kaṭasi vaḍḍhitā, das Leichenfeld ist vergrößert worden, vom Tod des gewöhnlichen Menschen, also bloß eines Mehrers der Leichen, gesagt: immer wiederholt im Anamataggasaṃyuttam, dem 15. Buch des Saṉyuttakanikāyo, ed. Siam. vol. II, p. 163-174 (PTS 178-193). Ein Teil der dort gesammelten Reden, wo jede Ansprache mit jenem Meisterwort ausklingt, ist in meiner Buddhistischen Anthologie übersetzt, Leiden 1892, [S. 923-928 des dritten Bandes dieser Ausgabe]. Auch die Lieder der Mönche und Nonnen beziehn sich nicht selten auf den berühmten Ausspruch, die ersteren z.B. in v. 456, 575, während ihn die anderen schon als eine Art Merkspruch behandeln in v. 380, 502:
[776] Seht wie sie Leichen schichten selber an,
Geboren neu, gestorben immer neu.
Denn jeder Sterbliche schafft ja als Aas und Gerippe weiter daran, schichtet und türmt ihn wieder empor, den Knochenhügel, den man, gleichwie bei Alpharts Tod, seinen »Lê«, des Leichenmehrers Denkmal nennen kann. Ein solcher Haufe Totengebein ist unermeßlich: bergeshoch schichtet sich der Knochenfels, im Verlauf auch nur einer Weltäon, während des rastlosen Wandels von Geburt und Tod, wenn man im Geiste die Knochen zusammenfaßt, bei jedem einzelnen an, bis zu einem Gebirge aus Menschenkalk, Saṉyuttakanikāyo II 168 (185). Das Bild muß auch späteren Vedenmeistern bekannt geblieben sein. Denn aṃkaras weiß offenbar etwas von dem riesigen Gleichnisse Gotamos, von den wie Kreidefelsen oder Korallenriffe aus dem Meeresgrund in unausdenkbaren Zeiträumen immer nach und nach aufsteigenden Lebensresten: janmamaraṇaprabandhārūḍhaḥ sarvo lokaḥ saṃsārasamudre nipatitaḥ sagt er zur Erklärung von Aitareyopaniṣat II 5, »Geburt und Tod aneinanderreihend emporgewachsen sind alle Wesen im Ozean der Wandelwelt versunken.« Viele Jahrhunderte später wurde dieses Verhältnis erst wieder von VOLTAIRE tief erkannt und wiederholt dargestellt, insbesondere in seinen 31 philosophischen Zwiegesprächen. Im Kapitel über die Zeugung, dem 9. Abschnitt des 29. dieser Stücke, Nachtstücke zu platonischen Gemälden und Galerien, den Dialogues d'Éphémère, sagt da z.B. Kallikrates zu Euhemeros: »La terre est un vaste cimetière qui se couvre sans cesse de mortels entassés sur leurs prédécesseurs.« Wir merken hier eine verwandte Kraft des Ausdrucks, in ihrer gedrängten Fassung ebenso ungeheuer anschaulich wie oben. Wieder in einem anderen Dialog, Les adorateurs betitelt, dem 25. der Sammlung, kommt einer der Redner zu dem Schlußergebnis: »Le globe est couvert de chefs-d'œuvre, mais de victimes; ce n'est qu'un vaste champ de carnage et d'infection ... et le globe ne contient que des cadavres.« So gelangt er zu einer »vue attentive sur cet épouvantable tableau« und hat nur noch den Wunsch: »Je voudrais n'être pas né.« Weitere Beziehungen in der Anm. 490. – Jāliyo nun aber hat oben, bei kaṭasīsu, »auf Leichenfeldern«, ohne Zweifel auf das bei unseren indischen Pilgern wohlbekannte Verhältnis angespielt, wenn auch sein Gleichnis zunächst selbständig scheint. Da ihm der Asket Gotamo und dessen Lehre nicht unbekannt war, mochte er wohl etwas dergleichen mit andeuten, was er schon selbst oder von anderen gehört hatte, an eine jener Ansprachen des Meisters kurz, mit einem Schlagwort, erinnert haben; wie es da heißt, nach der Überlieferung der Jünger: »Unausdenkbar, ihr Mönche, ist diese Wandelwelt, ein Anfangspunkt ist nicht zu erspähen bei den unwissend verwickelten Wesen, die durstverdungen umherwandeln, umherkreisen. Was ihr, Mönche, auch erblicken mögt an Übelgewordenem, Übelgeratenem, als gewiß kann da gelten: › Auch wir haben solches erfahren, auf dieser langen Laufbahn.‹ Was ihr, Mönche, auch erblicken mögt an Wohlbefinden, Wohlgedeihn, als gewiß kann da gelten: ›Auch wir haben solches erfahren, auf dieser langen Laufbahn.‹ Und warum das? Unausdenkbar, ihr Mönche, ist diese Wandelwelt, ein Anfangspunkt ist nicht zu erspähen bei den unwissend verwickelten Wesen, die durstverdungen umherwandeln, umherkreisen. So habt ihr denn, Mönche, lange hindurch Leid erfahren, Pein erfahren, Verderben erfahren, das Leichenfeld vergrößert: so daß es nun, ihr Mönche, wohl genug wäre aller Unterscheidungen satt zu sein, genug wäre sich abzuwenden, genug wäre sich abzulösen.« Saṉyuttakanikāyo 1. c.p. 168 (186). Zur Er klärung von anamataggo, unausdenkbar, s. Anm. 495 Lieder der Nonnen; mit S zu lesen sukhitaṃ susajjtam. Der gegenseitig [777] unaufhörlich wechselnde Zustand übelgeratener und wohlgedeihender Wesen, wobei alle immer alles haben, Wohl und Wehe, Treffer und Nieten, natürlich nie anders als im gemeinsamen Defizit, wird im Poenulus des PLAUTUS durch die Erfahrung des Alltags ganz zugehörig erläutert, I 2 i.f.: Agorastocles. Omnia illa, quae dicebas tua esse, ea memorares mea. Milphio. Obsecro hercle te, voluptas huius, atque odium meum. Huius amica mammeata, mea inimica, et malevola. Oculus huius, lippitudo mea: mel huius, fel meum. TERENZ aber, der das große Welttreiben mehr attisch betrachtet, hat ebendieses Gesetz des Daseins in die Formel gebracht: Omnium rerum vicissitudo est.
760 caturāsīti ist die indische Zahl für μυριοι, unzählig; vergl. Anm. 552 Mitte. – Die folgende Wunderwirkung mit dem flammenden strahlenden Schweben und Entschwinden ist später, im apokryphen Kanon, zu einem beliebten Thema geworden. Sie ist der fast unscheinbare, nur erst funkelnde Kern des Nebelflecks, der dann nach und nach zu dem Milchstraßensystem der Zauberwette von rāvastī ausgeartet ist, bei welcher alle anderen Asketenmeister übertrumpft werden. Was für eine sonderbare Entwicklung diese Wundergeschichte im Norden eingeschlagen hat, zeigt sich z.B. im 13. Kapitel des Ueligerün Dalai, nach I.J. SCHMIDTS Übersetzung S. 274 (s. oben Anm. 752): da läßt der Allerherrlichst-Vollendete aus jeder der achtzigtausend Poren seines Körpers einen Lichtstrahl hervorschießen, wodurch Himmel und Erde in unermeßlichem Glanz erglühen: an der Spitze eines jeden Strahls bildet sich aber eine mächtige Lotusrose, und inmitten jeder Lotusrose sitzt ein lehrender Buddho mit seinen Jüngern. Die Szene des flammenden Wettspiels mit den anderen Asketenmeistern ist im Relief am Kuppelmal von Barāhat, gegen Ende des dritten Jahrhunderts nach Gotamo, schon dargestellt worden, und ebenso wohl auch am Großen Kuppelmal zu Anurādhapuram, nach Mahāvaṃso 30 v. 82, in volksmäßig überschwenglicher Verherrlichung da wie dort. Das Divyāvadānam widmet dem Vorgang eigens das 12. Kapitel, wo auf S. 161 unsere obige kurze Stelle überaus breit entwickelt wird. Gandhārer Skulptur hat die Szene besonders gern behandelt und dabei den Meister mit einer Flammenaureole um das heitere Antlitz, in der Mitte huldigender Anhänger, erscheinen lassen: ein sehr schönes Hochrelief der Art aus Nattu, edel, großartig komponiert, in FOUCHERS Art gréco-bouddhique, Paris 1905, p. 535. Dergleichen Darstellungen sind, wie die Kunstverständigen in neuerer Zeit einsehn haben lernen, geradezu Meisterwerke einer stark impressionistischen Epoche; und es war nur eine ganz oberflächliche, laienhafte Betrachtung, wenn man früher immer attische Denkmale zum Vergleich heranzog, um dadurch die indische, so sehr von der gewohnten Norm abweichende Kunst herabzusetzen: ein Standpunkt, den heute wohl nur mehr OLDENBERG einnimmt, der noch in seiner kürzlich erschienenen »Lehre der Upanishaden« usw. S. 160 mit überlegener Ironie, wie er meint, von der Distanz der »Bharhutskulpturen von denen des Parthenon« spricht. – Die oben behandelte magische Erscheinung und Wirkung wird ebenso auch hervorragenden Jüngern zugeschrieben, z.B. dem ehrwürdigen Sāgato, vor einer großen Schar Anhänger, Mahāvaggo V 1, 7, und in breitester Ausführung Mahāvastu III 410 dem berühmten Ya odas; worauf OLDENBERG hingewiesen hat, in seinen vortrefflichen Studien zum Mahāvastu, Nachrichten der Göttinger Gesellschaft der Wissensch. 1912, Heft 2, S. 128. Eine Flammenbildung dieser Art zeigt auch die Erscheinung einer Gestalt des leibhaftig gewordenen Vischnus, in der Bhagavadgītā XI 24f.: wo der König, vor Entsetzen und Entzücken gesträubten Haares, in die Worte ausbricht:
[778] In bunten Farben strahlst du bis zum Himmel,
Dein weiter Blick entzündet alles um dich –
Gesichter seh' ich strahlen ungeheuer,
Dem Feuer gleich, das einst die Welten aufzehrt.
Ebenso strömt von der magischen Verkörperung des großen göttlichen Asketen, Schivas, eine blendende Zauberglut aus: es fließt von seinem Haupte wie geflochtene Flammen herab, es zucken und zünden rote Blitze furchtbar nach allen Seiten hin, Viṣṇupurāṇam V, No. 34 i.f., usw. Wunderschön auch wenn einer der Brahmās, z.B. Der mächtige Herr oder Der ewige Jüngling, gelegentlich einmal sichtbar wird: denn
Von uralt ist es Brahmās Art
Im breiten Abglanz aufzuglühn.
Siehe 18. Rede S. 325 u. Anm. 581. Angst und Bestürzung ergreift da sogar den großen Govinder Priester, S. 345. Den Zeugen solcher Offenbarung im Strahlenkranze sprühender Flammen weht der Schauer einer anderen Welt an: er fühlt wie Faust das schreckliche Gesicht, und ist dem Geiste doch so nahe, so ganz von Herzen hingegeben – aber das Bild ist nun auch schon entschwunden, ein ostentum ab ostendendo gewesen. Zu verwandten Wunderzeichen gehören ferner auch die mit einem gewissen Lächeln überglänzten magischen Kunststücke, die der ehrwürdige Moggallāno gelegentlich zum besten gibt. Um eine heilsame Erschütterung bei Leuten zu erregen, die allzu leicht dahinleben, allzu sehr mit alltäglichen Gedanken und Dingen sich abgeben, läßt er gern die erstaunliche Erscheinung entstehn, als ob er mit dem Druck seiner großen Zehe ein Gebäude zum Wanken, Beben, Erzittern brächte: er erzeugt also den Schein eines Erdbebens, das aber nur im Geiste des Zuschauers und keineswegs wirklich statthat, weil ja dabei jede schlimme Folge ausbleibt. So wird einmal sogar Sakko der Götterherr von ihm in Schrecken versetzt und zu besserer Besinnung gebracht, als er bei einem Besuche dessen Himmelspalast auf diese Weise zu wackeln zwingt, nach der launigen Legende in der 37. Rede der Mittleren Sammlung S. 282; oder wie ein andermal eine Schar lauer, lässiger Ordensbrüder, geschwätzige, zerstreute Gesellen dadurch zur Einsicht gelangen, daß es ihnen vorkommt, als ob Mutter Migāros Terrassenbau, der Quadergrund am Hirschenstein, wo sie sich gerade befinden, o Wunder, plötzlich erbebte, bloß durch den Druck der Zehe des sinnesgewaltigen Mahāmoggallāno, nach der Episode im Pāsādakampanavaggo des Saṉyuttakanikāyo, ed. Siam. vol. V, p. 270, PTS 269. Wenn solche und andere Wunderwirkungen in buddhistischen Kreisen, als altüberkommene Sagen, erzählt werden, sind sie da immer als Vor- oder Nachspiel gedacht, als ein Prolog oder Epilog zur Darlegung der Lehre gegeben. Die ergriffenen Hörer merken nun erst, welch eine erstaunliche, außerordentliche Macht dem Asketen eignet, schon bei nur äußeren, bloß nebensächlichen Bedingungen und Umständen – um wieviel mehr also wird da wohl auf sein Wort zu achten sein; wie dies z.B. Kevaṭṭo, ein junger Bürgersmann aus der großen volkreichen Stadt Nālandā, im 11. Stück unserer Sammlung S. 148f., ganz naiv ausspricht, gar viel davon hält: alsbald aber freilich von Gotamo, in dieser echten unvermischten Rede, eine glatte Ablehnung erfährt. Denn solche Wunder seien eben doch nur »ungehörig, unbekömmlich, unerquicklich«, das wahre Wunder ist das der Unterweisung, S. 149f. So wäre denn hier auf Gotamo, wunderbar ohne Wunder, CAESARS Wort anzuwenden: Veni, vidi, vici; oder nach der unpersönlichen Form, die KARL V. sich geprägt hat: Vine, vi, vencio Dios, »Es kam, sah, siegte Gott«, das ist, nach rein sachlicher Anschauung, [779] der Logos der Unterweisung; der selbe, der das Merkmal auch jenes Weisen ausmacht, den VOLTAIRE in seinem morgenländischen Weltspiegel als den Inbegriff menschlicher Tugend betrachtet: »Quand il jugeait une affaire, ce n'était pas lui qui jugeait, c'était la loi«, Zadig, chap. 6. Vergl. noch Anm. 822. Ganz ebenso aber heißt es grundsätzlich im buddhistischen Orden nicht etwa »der Meister behandelt uns«, sondern »die Lehre behandelt uns«, Mittlere Sammlung 89; und in der Abschiedsrede an die Jünger, kurz vor dem Tode, sagt Gotamo: »Was ich euch als Lehre und als Zucht aufgewiesen und angegeben habe, das ist nach meinem Verscheiden euer Meister«, 16. Rede S. 289f. Das ist, genauer betrachtet, die Wunderflamme, die unzählige Wesen aus dem großen Sumpfbereich emporzieht, nach dem Ausdruck im Text oben.
761 Der Text lautet mit S etc. richtig: Aggaññañ cāhaṃ Bhaggava pajānāmi, tato ca uttaritaram pajānāmi; tañ ca pajānanaṃ na parāmasāmi: aparāmasato 'va me paccattaṃ yeva nibbuti viditā, yad abhijānaṃ tathāgato no anayam āpajjati. Vergl. den selben Ausdruck in der ersten Rede unserer Sammlung, 194-217. Der anayo ist ein Gegensatz zum vinayo und als nayavipanno zu erklären; cf. Rāmāyaṇam II 12 18 und das Petersburger Wörterbuch 1 VII, Spalte 1692 s.v.
762 kuttam, kutram, Abstrakt von kutra.
763 mamaññeva = mamaṃ yeva zu lesen.
764 Dieser lapsus coeli ist als der zuerst wahrnehmbare wunde Punkt einer, wie hier und mehr noch in der späteren (27.) Darlegung gezeigt wird, immer nun weiter und weiter fortschreitenden Entartung zu betrachten: durch Mangel an Kraft, Mangel an Güte ist Unheil entstanden, die Welt siech und böse geworden, also durch eigene Schuld; genau so wie das die Sage der älteren Upanischaden lehrt, und auch HERAKLIT es sich vorgestellt hat, der die Welt mit all ihrem Jammer aus sich selbst entwickelt erklärt, ja wie es sogar noch der Verfasser der CLEMENS von Rom zugeschriebenen 19. Homilie unumwunden als denkbar zugibt: ὁ πονηρος ἑαυτον δημιουργησας, Malus se ipsum creavit, ed. DRESSEL 1 p. 378, eine Erkenntnis, die ohne Zweifel aus unserer indogräkischen Weisheit und ihrer einheitlichen Anschauung herzuleiten ist. Denn sehr verschieden von seinem iranischen Bruder, kennt der Inder keinen Dualismus, nur eine Pluralität der Erscheinungen, vom tausendäugigen Puruṣas der Veden bis zur zehnarmigen Durgā der Purāṇen herab, als der richtige lokatattvavicakṣaṇas oder Weltgeschichtskundige. Wenn also auch jene herabgesunkenen brahmischen Wesen immer weiter entarten, sich je einzeln entwickeln, je einzeln bedünken, je einzeln behaupten, so ist es doch nichts anderes als gleichsam nur ein vielflächiges Rautenbild, das nun im öden Brahmahimmel selbstleuchtend aufgeht; im Reigen der Mythe verbunden mit jener dreiunddreißigfachen Selbstgestaltung des einen sogenannten Ewigen Jünglings, dessen Wandlungen in unserer 18. Rede (S. 328) gezeigt und mit dem Spruche begleitet werden:
Nur einer war es, der da sprach,
Und jedes Bild, es sprach da mit;
Nur einer war es, der nun schwieg,
Und alle Bilder schwiegen still.
In den Metamorphosen OVIDS, die ja gar manchen indischen Abglanz widerspiegeln, heißt es dafür, bei der Schilderung der Regia Solis, zu Beginn des 2. Buchs:
facies non omnibus una,
Nec diversa tamen.
[780] Es gibt nun, nach Gotamos Anschauung, unermeßlich viele Welten: wenn auch etwa ein machtbegabter Seher ein Jahrhundert hindurch pfeilschnell dahinzöge und dabei Tritt um Tritt immer einen Raum so weit wie vom östlichen bis zum westlichen Meer zurücklegte, wäre noch kein Ende der Welt abzusehn, und er stürbe darüber hinweg: Saṉyuttakanikāyo ed. Siam. vol. I, p. 83f. (PTS 61f.). Dazu die weiteren Stellen Mitte der Anm. 1003. Wundersam entsprechend hat auch SCHILLER so »Die Größe der Welt« durch einen Sonnenwanderer im Doppelbilde zu veranschaulichen gesucht. Er läßt ihn fliegen des Windes Flug durch die schwebende Welt, an den Strand ihrer Wogen hinzugelangen, wo kein Hauch mehr weht.
Sterne sah ich bereits jugendlich auferstehn,
Tausendjährigen Gangs durchs Firmament zu gehn,
Sah sie spielen
Nach den lockenden Zielen;
Irrend suchte mein Blick umher,
Sah die Räume schon – sternenleer.
Anzufeuern den Flug weiter zum Reich des Nichts,
Steur' ich mutiger fort, nehme den Flug des Lichts,
Neblicht trüber
Himmel an mir vorüber,
Weltsysteme, Fluten im Bach,
Strudeln dem Sonnenwandrer nach.
Sieh, den einsamen Pfad wandelt ein Pilger mir
Rasch entgegen – »Halt an! Waller, was suchst du hier?«
»Zum Gestade
Seiner Welt meine Pfade!
Segle hin, wo kein Hauch mehr weht,
Und der Markstein der Schöpfung steht!«
»Steh! du segelst umsonst – vor dir Unendlichkeit!«
»Steh! du segelst umsonst – Pilger, auch hinter mir! –
Senke nieder,
Adlergedank', dein Gefieder!
Kühne Seglerin, Phantasie,
Wirf ein mutloses Anker hie.«
In den unzählbaren, unendlichen Weltbereichen »vor dir, auch hinter mir«, meint nun aber, wie es im Text oben heißt, wann sich eine der Welten wieder einmal auseinanderballt, irgendeines der herabgesunkenen brahmischen Wesen, es sei der Herr, der Höchste, der Vater von allem was da war und sein wird: ohne Ahnung daß zugleich mit ihm zahllose andere Große Brahmās bestehn, die an derselben himmlischen Gedächtnisschwäche leiden, sich ganz ebenso je einzeln für das Urwesen, den Schöpfer, den »lieben Gott« halten. Manche Asketen und Priester folgen aber, auf ihrer geistigen Fährte, dieser irrigen Gedankenrichtung und gelangen daher zu der Lehre vom Voranfang mit einem Herrn als Ursprung, einem Brahmā als Ursprung der Welt und als Urselbst: so gleich zu Beginn der Aitareyopaniṣat, wo die Rigvedenpriester, die bahvḥcabrāhmaṇās, oder bavharicā brāhmaṇā unserer 13. Rede, sagen und lehren: Ātmā [781] vā idam eka evāgra āsīt; siehe noch Anm. 21 u. 23. Es zeigt sich nun aber nach unserem Text auch hier wieder wie so oft eine merkwürdige, weit zurückreichende Verwandtschaft mit den Mythen der altgriechischen Überlieferung, nach der es nicht nur einen »Allvater« sondern deren gar viele gab. So ist z.B. noch in den Metamorphosen OVIDS der Demiurg bei der Weltentstehung nicht etwa Jupiter oder Uranos oder der Ozean wie bei HOMER und HESIOD, sondern es ist, wie nach der >Ṛksaṃhitā X 121 usw., der große unbekannte Wer, Kaḥ, »wer auch immer jener gewesen sein mag der Götter«, quisquis fuit ille deorum, I 32; und sehr ausführlich spricht CICERO darüber, daß die alten Griechen sogar mehrere Jupiter gehabt haben: nam Ioves quoque plures in priscis Graecorum litteris invenimus, belehrt er uns, De natura deorum III 16-23, nachdem er vorher gefragt hatte, wie groß wohl die Menge der Götter sein mag? »Mir freilich scheinen es recht viele zu sein: man kann ja die einzelnen Sterne als Götter betrachten«, wie man sie auch, sagt er, nach dem Fuhrmann, Krebs, Stier, Löwen usw. benennen mag. Man darf also keineswegs einen einzigen Brahmā, als einen Mittelpunkt, annehmen, sondern immer deren unendlich viele. Jeder solche Brahmā oder Mittelpunkt im öden Brahmahimmel ist gewissermaßen ein Weltsystem für sich. Geradeso, dürfen wir nun fortfahren, wie die Sonne wohl das Zentrum des kopernikanischen Planetenreigens ist und uns nur mit bedingter Berechtigung als der mächtigste Himmelskörper gilt: von höherer Warte aus aber gesehn, nämlich von der, die LAMBERT in seinem 11. Kosmologischen Briefe erreicht hat, flimmert auch sie nur als einer der mehr und weniger winzigen glitzernden Sterne unter all den zahllosen übrigen »durch die Nächte der Einwohner, die um den Sirius, Arcturus und andere Fixsterne herum sind«: ebenso nun auch kann ein jeder jener großmächtigen Brahmās immer nur je nach dem Standpunkt als der Kern einer gewissen Göttersphäre gelten. Dabei finden wir nun, wie LAMBERT vorher schon dargetan, im 9. dieser Briefe, Augsburg 1761, S. 108, »Welten auf jedem Staube, in jedem Tropfen, und bald wird kaum der Staub so zahlreich seyn, als die Weltkugeln am Firmamente.« Und man kann diese Betrachtung am besten mit dem 19. Briefe, S. 275, beschließen, kann die bedingte wandelbare Großmächtigkeit übereinstimmend erklären: da ein jeder Brahmā, der selbstleuchtend im Raume kreist, lange Wandlungen durchdauert, ist er als ebenso beständig-unbeständig anzusehn wie etwa unser planetarischer Mittelpunkt, »weil die Sonne, so wenig als die Fixsterne, an ihrer Stelle bleibt. Die Scene verwandelt sich, und es wird eine Zeit kommen, wo das Sternbild des Orions vielleicht so aussehen wird, wie jezt das von dem grossen Bären.«
Solche, in die unendliche Welt der Erscheinungen ausschweifende Betrachtung ist dasjenige, was KANT in der Kritik der ästhetischen Urteilskraft § 25-29, mit einer nie genug zu bewundernden Unbestechlichkeit, als das eigentlich Erhabene gezeigt, untersucht, richtig begreifen gelehrt hat. Das Erhabene, sagt er, liegt nicht sowohl in der Größe der Zahl eines so unermeßlichen Ganzen, der unermeßlichen Menge der Milchstraßensysteme und Nebelsterne, welche vermutlich wiederum ein dergleichen System unter sich ausmachen und wobei sich keine Grenzen erwarten lassen: vielmehr liegt es darin, daß wir im Fortschritte immer auf desto größere Einheiten gelangen; wozu die systematische Abteilung des Weltgebäudes beiträgt, die uns alles Große in der Natur immer wiederum als klein, eigentlich aber unsere Einbildungskraft in ihrer ganzen Grenzlosigkeit, und mit ihr die Natur als gegen die Ideen der Vernunft, wenn sie eine ihnen angemessene Darstellung verschaffen soll, verschwindend vorstellt. So kommt man zu einem Maßstab, welcher jene Unendlichkeit selbst als Einheit unter sich hat, gegen den alles in der Natur klein ist, mithin in unserem Gemüte eine Überlegenheit [782] über die Natur selbst in ihrer Unermeßlichkeit gefunden wird, ein Vermögen entdeckt wird, uns als von ihr unabhängig zu beurteilen, und eine Überlegenheit über die Natur, worauf sich eine Selbsterhaltung von ganz anderer Art gründet als diejenige ist, die von der Natur außer uns angefochten und in Gefahr gebracht werden kann, dabei die Menschheit in unserer Person unerniedrigt bleibt, obgleich der Mensch jener Gewalt unterliegen müßte. »Also ist die Erhabenheit in keinem Dinge der Natur, sondern nur in unserem Gemüte enthalten, sofern wir der Natur in uns, und dadurch auch der Natur (sofern sie auf uns einfließt) außer uns, überlegen zu sein uns bewußt werden können.« I 2 § 28, letzter Absatz. Dieses kantische Epibaterion zur Erhabenheit des Menschen über alle unermeßliche Welten und Sternenkreise und über die ganze Natur erreicht dann die Klimax in der Kritik der teleologischen Urteilskraft, II 2, § 83, 2. Absatz Ende: »Als das einzige Wesen auf Erden, welches Verstand, mithin ein Vermögen hat, sich selbst willkürlich Zwecke zu setzen, ist er zwar betitelter Herr der Natur, und, wenn man diese als ein teleologisches System ansieht, seiner Bestimmung nach der letzte Zweck der Natur; aber immer nur bedingt, nämlich daß er es verstehe und den Willen habe, dieser und ihm selbst eine solche Zweckbeziehung zu geben, die unabhängig von der Natur sich selbst genugsam, mithin Endzweck, sein könne, der aber in der Natur gar nicht gesucht werden muß.« All dies ist aber in der oben angeführten Stelle aus dem Saṉyuttakanikāyo schon vorweg bedeutet, wenn dort ein machtbegabter Seher auf seiner lebenslänglich pfeilschnellen Reise durch den Raum doch nicht das Ende der Welt erreichen oder auch nur absehn kann; und dann Gotamo, a.a.O.p. 84, die Erhabenheit des Menschen über die ganze Natur im Gemüt, im Bewußtsein sicherstellt, indem er die Summe zieht: »Wo es kein geborenwerden und altern, kein sterben und vergehn und entstehn gibt, dies Ende der Welt, sag' ich, kann durch kein Wandern erforscht, erschaut, erreicht werden; und doch sag' ich, daß ohne das Ende der Welt zu finden dem Leiden kein Ende gemacht werden kann: aber in eben diesem klaftergroßen Leibe da, dem wahrnehmen und denken anhaftet, lass' ich die Welt verstanden sein, die Weltentwicklung, die Weltauflösung und den zur Weltauflösung führenden Pfad.«
765 Hierzu unsere erste Rede S. 16-17.
766 Siehe Anm. 33 richtige Lesung und Nachweise. Sodann mit S etc.: Adhiccasamuppanno attā ca loko ca. Das oft mißverstandene Wort ist in der Anm. 877 rein philologisch untersucht. Zur Sache sei hier bemerkt, daß um dieselbe Zeit, also etliche Generationen nach den ersten indischen Dogmatikern des Geistes, auch ANAXAGORAS ein gewissermaßen überweltliches Denken als den Anfang der Dinge bezeichnet hat, den Geist als Beginn der Bewegung, νουν μεν αρχην κινησεως, DIOG. LAERT. II 3, 4. Dann hat es zwei Jahrtausende gedauert bis DESCARTES wieder sagte: »Ego cogito, ergo sum«, und: »Cogito, sum. Hoc habeo, et unum habeo, ac praeter illud unum nihil est, nihil fuit«, Obiectiones septimae II § 6; was, beiläufig erwähnt, im folgenden Jahrhundert von LICHTENBERG übernommen und ausgezeichnet verdeutscht wurde: »Mir kommt es immer vor, als wenn der Begriff seyn etwas von unserm Denken erborgtes wäre, und wenn es keine empfindenden und denkenden Geschöpfe mehr gibt, so ist auch nichts mehr.« Genau betrachtet verhält es sich so, daß jene Asketen und Priester, wenn sie das Selbst und die Welt als aus dem Denken entstanden erklären, in die diallelische Zwickmühle geraten: ohne Bewußtsein keine Welt und ohne Welt kein Bewußtsein. Der Zirkel vom Huhn und Ei usw., wobei man sich immer in unauflösbare Widersprüche verwickeln muß. Darum kann man dabei nicht beharren, kann nur Einkehr in sich finden, ein Verstehn, »bei dem der Vollendete nicht in die [783] Schiefe gerät«, wie der Meister oben sagt. Läßt sich ein Begriff nicht durch die Anschauung belegen, so ist mit ihm nichts anzufangen, er ist abzuweisen: und ein denkendes Wesen ohne Gehirn ist wie ein verdauendes Wesen ohne Magen. Dieses Wort SCHOPENHAUERS stimmt mit der Ansicht Gotamos vollkommen überein; gerade heutzutage, wo allerhand spiritualistischer Aberglaube wieder neu aufgeputzt wird, sei daran erinnert. Eine weitere vorzügliche Bestätigung ist uns im Saṉyuttakanikāyo erhalten, ed. Siam, vol. IV, p. 212f. (PTS 171f.), wo Gotamo also spricht: »Wenn, ihr Mönche, Hände da sind, wird Fassen und Lassen erkannt; wenn Füße da sind, wird Kommen und Gehn erkannt; wenn Glieder da sind, wird Einziehn und Ausstrecken erkannt; wenn ein Bauch da ist, wird Hungern und Dürsten erkannt: ebenso nun auch, ihr Mönche, kommt es, wenn ein Auge da ist, zu einer durch Sehberührung bedingten Empfindung von Wohl und Weh; kommt es, wenn ein Ohr, eine Nase, eine Zunge, ein Tasten, ein Denken da ist, zu einer durch Hörberührung, Riech-, Schmeck-, Tast-, Denkberührung bedingten Empfindung von Wohl und Weh. Wenn, ihr Mönche, keine Hände da sind, wird kein Fassen und Lassen erkannt; wenn keine Füße da sind, wird kein Gehn und Kommen erkannt; wenn keine Glieder da sind, wird kein Einziehn und Ausstrecken erkannt; wenn kein Bauch da ist, wird kein Hungern und Dürsten erkannt: ebenso nun auch, ihr Mönche, kommt es, wenn kein Auge da ist, zu keiner durch Sehberührung bedingten Empfindung von Wohl und Weh; kommt es, wenn kein Ohr, keine Nase, keine Zunge, kein Tasten, kein Denken da ist, zu keiner durch Hörberührung, Riech-, Schmeck-, Tast-, Denkberührung bedingten Empfindung von Wohl und Weh.« Diese Art von Betrachtung wird uns vom Mönche Khemako durch ein Gleichnis trefflich erläutert, ib. III 117 (PTS 130 falsch pi statt ti, vā zweimal ausgelassen): »Gleichwie etwa, ihr Brüder, eine blaue oder eine rote oder eine weiße Lotusrose Duft hat; wenn da nun jemand sagte: ›Im Blatt ist der Duft‹, oder ›In der Farbe ist der Duft‹, oder ›Im Staubfaden ist der Duft‹: würde der etwa so richtig gesagt haben?« – »Gewiß nicht, Bruder.« – »Wie also, ihr Brüder, müßte er zutreffend sagen?« – » ›Die Blume hat den Duft‹, müßte er, Bruder, zutreffend sagen.« – »Ebenso nun auch, ihr Brüder, sag' ich, daß man an der Form kein ›Ich bin‹ hat, sage aber auch, daß man außer der Form kein ›Ich bin‹ hat; sag' ich, daß man am Gefühl, an der Wahrnehmung, an den Unterscheidungen, am Bewußtsein kein ›Ich bin‹ hat, sage aber auch, daß man außer dem Gefühl, außer der Wahrnehmung, außer den Unterscheidungen, außer dem Bewußtsein kein ›Ich bin‹ hat. Und da hab' ich denn, ihr Brüder, bei den fünf Stücken des Anhangens das ›Ich bin‹ entdeckt: aber daß ich da ein ›Ich bin‹ hätte, ist nicht auszufinden (ayam aham asmīti na ca samanupassāmi mit S).« Wenn man nun bei den fünf Stücken des Anhangens ihr Entstehn und Vergehn beobachtet, so schwindet was ihnen anhaftet als Dünkel, als Wille, als Gewohnheit des ›Ich bin‹ allmählich hinweg. Weiters noch die Anm. 878. Vom Standpunkt der neueren Erkenntnistheorie hat niemand dieses Thema so ausführlich behandelt wie HUME, dessen Lebenswerk darin gipfelt immer wieder und immer deutlicher die Vorstellung einer einfachen Persönlichkeit, eines beharrenden ›Ich bin‹, als hinfällig nachzuweisen. Sein »Treatise of Human Nature« zeigt lange 250 Seiten hindurch stets nur die eine sichere Tatsache des Non ego an, indem er sie von allen möglichen Seiten beleuchtet und durchleuchtet, mit dem schneidendsten Scharfsinn zerlegt, mit höchster Behutsamkeit und Besonnenheit das gegebene Verhältnis untersucht und das nach und nach so gewonnene Ergebnis unwiderleglich bestimmt vorträgt. Im vorletzten Abschnitt, »Of Personal Identity«, zieht er die Folgerungen auf elf Seiten zusammen und gibt damit einen Kommentar zur zweiundzwanzig Jahrhunderte [784] vorangegangenen Lehre Gotamos, wie er besser nicht zum zweitenmal ausgedacht werden mag. Da heißt es z.B., »self or person is not any one impression, but that to which our several impressions and ideas are suppos'd to have a reference. If any impression gives rise to the idea of self, that impression must continue invariably the same, thro' the whole course of our lives; since self is suppos'd to exist after that manner. But there is no impression constant and invariable. Pain and pleasure, grief and joy, passions and sensations succeed each other, and never all exist at the same time. It cannot, therefore, be from any of these impressions, or from any other, that the idea of self is deriv'd; and consequently there is no such idea.« Weiter sodann, »when I enter most intimately into what I call myself, I always stumble on some particular perception or other, of heat or cold, light or shade, love or hatred, pain or pleasure. I never can catch myself at any time without a perception, and never can observe any thing but the perception. – If any one, upon serious and unprejudic'd reflection, thinks he has a different notion of himself, I must confess I can reason no longer with him.« Er sagt, er dürfe nunmehr wohl feststellen, daß der Mensch nichts anderes sei als ein Bündel oder eine Sammlung verschiedener Wahrnehmungen, »a bundle or collection of different perceptions, which succeed each other with an inconceivable rapidity, and are in a perpetual flux and movement ... nor is there any single power of the soul, which remains unalterably the same, perhaps for one moment. – Our impressions give rise to their correspondent ideas; and these ideas in their turn produce other impressions. One thought chaces another, and draws after it a third, by which it is expell'd in its turn.« Der Kern aber dieser völlig übereinstimmigen Darlegung ist in die Worte gefaßt: »The identity, which we ascribe to the mind of man, is only a fictitious one, and of a like kind with that which we ascribe to vegetables and animal bodies. It cannot, therefore, have a different origin, but must proceed from a like operation of the imagination upon like objects«, vol. I, p. 540 der Londoner Ausgabe von 1874. Wie KANT hier zusteht, ist in der Anm. 1007 gezeigt. Überall ist da, geradeso wie in dem oben von Khemako gegebenen Gleichnisse der Lotusrose, nach der Art wie wir eben die Dinge sehn und benennen, ein Verhältnis zu merken, das man in gewaltiger Analogie gewahren kann, wenn man etwa den St. Gotthard zum Gegenstand nimmt. Denn auch der macht wohl einen Gesamtbegriff aus, ist aber an sich selbst nicht zu sehn, nur in der Vereinigung einer Reihe von fünf oder sechs einzeln bestandenen Gipfeln: keiner von diesen ist der Gotthard, alle zusammen sind sie es. – Manche Naturforscher unserer Tage, die von der Möglichkeit jener feinen erkenntniskritischen Ergebnisse der Beobachtung keine Ahnung haben, aber doch gelegentlich gern mit der verpönten Philosophie liebäugeln, glauben, arglos wie sie sind, die ihnen so kostbar bedünkende »Unsterblichkeit der Seele« noch immer retten zu können, wenn sie sie in das Protoplasma oder die Keimzelle glücklich hineinkapseln, und sind so wieder in die »punctalitas« geraten, von der RAYMUNDUS LULLIUS spricht: Est autem punctus ens, cuius esse est indivisibile, De auditu Kabbalistico III 1; genau wie in der Scholastik der Vai eṣikās: Das unteilbare punctum saliens ist ein Atom, niravayavaḥ kriyāvān paramāṇuḥ, Saptapadārthī, ed. WINTER, Leipzig 1893, Nr. 17 3. Es ist also nur der alte rohe Seelenbegriffsquark in moderner Verpackung, mit der Fabrikmarke »Es kann dir nix g'schehn«. Der Hoffnung auf so eine Urschleimunsterblichkeit würde sich schon jeder, der für sein Vaterland ficht, in den Grund seines Herzens schämen, wenn er sich Knochen und Hirn im Shrapnelregen zersplittern läßt: denn das tut er für den inneren Orgelklang; nämlich für jenes immer wieder sich gestaltende »Ich bin«, das die Lebenserscheinung zu wirklich unsterblichen Gipfeln geleitet. [785] Vom naturwissenschaftlichen Standpunkt aus ist das heute schon eindringlich geprüft worden von VERWORN, dessen Arbeiten geradezu eine Demonstration des paṭiccasamuppādo, unserer »Bedingten Entstehung«, darstellen, und der da selbständig herausgefunden und als Lehrbegriff aufgestellt hat den »Satz vom Bedingtsein alles Seins und Geschehens« und den »Satz von der Pluralität der Bedingungen« und deren summarische Gleichwertigkeit dargetan hat. »Wir müssen uns also begnügen«, sagt dieser vorzügliche Lebenskenner am Ende eines auch weiteren Kreisen zugänglichen Vortrags, »unsere Unsterblichkeit darin zu suchen, daß wir gute Werke und wertvolle Anregungen aus den Tagen unserer Gehirntätigkeit hinterlassen. Um aber dieser Art von Unsterblichkeit teilhaftig zu werden, ist auch der Geringste nicht zu unbedeutend, denn nichts geht verloren und bleibt ohne Einfluß auf das kommende Geschehen in dem unendlichen konditionalen Zusammenhang der Dinge.« Kausale und konditionale Weltanschauung, Jena 1912, S. 34.
767 Siehe die 15. Rede S. 229 und Anm. 357 dazu, auch S. 259. – Der Begriff »schön«, subham, geht allmählich, auf Grundlage der vier Schauungen, in die vollkommene Reine, pārisuddhi, über, in jene Lauterkeit wo alles Trübende, Widerwärtige restlos verschwunden ist: daher der Ausdruck »Freiung der Schönheit«, d.h. frei werden durch das Mittel des Schönen, den subho vimokho. Die von manchen Asketen und Priestern, wie es oben heißt, fälschlich vorgebrachte Aussage, daß man beim Schönen zugleich auch das Unschöne gegenwärtig habe, war also von Gotamo unzweideutig berichtigt worden. Diese Art Darstellung eines immer höheren, immer reiner befriedigenden Ergebnisses – oben nur angedeutet – ist bekanntlich eines der auszeichnenden Merkmale der Lehre Gotamos. Man kann es durchgängig beobachten, namentlich bei den Reden der Mittleren Sammlung. Das klassische, beste Beispiel hierfür ist aber wohl die zweite Rede unserer Sammlung, das Gespräch mit König Ajātasattu, ganz ohne Mühe verständlich. Nicht so leicht, nur vertrauten Jüngern zugänglich, sind die mancherlei Stempel, in die Gotamo ein gleiches kurz einbefaßt, wie z.B. »Auf eines gestützt ein anderes abstoßen«, Mittlere Sammlung 1004, und viele ähnliche Aussprüche, insbesondere vortrefflich in den Bruchstücken der Reden oft zu finden. Der Art ist auch die Angabe im Khajjaniyavaggo des Saṉyuttakanikāyo, ed. Siam. III 79 (PTS 89), über den heiligen Jünger, der sich von Form, Gefühl, Wahrnehmung, Unterscheidung, Bewußtsein nicht mehr verzehren lassen mag, auf das vergangene nicht zurückblickt, vom künftigen sich nichts erwartet und des gegenwärtigen überdrüssig, entwöhnt, es zur Auflösung bringt, als etwas vergängliches, leidiges, wandelbares, das ihn nichts angeht, ihm nicht zu- und nicht angehört: »den heißt man«, sagt nun Gotamo kurz zusammenfassend, »einen heiligen Jünger, der abschichtet, nicht aufschichtet, der wegzieht, nicht anhangt, der abwickelt, nicht aufwickelt, der abräumt, nicht zuräumt.« Denn hat der Jünger an der Form, am Gefühl, an der Wahrnehmung, an den Unterscheidungen, am Bewußtsein keine Freude mehr, sich dessen entwöhnen, es auflösen gelernt, ohne anzuhangen sich davon befreit, so darf man wohl von ihm sagen: diṭṭhadhammanibbānappatto bhikkhu, »ein Mönch, der bei Lebzeiten die Erlöschung erreicht hat«, ib. III 147 (164). Solche knappe Merksprüche beziehn sich da immer zugleich auf den subho vimokho, das Freiwerden durch Sauberkeit, Schönheit, nämlich als eine – dem sokratischen Eros verwandte – von Stufe zu Stufe, von Warte zu Warte sich abklärende Lauterkeit, eben als Mittel zur Wahnerlöschung: und dies noch bei Lebzeiten, diṭṭhe 'va dhamme, prachtvoll gemäß der Wendung εμευ ζωντος και επι χϑονι δερκομενοιο; auf der hohen See des Schönen dahingezogen, επι το πολυ πελαγος τετραμμενος του καλου, nach dem Worte der [786] DIOTIMA im Symposion p. 210. PLOTIN hat diese Hauptlehre seines Meisters in den einen köstlichen Satz gefaßt: τοις πραττουσιν ἡ ϑεωρια τελος, den Schaffenden ist das Anschauen Ziel, 3. Enneas, Buch 8, Kap. 8, fol. 347 D der Basler Ausgabe von 1580. Es sind, wie man weiter vermuten darf, die Schaffenden, die das Zeichen des NOSTRADAMUS begehren, entdecken, beschauen: wie alles sich zum Ganzen webt, eins in dem andern wirkt und lebt. Sie verstehn das Wie und Warum aus zwei Sprüchen dazu: »Angedenken an das Schöne | Ist das Heil der Erdensöhne«, und »Angedenken an das Eine | Bleibt das Beste, was ich meine.« – In vedischer Zeit war von einem gewissen hochmächtigen Brahmā, von Sanatkumāras, dem Ewigen Jüngling, eine Weihestimmung der Art dem göttlichen Seher Nāradas erklärt worden, gegen Ende der Chāndogyopaniṣat, VII 6: »Die Schauung, ja, die ist mehr als der Geist. Es schaut gleichsam die Erde, es schaut gleichsam der Luftkreis, es schaut gleichsam der Himmel, es schauen gleichsam die Wasser, es schauen gleichsam die Berge, es schauen gleichsam Götter und Menschen. Die also da unter den Menschen zur Größe gelangen, der Schauung eben werden sie gleichsam mit teilhaftig. Aber die Kleinlichen, die zänkisch sind, hinterrücks reden, das sind die Tadelsüchtigen. Aber die Mächtigen, der Schauung eben werden sie gleichsam mit teilhaftig« (dhyānāpādāṃ ā ivaiva te bhavanti). Was hier der Ewige Jüngling oder JEAN PAUL der Upanischad erheiternd andeutet, ist es nicht auch von dem Bruder, der den selben Namen als Childe Harold unsterblich verklärt, auf seiner Wanderschaft III 74f. gezeigt worden,
The bodiless thought? the Spirit of each spot?
Of which, even now, I share at times the immortal lot?
Are not the mountains, waves, and skies, a part
Of me and of my soul, as I of them?
Im Orden Gotamos nun haben jene schauenden Vorübungen, die genau so in der Mittleren Sammlung 943-944 gezeigt werden, immer nur, wie oben gesagt wurde, den Zweck auf dem kürzesten Wege den Geist zu sammeln und zu einigen: die Gedankenwellen abzuwiegeln, auszugleichen, nach und nach in die Ebbe der inneren Meeresstille übergehn zu lassen. Es ist eine wohlerprobte Praxis zur Verwirklichung der Imago piae simplicitatis, des Abbilds der getreuen Einfalt, wie es FRANZ VON ASSISI wundervoll genannt hat, zur Sonderung von aller Zweiheit, wie es Meister ECKHART erklärt: Anwendung und Ausbildung der stärksten Kräfte des Menschen, die auch von unseren anderen großen abendländischen Asketen je und je mehr oder minder klar erkannt und durchgeübt wurde. So sagt denn z.B. der heilige BERNHARD von Monte Cassino in seinem Speculum monachorum: Impossibile est hominem fideliter figere in uno animum suum, qui non prius in aliquo loco perseveranter affixerit corpus suum, I 1, 1, 2. Positiv: »Sitze in deiner Zelle, die soll dich alle Dinge lehren«, ein Rat des Abbas MOYSES aus dem Altväterbuch der Anachoreten, von SEUSE weiterempfohlen im 35. Abschnitt seiner Lebensbeschreibung. Und ebenso gehört der Gedanke PASCALS hierher: »j'ai souvent dit que tout le malheur des hommes vient de ne savoir pas se tenir en repos dans une chambre.« Vollwertig aber kann man diese Erkenntnis mit dem Stempel des DIEGO DE CASTRO besiegeln:
La vida que jamas dexa
Sin quexa quien mas la quiere,
El que mas lexos se alexa,
No vive, mas nunca muere.
[787] Das Leben, das da nie vergeht,
Von Leiden lauter, findet noch
Wer allentfremdet ferne steht:
Nicht lebt er, ist unsterblich doch.
768 Vergl. die neunte Rede S. 133 nebst den zahlreichen Nachweisen in der Anm. 217.
769 Der Bhaggaver, das ist der vom ṛgvedischen Seher Bhagu, Bhṛgus abstammt, ihm als seinem geistigen Ahnherrn zugehört. Sein Andenken ist sichtbar verkörpert als der Abendstern, daher denn auch unter diesem Planeten Geborene Bhaggaver, Bhārgavās, heißen: schon zur Brāhmaṇazeit, im atapatha-, Aitareyam etc., und der an diese sich anschließenden buddhistischen Kultur. So ein Name bewahrt uns in der Tat ein bedeutsames Kennzeichen für das Alter unserer Texte und deren vorzügliche Überlieferung. Mit Recht hat HILKA auf diesen Umstand ausführlich hingewiesen, in seinen Altindischen Personennamen, Breslau 1910, S. 34, wo er auf Grundlage der Untersuchungen BURNOUFS zeigt, daß die am meisten gebräuchlichen Namen aus der gotamidischen Zeit den vedischen vollkommen entsprechen, ganz verschieden noch von der späteren Namengebung in Smṛti und Purāṇam, wo die theophoren Namen vorwiegen. Auch daraus ergibt sich also, daß unsere Texte die landestümliche Kultur zur Zeit Gotamos treu abspiegeln, ja daß sich uns eben gerade durch diese Art von Namen, wie HILKA nach BÜHLER, Epigraphia Indica II 95, bemerkt, ein chronologischer Anhaltspunkt enthüllt, der die damals noch allgemein geltenden Sitten und Regeln nach Gārhyam und rautam auch hierin bestätigt. Dabei ist die offenbar in eine weit hinaufreichende Vorzeit gegründete Einordnung der Hafner und Töpfer zu den Bhaggavern gesichert, als ein vedischer Name, der nach unseren Texten insbesondere diesem Stande zukam: so Mittlere Sammlung 606 und Anm. 183, am schönsten ib. 1023. – Die Ausarbeitung der später immer mehr und mehr kunstreich verschnörkelten Stammbäume ist auch heute noch in Indien in vollem Schwange, und der unwissendste Brāhmane wie der albernste Duodezmahārājā, dvijapa us und kṣitipapa us, Priestervieh und Fürstenvieh, wie der Inder sich kräftig ausdrückt, ist vor allem darauf bedacht, wenigstens seine Abkunft, als über jeden Zweifel erhaben, bis zu einem Gott oder Halbgott und Ganzselbst einzuwurzeln; auf daß es dann, etwa so wie LESSING auf einen adeligen Dummkopf epigraphiert, endlich heißen könne:
Das nenn' ich einen Edelmann!
Sein Ur-Ur-Ur-Ur-Älterahn
War älter Einen Tag als unser aller Ahn.
Und er wird noch von JEAN PAUL in seinem angestammten Rechte bestärkt, der ihm sagt: »Da haben Sie es gewiß leicht über jeden wegzusehn, der nur an Tapferkeit Ihren Ahnen, aber nicht an Ahnen Ihnen gleicht.« Dazu sind auch am Ganges die Genealogen ex professo geschäftig und leisten gern was verlangt wird, wenn man es nämlich mit greifbaren Gründen von nicht allzu minderem Gewicht belegen kann. Dhanaṃ āhuḥ paraṃ dharmam und dhanair niṣkulīnāḥ kulīnā bhavanti hat schon die Smṛti gesagt, als Protogramm zu JUVENAL:
Tu licet a Pico numeres genus, altaque si te
Nomina delectant, omnem Titanida pugnam
Inter maiores ipsumque Promethea ponas:
De quocumque voles proavum tibi sumito libro.
[788] Als Gemeinplatz lakonisch erhärtet im Wort des Simonides, Pericles II 2 Ende:
Opinion 's but a fool, that makes us scan
The outward habit by the inward man.
770 Nigrodho der Pilger wurde schon in unserer achten Rede genannt (S. 125), wo auf die jetzt erst wiedergegebene Unterredung Bezug genommen ist. Der Pilgergarten unter der Vogelfeige war weit außerhalb der Stadt, gegenüber dem Geierkulm gelegen. Die Vogelfeige, Ficus oppositifolia, gehört zur Klasse der Udumbariden oder Doldenfeigen, ihre Früchte werden nur von Krähen und dergleichen Vögeln gegessen; es ist ein ungeheuer mächtiger weit verzweigter Baum. Hier wird er wahrscheinlich auf einem Hügel gestanden sein, an dessen Abhängen der Pilgergarten ringsum sich hinzog, der eben Namen und Kennzeichen nach dem überall sichtbaren Gipfelbaum erhalten hatte. Ähnlich war auch bei dem Dorfe Mangohain, östlich von Rājagaham, eine berühmte Felsengrotte im Gebirge schlechthin Kronbaumgrotte genannt, das ist die Grotte nahe dem Kronbaum auf der Spitze des Berges, in unserer 21. Rede (364) überliefert.
771 divā divassa, mitten am Tage, ist genau gleich mero meridie. Sandhāno der Hausvater war schon am hellen Mittag, bei brennender Sonne, aufgebrochen um beizeiten dahinzugelangen, wo er den ganzen Nachmittag bis gegen Abend in lehrreichen Gesprächen zu verweilen gedachte. Sonst pflegte man nämlich erst gegen Sonnenuntergang, wenn die Hitze nachgelassen, Asketen und Pilger in ihren Hainen und Gärten besuchen zu gehn. Darum ist hier das »noch mitten am Tage«, divā divass' eva, besonders hervorgehoben; und auch so in der Mittleren Sammlung 197, 769. Das gilt natürlich gegenwärtig wie in der alten Zeit, aus welcher es uns HERODOT, gewissenhaft wie er ist, im Bericht über Indien wortgetreu bestätigt: Θερμοτατος δε εστι ὁ ἡλιος τουτοισι τοισι ανϑρωποισι το ἑωϑινον, ου κατα περ τοισι αλλοισι μεσαμβριης, αλλ' ὑπερτειλας μεχρι οὑ αγορης διαλυσιος, III 104.
772 Vergl. Mittlere Sammlung, Anm. 171, ferner unser 1. Stück, S. 8. Oben sind nun hier, nach der siamesischen Fassung, noch Gespräche über Männer, Branntweine, Gasthöfe hinzugezählt, purisakathā, surāpānakathā. Zum letzteren Begriff cf. auch Anm. 294. Jeder von diesen Gegenständen taugt nur zu müßigem Geplauder, ist »Unterhaltung über allerhand gemeine Dinge«, anekavihitā tiracchānakathā; gleichwie es auch eine gemeine Wissenschaft gibt, tiracchānavijjā, wie Opferkult, Sternkunde, Arzeneikunde, Staats- und Hausdienst, Nachrichtendienst, Verwaltung usw., in der ersten Rede S. 8 – 11 in bezug auf den Mönch als »geringwertig, minderwertig« abgelehnt. Diese Einschätzung der weltlichen Wissenschaft von einem höheren Standpunkt aus haben auch griechische und römische Denker zu billigen verstanden. Zumal APULEIUS spricht darüber sehr bemerkenswert, im 1. Kapitel der Florida, geradezu als ob er sich auf jene 1. Rede unserer Sammlung bezöge. Unter den Indern, sagt er, gibt es »einen hochangesehnen Stand, es sind die Gymnosophisten. Die bewundere ich am meisten. Denn das sind erfahrene Männer: nicht im Pflanzen von Weinreben, nicht im Pfropfen von Bäumen, nicht im Pflügen der Ackerscholle. Sie verstehn nicht das Land zu bestellen, oder Gold auszuquellen, oder Rosse zu bändigen, oder Stiere einzujochen, oder Schafe und Ziegen zu scheren und zu weiden. Was denn also? Eins statt all dem verstehn sie: die Weisheit durchzupflegen, als alte Meister sowie als junge Schüler. Und nichts anderes wird bei ihnen gleich hochgeschätzt, weil sie eben geistige Trägheit und Müßiggang verabscheuen«. Opera omnia ed. ELMENHORST p. 343. Obzwar nun der Ausdruck Gymnosophisten nur ein Sammelname war für die [789] verschiedenen Arten der unbekleideten Büßer und dann für die indischen Asketen im allgemeinen, so tritt hier, durch des APULEIUS vorzügliche Definition, die eigentlich tiefere Bedeutung, der verborgene Sinn der griechischen Wiedergabe ganz von selbst mit hervor: es sind die bloßen Weisen gemeint, die Nurweisen, die sonst nichts sind. Denn γυμνος war ja schon seit HOMER sowohl eigentlich als auch übertragen zu verstehn, im Sinne von einer Sache entblößt sein, ledig, ohne sie sein, daher z.B. AISCHYLOS in den Persern 993 sagt: γυμνος ειμι προπομπων, ich bin ohne begleitung; vergl. noch weiterhin SUIDAS s.v. ελαχεια Reichtum, Besitz ist αλλοτριον, was uns nicht angehört, wir haben uns dessen zu begeben, zu entfremden, besser nackt zu werden, γυμνοι ε μαλλον. So habe Christus gelehrt und das irdische Gut ελαχιστον genannt, das schlechteste. Damit sind wir im Kreis herum zur Bloßheit, Armut, Lauterkeit gelangt und wieder zur indischen ūnyatā, suññatā hinauf, zur Leerheit von allen weltlichen Dingen und Künsten. Die Nurweisen also, die sonst nichts sind, das sind die von APULEIUS gemeinten Gymnosophisten, wie eben er sie recht gekennzeichnet hat: und die mögen sich denn freilich von der geselligen Salbaderei fernhalten und wie bei uns oben im Text ein Urteil anwenden, das EPIKTET wiederholt: nur das Nötige soll man sagen und kurz, aber nicht reden über abgedroschene und gemeine Dinge, als wie über Gladiatoren und Wettrennen oder Ringkämpfe, über Speise und Trank usw., worüber man die Leute den ganzen Tag sich erzählen hört, nach ARRIANS Encheiridion Mitte. Und wieder auf andere Weise kommt Sankt BERNHARD unserem Text und Typus sehr nahe; solche Gespräche und Gedanken, sagt er, sind des Menschen distentoriae cogitationes: quando de longinquis rebus et regnis et regionibus disponit et tractat, quando distenditur in quaestionibus et rationibus huius mundi: De conscientia, ed. Par. 1621 fol. 1110 E.
Zum Begriff tiracchāno cf. Bruchstücke der Reden Anm. 880. Das Wort bedeutet zunächst so viel als seitwärts gewichen, in die Quere geraten, herabgekommen sein, und daher ist es dann ein umfassender Ausdruck für »niedrig, gemein, gewöhnlich« geworden. Keinesfalls aber gilt tiracchānagato, allein gebraucht, als Tier: soll das gesagt werden, dann wird ausdrücklich noch pāṇo Tier hinzugefügt, wie z.B. Saṉyuttakanikāyo III 85, V 227 oder Aṉguttaranikāyo IV No. 33, und an all den Orten, wo die tiracchānagatā pāṇā, die gewöhnlichen Tiere (des Waldes usw.), gegenüber dem sīho migarājā, dem Löwen, dem König des Wildes, in Furcht und Schrecken geraten (eine berühmte Prachtstelle, nebenbei bemerkt, die im Pantagruel, der manches Indische bringt, wortgetreu wiederkehrt, IV 57 Mitte: »au rugissement du lion toutes bestes loing a l'entour fremissent«). Dabei hat nun tiracchānagato die Geltung »wie Tiere, viehisch« bekommen, ähnlich wie pa uḥ Vieh auch, wie wir sagen, einen Viechskerl bedeutet, noch bei Bhatṛharis I 20, vergl. HERTELS Anm. zu Hitopade as I v. 62, und puruṣapa uḥ im Tantrākhyāyikam I v. 12, Pañcatantram 15, nb schon Chāndogyopaniṣat II 6 und den typischen Ausdruck unserer Texte über das Menschentier, purisadammo, z.B. Mittlere Sammlung S. 1009f. = το ϑρεμμα ανϑρωπος PLATONS, De leg. 777, daher denn JEAN PAUL im Jubelsenior über »die Menschentiere« spricht und über »das platonische eiserne Vieh seiner eignen Triebe«, 1. Bericht; oder wie ζωωδης auch für pöbelhaft gebraucht war, oder homo brutus, ein Klotz, ein rüder Geselle. Demgemäß heißt natürlich tiracchānagatā ein gemeines Weib, eine Dirne, in der bekannten Regel bei der Aufnahme des Mönchs: »Der aufgenommene Mönch darf keiner Paarung pflegen, auch nicht einmal mit einer Dirne«, Kammavākyam ed. SPIEGEL p. 9, Upasampadākammavācā ed. DICKSON p. 3. OLDENBERG meint zwar, trotzdem hier ein Zweifel seit langem schon unmöglich ist, an der kasuistischen Deutung festhalten zu müssen, nach [790] der hier ein wirkliches Tier zu verstehn sei, »Buddha« 6. Aufl., S. 398. Nun hat der Mensch allerdings mit dem Vieh brutale Notdurft gemein: aber deshalb darf man das Mensch, als ein Mittel zum Zweck, doch nicht quasiteleologisch als Tier erklären oder gar eine sodomitische Buhlschaft auslegen wollen; wenn auch die indischen Pfaffen mit den Liguorianern usw. blöde zusammentreffen, im bockfüßigen Quidproquo. Nur im Sinne der naturwissenschaftlichen Eingliederung und der staatsbürgerlichen Einrichtung darf man vom gemeinen Menschen als von einem Herdentier und einem Gewohnheitstier sprechen, und da gewiß mit Fug und Recht; man darf sogar mit DANTE sagen: »uomo non già, ma bestia ch'uom somiglia«, nach der hier sich anschließenden Begriffsentwicklung vom gemeinen Gesetz und dem gewöhnlichen Menschen, puthujjano, der den Schein des Himmelslichts Vernunft nennt,
und braucht's allein,
Nur tierischer als jedes Tier zu sein.
Also, nach MERSWINS Kunde, das meiste Teil der Menschen: und »will ich dir sagen' daß die alte gute Gewohnheit ist worden zu einer Mistlachen«, Neun Felsen S. 23 und 51; ganz wie GRACIAN die Söhne dieser Zeit, los hijos deste siglo, Bastarde der Ewigkeit nennt, bastardos del eterno: sie verachten den Heiligenschrein und schätzen den Mullhaufen der Welt, desprecian el tesoro del altar y estiman el muladar del mundo, Comulgatorio, XXX. Medit. No. 2. Die Grenzen dieses Weltbegriffs der Gemeinheit sind der gotamidischen Anschauung gemäß in der Anm. 976 gezeigt. Vergl. auch Mittlere Sammlung 848 nebst Anm. 365 die oft wiederholte Stelle gāmadhammo, country matters. – Der Ausdruck tiracchānagatā für eine Venus vulgivaga ist aber insbesondere noch durch die Parallele in der Mittleren Sammlung S. 862 bestätigt, wo genau mit den selben Worten der Verkehr mit Dirnen bis herab zu der blumengeschmückten Tänzerin (= Tempelbayadere, gaṇikādi) abgelehnt wird. Einen weiteren Beleg bietet die 8. Strophe unserer 31. Rede, wo von Spielern und Trinkern gesagt wird, daß sie den Frauen anderer nachstellen, sie gehn den »Weibern nach, wie Tiere, gleichviel welchen«, yant' itthiyo pāṇasamā paresam, Umgang haben wie das Vieh, nicht mit dem Vieh. Es ist also da überall die Rede von herabgekommenen, in die Quere geratenen oder tiefstehenden Leuten, tiracchānagatā: wie eben auch bei uns oben im Text nicht etwa eine Unterhaltung über allerhand Tiere sondern über allerhand gemeine Dinge, tiracchānakathā, gepflegt wird; und ebenso die tiracchānavijjā in unserer ersten Rede, 9-11, durchaus nicht den Anspruch macht als ein Zoologie zu gelten, vielmehr als mancherlei gemeine und gemeinnützige Wissenschaft sich zu erkennen gibt. Dieses Verhältnis ist bis auf unsere Zeit recht bekannt geblieben. Als ich einmal vor Jahren mit dem damaligen Gesandten von Siam in Berlin am Reichstag vorbeifuhr, deutete der edle alte Herr, mit der Tradition der buddhistischen Texte wohlvertraut, leicht abwehrend nach dem stolzen Gebäude hin und sagte lächelnd nur das Wort: tiracchānakathā, Gemeingerede. Er hatte, obzwar als ein vortrefflicher Diplomat amtlich dazu berufen, die Gespräche und Verhandlungen »über Fürsten und Soldaten, über Krieg und Kampf, über Speise und Trank« usw. usw. mit dem einen Schlagwort von einer höheren Warte aus auch ihm als minderwertig bezeichnen wollen.
773 Mit S richtig tucchakumbhiṃ va naṃ maññe orodheyyāma. Wiederholt im Aṉguttaram und Saṃyuttam behandelt, z.B. I 130, II 104 und V 20f. Auf ähnliche Weise, mit noch ausführlicheren Kampfrednergleichnissen, spricht sich Saccako vor den Licchavier Fürsten von Vesālī aus, in der 35. Rede der Mittleren Sammlung. Auch in den Bruchstücken der Reden wird das Bild angewandt: aḍḍhakumbhūpamo bālo, halbleerem [791] Kruge gleicht der Tor, v. 721. Es ist eine beliebte Metapher gewesen, die dann Kālidāsas so gefaßt hat, im Wolkenboten v. 20:
Riktaḥ sarvo bhavati hi laghuḥ, pūrṇatā gauravāya:
Als leer zeigt jeder Leichte ja sich an: gewichtig sein ist Fülle.
774 Die Sumāgadhī, heute Bāṉgaṉgā genannt, fließt weithin durch das Tal, am Fuße des Geierkulms vorbei. Ihr Lauf durch die blühenden Auen, an fünf größeren Felsenkuppen sich sanft dahinschlängelnd, ist von altersher wegen seiner Anmut berühmt: inmitten der fünf zackigen Gipfel leuchtet sie wie ein Blumengewinde, die erquickend rauschende Sumāgadhī, sagt Vi vāmitras der vedische Seher von ihr, im Rāmāyaṇam I 34 9. Der Pfauenhügel, einer der kleineren Berge am Ufersaum, war dem Pilgergarten unter der Vogelfeige vorgelagert. Dieser Ort wird bei uns noch ein paarmal erwähnt, so Mittlere Sammlung 562, 585, auch ein- oder zweimal im Aṉguttaranikāyo (vergl. Pfauenberg, wie einst Bamberg hieß), sehr häufig jedoch der mehr abseits in der Nähe gelegene Hügel der Eichhörnchen, im Bambuspark, wo Gotamo nicht selten zu verweilen pflegte. Ein sorgsam ausgearbeitetes Bild der ganzen Landschaft um Rājagaham mit den meisten der genannten Orte und noch anderen hat General CUNNINGHAM im ersten Bande des Archaeological Survey of India veröffentlicht, in der Anm. 645 genauer besprochen; vergl. auch Anm. 629. – Eine hübsche Photographie einer ähnlichen Flußlandschaft gibt Mrs. RHYS DAVIDS in ihren Psalms of the Early Buddhists, Part. I, London 1909, zu Seite 134: eine Ansicht der alten Burgstadt Gayā am Gestade der breit dahinströmenden Nerañjarā, rechts und links von zahlreichen badenden Pilgern belebt, fern am Horizont sanfte bewaldete Hügel, hinter den Palästen, Tempeldomen, schattigen Gärten. Man sieht da ganz gut, daß derartige Gegenden ungefähr die gleichen Merkmale aufweisen wie an unseren mittleren Flußläufen, etwa an Main oder Mosel. Ich habe auf die Übereinstimmung des allgemeinen Landschaftcharakters jener Gegenden mit den mitteleuropäischen, bei auffallend zurücktretender Tropenvegetation, vor Jahrzehnten schon hingewiesen. Mittlere Sammlung Anm. 21; und neuerdings hat auch OLDENBERG die denkwürdigen Stätten besucht und zutreffend skizziert, »Buddha« 6. Aufl. S. 125. Die von mir bemerkte Gleichartigkeit hat er zwar nicht wahrgenommen, sein »Eindruck ist ein durchaus anderer«, wie er sagt: das kommt aber daher, daß man Landschaften, wie solche es sind, nicht im Winter besuchen soll, da wird der Eindruck manchmal recht verschieden sein: denn die kalte, wasserarme Jahreszeit ist wohl dem raschen Touristen angenehm aber nichts weniger als günstig für vergleichende Beobachtungen. Damit hängt auch die freundlich erteilte Belehrung zusammen: »besser wäre zu sagen, der subtropischen Vegetation«; da mir nämlich der Mangel an Palmen und Lianen aufgefallen war, durfte ich nur richtig von einem Zurücktreten der Tropenvegetation reden. OLDENBERG freilich konnte den wohlmeinenden Zeigefinger des Oberlehrers, mit dem er dies und das und weit wichtigere Dinge zu behandeln gewohnt ist, auch hiervon nicht abwenden.
775 Nigrodho spricht hier offenbar nach was er gehört hat: so nämlich wie die gotamidischen Jünger selbst ihre Satzung gekennzeichnet haben. Vergl. 19. Rede S. 335. – Im Folgenden tuṇhī ahesuṃ mit S etc. – Die Art und Weise wie Nigrodho die Versammelten ermahnt und ihre Anteilnahme zu erregen sucht, entspricht übrigens nach Begriff und Gehalt ganz rein dem vergilischen Ausdruck, bei der Ankunft und Begrüßung des Aeneas, VT 487f.:
[792] Nec vidisse semel satis est; iuvat usque morari
Et conferre gradum et veniendi discere caussas.
776 Was der Büßer schon als letzte Vollkommenheit betrachtet, erkennt Gotamo als immer noch unzulänglich, im Gegensatz zur allgemeinen Meinung der Zeit. Aus einem Gespräch mit Saḷho, einem Edlen aus dem Geschlechte der Licchavier von Vesālī, wird das richtige Verhältnis von Büßertum und Asketentum sehr leicht verständlich. Als Gotamo einst bei Vesālī Rast hält, im Großen Walde, in der Halle der Einsiedelei, kommt Saḷho mit noch einem anderen Fürsten heran, den Meister zu begrüßen, und stellt dann die Frage: »Es gibt, o Herr, manche Asketen und Priester, die zwiefach ein Entrinnen aus dem Flutbereich angeben, durch geläuterte Tugend und durch Buße und Abscheu. Was sagt nun, o Herr, der Erhabene dazu?« – »Geläuterte Tugend nenne ich, Saḷho, eins der Erfordernisse zum Asketentum. Die da, Saḷho, als Asketen und Priester behaupten, Buße und Abscheu sei erforderlich, Buße und Abscheu als Inbegriff angeben, an Buße und Abscheu kleben bleiben, die sind nicht imstande aus dem Flutbereich zu entrinnen. Die aber da, Saḷho, als Asketen und Priester in Werken, Worten und Gedanken nicht lauter geworden sind, ihr Leben nicht geläutert haben, die können keine Wissensklarheit erwerben, nicht zur höchsten Erwachung vordringen. Es ist als ob etwa, Saḷho, ein Mann einen Fluß übersetzen wollte. Mit einem scharfen Beile versehn ginge er in den Wald. Dort erblickte er einen großen schlanken Kronbaum, gerade gewachsen, jung, nicht eckig verästelt. Diesen Baum fällte er an der Wurzel, dann schnitte er die Wipfel ab und entfernte sorgfältig Laub und Zweige. Hierauf spaltete er ihn mit Beilhieben, schlichtete ihn zurecht, hobelte ihn ab, räucherte ihn auf Kieselstein: und nun wollte er über den Fluß hinwegsetzen. Was meinst du wohl, Saḷho: wäre da etwa der Mann imstande über den Fluß hinwegzukommen?« – »Gewiß nicht, o Herr.« – »Und warum nicht?« – »Jener Kronstamm, o Herr, wäre zwar außen vollständig bearbeitet worden, aber innen nicht ausgetrocknet. So wäre denn vorauszusehn: der Kronstamm wird mit dem Manne versinken und untergehn.« – »Ebenso nun auch, Saḷho, ist es mit den Asketen und Priestern, die da behaupten, Buße und Abscheu sei erforderlich, die Buße und Abscheu als Inbegriff angeben, an Buße und Abscheu kleben bleiben: sie sind nicht imstande aus dem Flutbereich zu entrinnen. Die aber da, Saḷho, als Asketen und Priester in Werken, Worten und Gedanken nicht lauter geworden sind, ihr Leben nicht geläutert haben, die können keine Wissensklarheit erwerben, nicht zur höchsten Erwachung vordringen. Wenn es nun dagegen, Saḷho, Asketen und Priester gibt, die nicht Buße und Abscheu als erforderlich ansehn, Buße und Abscheu nicht als Inbegriff angeben, an Buße und Abscheu nicht kleben bleiben, so sind sie imstande aus dem Flutbereich zu entrinnen. Und wenn es, Saḷho, Asketen und Priester gibt, die in Werken, Worten und Gedanken lauter geworden sind, ihr Leben geläutert haben, so können sie die Wissensklarheit erwerben, zur höchsten Erwachung vordringen. Es ist als ob etwa, Saḷho, ein Mann einen Fluß übersetzen wollte. Mit einem scharfen Beile versehn ginge er in den Wald. Dort erblickte er einen großen schlanken Kronbaum, gerade gewachsen, jung, nicht eckig verästelt. Diesen Baum fällte er an der Wurzel, dann schnitte er die Wipfel ab und entfernte sorgfältig Laub und Zweige. Hierauf spaltete er ihn mit Beilhieben, schlichtete ihn zurecht, feilte mit einer Säge nach innen säuberlich ab, behobelte ihn, räucherte ihn auf Kieselstein. Dann baute er den Kahn, befestigte Pinne und Ruder daran, und nun suchte er über den Fluß hinwegzusetzen. Was meinst du wohl, Saḷho: wäre da etwa der Mann imstande über den Fluß hinwegzukommen?«[793] – »Gewiß, o Herr.« – »Und warum das?« – »Jener Kronstamm, o Herr, wäre ja außen vollständig bearbeitet worden und innen richtig ausgetrocknet, ein Kahn wäre gebaut und Pinne und Ruder daran befestigt worden. So wäre denn vorauszusehn: der Kahn wird nicht versinken, der Mann wird heil an das andere Ufer gelangen.« – »Ebenso nun auch, Saḷho, ist es mit den Asketen und Priestern, die da nicht Buße und Abscheu als erforderlich ansehn, Buße und Abscheu nicht als Inbegriff angeben, an Buße und Abscheu nicht kleben bleiben: sie sind imstande aus dem Flutbereich zu entrinnen. Die aber da, Saḷho, als Asketen und Priester in Werken, Worten und Gedanken lauter geworden sind, ihr Leben geläutert haben, die können die Wissensklarheit erwerben, zur höchsten Erwachung vordringen.« Aṉguttaranikāyo, Catukkanipāto No. 196, ed. Siam., p. 279-282. Auch den Inbegriff der vedischen Büßerschaft, obzwar rein gehalten von der Verwilderung der Nackten Büßer, Freien Brüder usw., wie sie die vorangehende Rede zeigt, hatte der Denker, der das vollkommen geklärte Asketentum darlegte, doch nur aus feuchtem Splint, nicht aus Kernholz bestanden erkannt. Denn Gotamo hatte ja selbst, während der ersten sechs Jahre seiner Pilgerschaft, die gesamte harte Büßerpraxis bis zur letzten Vollendung durchgemacht, ohne durch die bitteren Kasteiungen das »Heiltum der Wissensklarheit« erringen zu können. Über diesen Lebensabschnitt wird in der 36. und 85., insbesondere aber in der 4. und 12. Rede der Mittleren Sammlung vom Meister ausführlich Bericht erstattet. Ganz einsam, in einem grauenvollen Walde hatte er endlich geweilt, in einer gräßlichen Wildnis, wo solches Entsetzen herrschte, daß jedem ungeheiligten Wanderer alsbald die Haare sich sträubten. Und Gotamo ließ Jahre hindurch Schmutz und Staub am Körper sich ansammeln, bis zum Herabfallen, wie sich die Staubschicht an einem Baumstumpf von Jahr zu Jahr verdichtet. Er hielt sich während der kalten Nächte im Winter nachts in einer Lichtung auf und tagüber im Dickicht; im Sommer aber, zur Zeit der größten Hitze, tagüber in einer Lichtung und nachts im Dickicht. Da ist ihm, in so furchtbarer Buße, dieser Spruch aufgegangen, Mittlere Sammlung, S. 90:
Im Sommerbrand, im Wintersturm
Allein im wilden Schreckensforst
Sinnt ohne Feuer, ohne Herd
Ein nackter Dulder selbstvertieft.
Ein Spruch, der nüchtern und ungeschmückt jenes vedische Bußideal veranschaulicht, das voller Bilderreiz in der akuntalā VII v. 11 verherrlicht ist, wie bei den Anachoreten der Thebaïs dort ein büßendes Gewinnen in die Ewigkeiten steigert:
Versunken halb am Hügel der Termitenbrut,
Die Brust beschuppt von Schlangen,
Den Hals in welke Ranken aus Lianenflut
Verflochten, rings verhangen,
Das Haar, verbrämt mit Vogelnestern fort und fort,
Umflockt ihn bis zum Leibe,
Unregbar wie ein Baumstumpf blickt der Seher dort
Empor zur Sonnenscheibe.
Wiederholt im Raghuvaṃ am XI 13, Kumārasaṃbhavam III 17: Sthāṇuṃ tapasyantam adhitya, etc. Baumstumpf, sthāṇuḥ, war da längst schon Name und Rang, der Ehrentitel für solch einen Büßerfürsten geworden, nach dem Vorbild im Bhāratam, Rāmāyaṇam, Bhāgavatapurāṇam usw.: āste sthāṇur ivācalaḥ, er »bleibt wie ein Baumstumpf unregbar«: [794] also wörtlich genau von Kālidāsas in jener Strophe nach der alten Überlieferung angeführt. Vergl. noch Lieder der Mönche v. 62; auch den Zottigen Einsiedler, ke ī usw., den die Ṛkṣamhitā in ihrem Wanderers Sturmlied, X 136, als das Urbild gezeigt hat. Erst nachdem Gotamo den so hoch gepriesenen Weg der vedischen Meister als Abweg erkannt hatte, war er dann über die fruchtlos, ja verderblich erprobte Selbstqual hinweggekommen.
Eine eingehende Darlegung dessen, was Gotamo eigentlich als Buße, als läuternde Übung des Jüngers verstanden hat, ist im Aṉguttaranikāyo erhalten, Tikanipāto No. 102/3 (PTS 100), ed. Siam. p. 329-336. Die Buße des Mönchs ist eine Läuterung wie beim Golde. Das Gold hat grobe Schlacken an sich, Mergel und Geröll; hat noch mittlere Schlacken an sich, Kiesel und Sand; hat auch feine Schlacken an sich, Staub und Glimmer. Hat nun der Goldwäscher das Erz in die Kufe gebracht und es gewaschen, abgewaschen, ausgewaschen, von all dem gesäubert, befreit, nach und nach gereinigt, so bleibt nur mehr der Goldsand zurück. Der wird dann vom Goldschmied auf eine Pfanne geschüttet und erhitzt, geröstet, geschmolzen. Aber dieses Gold ist noch nicht aufgetrieben und ausgetrieben, noch nicht sauber, rein von Unrat, es ist noch lange nicht geschmeidig, biegsam, durchleuchtig geworden; es ist spröde und eignet sich nicht zur richtigen Verarbeitung. So nun auch hat der Mönch, der sich mit seinem Geiste beschäftigt, zuerst grobe Schlacken an sich, üblen Wandel in Werken, Worten und Gedanken; hat noch mittlere Schlacken an sich, Erwägungen der Gier, des Hasses, der Wut; hat auch feine Schlacken an sich, etwa Gedanken an seinen früheren Stand, an sein Vaterland, er will nicht mißachtet werden. Von all dem nun weiß der wohlbesonnene Jünger, ein Mönch, der die Dinge zu behandeln versteht, sich zu säubern, zu befreien, zu reinigen, sich nach und nach davon vollständig zu läutern, bis ihm nur mehr die Gedanken an die Lehre übrig geblieben sind. Da kommt es denn zu einer Einigung: aber es ist noch die rechte, stille, beschwichtigende, innig ausgereifte, eine, die noch mit mancherlei Unterscheidung und Unzugehörigkeit versetzt ist. Und der Mönch wird nun dem Goldarbeiter verglichen, der den kostbaren Stoff erst richtig bearbeiten muß, wenn er ihm tauglich werden soll. Der wird nämlich nun erst das Schmelzfeuer anmachen, dann den Schmelztiegel zusetzen, hierauf ein Stück Gold mit der Zange fassen und hineinlegen. Da wird er es von Zeit zu Zeit auftreiben, von Zeit zu Zeit mit Wasser beträufeln, von Zeit zu Zeit in Augenschein nehmen. Wenn der Goldarbeiter das Gold nur immer auftreiben wollte, würde er sicher das Gold verbrennen. Wenn er es immer nur mit Wasser beträufeln wollte, würde er es sicher verdämpfen. Wenn er es immer nur in Augenschein nähme, würde es sicher nicht ganz ausgeglüht werden. Weil nun aber der Goldarbeiter das Gold von Zeit zu Zeit auftreibt, von Zeit zu Zeit mit Wasser beträufelt, von Zeit zu Zeit in Augenschein nimmt, so wird da das Gold geschmeidig, biegsam, durchleuchtig, ist nicht mehr spröde, ganz geeignet zur Verarbeitung. Und zu was für Schmucksachen auch immer er es verwenden will, sei es zu einem Armreifen oder einem Ohrringe, zu einem Halsbande oder einer goldenen Kette, es wird seinem Zweck entsprechen. Ebenso nun auch muß der Mönch, der sich mit seinem Geiste beschäftigt, dreierlei Merkmale von Zeit zu Zeit beobachten. Er wird von Zeit zu Zeit das Merkmal der Einigung beobachten, von Zeit zu Zeit das Merkmal des Fortschreitens beobachten, von Zeit zu Zeit das Merkmal des gleichmütigen Verharrens beobachten. Wenn der Mönch, der sich mit seinem Geiste beschäftigt, immer nur das Merkmal der Einigung beobachten wollte, würde der Geist sicher in Trägheit geraten. Wenn der Mönch, der sich mit seinem Geiste beschäftigt, immer nur das Merkmal des Fortschreitens beobachten [795] wollte, würde der Geist sicher in Stolz geraten. Wenn der Mönch, der sich mit seinem Geiste beschäftigt, immer nur das Merkmal des gleichmütigen Verharrens beobachten wollte, würde der Geist sicher nicht ganz geeignet werden zur Wahnversiegung. Weil nun aber der Mönch, der sich mit seinem Geiste beschäftigt, von Zeit zu Zeit das Merkmal der Einigung beobachtet, von Zeit zu Zeit das Merkmal des Fortschreitens beobachtet, von Zeit zu Zeit das Merkmal des gleichmütigen Verharrens beobachtet, so wird da der Geist geschmeidig, biegsam, durchleuchtig, ist nicht mehr spröde, ganz geeignet zur Wahnversiegung. Und zu was immer für einem durch Erkenntnis erwirkbaren Dinge er den Geist hinlenkt um es durch Erkenntnis zu verwirklichen, überall wird ihm eben da die Verwirklichung möglich, je und je wie er weilt. – Das ist die Buße, die Läuterung, die Gotamo lehrt.
777 Mit S etc. Ayam pi kho Nigrodha tapassino upakkileso hoti. Vedische Nachweise zu all den verschiedenen Bußübungen und peinlichen Regeln, die hier wie oft aufgezählt werden, sind in der Mittleren Sammlung Anm. 275 zu finden. Dazu sei noch die sehr alte Stelle aus dem Sāmavidhānabrāhmaṇam angefügt, III 7, 5: aṣṭame kāle bhuñjānaḥ pāṇibhyāṃ pātrārthaṃ kurvāṇo, d.i. ein Büßer, der immer nur jede achte Mahlzeit einnimmt und auch dabei bloß die Hände zum Gefäß hat, also ohne Almosenschale sich mit dem Hohlmaß der beiden Hände begnügt, »mit zwei handvoll Almosenspeise«, wie es bei uns oben im Text S. 450 entsprechend heißt. Nur die achte Mahlzeit einnehmen ist soviel als vier Tage fasten, da der Inder täglich zweimal, morgens und abends, zu essen pflegt. Weil nun abends die Hauptmahlzeit ist und morgens nur ein kleiner Imbiß genommen wird, erhält ein Pilger, wenn er bis Mittag die Sammelrunde beendet haben muß, auch bei täglichem Almosengang nur das Nötigste zur Lebensfristung. Dies Letztere gilt aber unverbrüchlich so im Orden Gotamos. Der ehrwürdige Udāyī sagt, in der 66. Rede der Mittleren Sammlung, S. 483: »Was für Mahlzeit von den beiden uns als die bessere gilt, die hat uns der Erhabene zu lassen geheißen, die hat uns der Willkommene verleugnen geheißen. Alles wird für den Abend bereitet, wenig für den Tag. Weil wir aber zum Erhabenen Liebe und Zutrauen hegten, schamhaft und demütig waren, so ließen wir davon ab, abends, außer der Zeit, zu essen.« Zur angeführten vedischen Gepflogenheit cf. noch KONOW, Das Sāmavidhānabrāhmaṇa, Halle 1893, S. 40 Anm. 14. Die von Gotamo sehr weise als unpraktisch abgelehnte alte Speiseregel der brāhmanischen Büßer, erst nach Sonnenuntergang zu essen und gelegentlich zwei oder auch vier Tage hindurch ganz zu fasten, ist vom ägyptischen ANTONIOS, dem Gründer der abendländischen Asketik, getreu befolgt worden, wie der Augenzeuge ATHANASIOS berichtet: »Er aß einmal des Tags nach Sonnenuntergang; zuweilen ließ er zwei Tage, oft aber auch vier Tage vorübergehn.« Siehe den Nachweis in Anm. 834.
778 samaṇappavādena, wie man unter Asketen sagt: so z.B. nach Manus VI 17, wo für das Zersägen mit den Zähnen, dantakūṭam, ähnlich dantolūkhalikaḥ gilt, »die Zähne als Mörser gebrauchen«, ein Asket sein, der nur ungemahlene Körner ißt. Auf den Wortlaut dieser Büßerregel, von der auch im Bhāratam und Rāmāyaṇam wiederholt gesprochen wird, ist oben angespielt mit dem Hinweis »wie man unter Asketen sagt.« Der Ausdruck asanivicakkam, zernagen und zerknacken, kommt noch einmal im Saṉyuttakanikāyo vor, wo es im übertragenen Sinne heißt, daß Almosen, Ehre und Ruhm beim kämpfenden Mönche, der nach dem Heile noch ringen muß, darauf hinzielt ihn zu zernagen und zu zerknacken. »Zernagen und Zerknacken: das ist, ihr Mönche, eine Bezeichnung für Almosen, Ehre und Ruhm. So arg ist, ihr Mönche, Almosen, Ehre und Ruhm, ist bitter, ist beißend, hinabzerrend vom Wege zur höchsten Sicherheit. [796] Darum aber hat man, ihr Mönche, sich also zu üben: ›Kommt uns Almosen, Ehre und Ruhm zu, werden wir es lassen, auf daß unser Gemüt davon nicht umschränkt werden kann‹: so habt ihr Mönche euch wohl zu üben.« Siam. Ausg. II 207 (PTS 229, auch mit S anupāpuṇātu). Wenn dann später im Text oben gesagt wird, daß ein Büßer an öffentlichen Plätzen sich niederzulegen pflege, und daß er unschicklich anzusehn unter den Leuten sich zeige, so kann man dergleichen ganz ebenso auch in der Gegenwart bei den gewöhnlichen Büßern beobachten, sogar in großen Städten. In Kalkutta z.B. habe ich sie im Kālighat-Viertel gesehn, mitten im lärmenden Marktgedränge; an Straßenkreuzungen, auf Plätzen, in Nischen, Winkeln sitzen sie mit verschränkten Beinen am Boden oder auf einer Matte oder auf einem Schemel, über den ein Spitzdach gewölbt ist: kahlgeschoren, oder langhaarig und langbärtig, hager und mager wie Lemuren, Gesicht, Arme, Leib mit weißer Asche bestrichen, die Augen starr oder halbgeschlossen, unbeweglich, Figuren wie aus Stein. »Auch das soll mir Buße sein, auch das soll mir Buße sein«, denken sie da ohne Zweifel, heute wie einst; und sind in die Schiefe geraten und an unrechten Ort.
779 Das Gleichnis vom Kernholz, Grünholz, der Rinde, dem Geäst und Laubgezweig ist in der 29. und 30. Rede der Mittleren Sammlung mit aller Ausführlichkeit vorgetragen. Durch die oben dann folgenden Angaben über das vierfach gezügelt sein in fester Zucht wird der bekannte Lehrsatz des Freien Bruders Nāthaputto in das Gespräch einbezogen und alsbald geistig vertieft; siehe S. 42.
780 na bhāvitam āsiṃsati, er hofft auf kein Ereignis, d.h. er glaubt an keine plötzliche Wendung der Dinge zum Besseren, an ein plötzliches Geschehn, das da von außen eintreten würde: denn er weiß, daß alles von innen ausgeht, von innerer Arbeit abhängt. Mit anderen Worten: er ist kein Träumer und Zwecksucher, gehört nicht zu den Schwärmern, die sich mit Flausen von Weltentwicklung und Goldenem Zeitalter oder Weltuntergang und Jüngstem Tag beschäftigen, gehört nicht zu jenen, die alle vergangenen Jahrhunderte nur als Grundlagen und Staffeln zur glücklich erreichten Gegenwart und noch viel herrlicheren Zukunft betrachten; gehört auch nicht zu den immer irgend einen Erlöser oder Übermenschen oder Tausendkünstler Erhoffenden, denen die Denker der Vorzeit gerade gut genug sind als Dünger zu dienen für die endlich einmal ersprießende Welternte der geläuterten Menschheit, oder was beißt mich da – er gehört nicht, wie ROUSSEAU bündig es nennt, zum peuple lettré, dem gebildeten Pöbel. Er steht also, kann man auch sagen, durchaus auf dem Standpunkt des kategorischen Imperativs oder der Noumenalität, ohne sich um irgendwelche Phänomenalität zu bekümmern. Diese Art und Weise, wie man sich den Dingen gegenüberstellt, ist gut in dem kurzen Hinweis gezeigt, den der Meister dem ehrwürdigen Rādho gibt: Gleichwie etwa Knaben oder Mädchen sich damit vergnügen, Häuslein aus Sand und Erde zu bauen und voller Begier, Verlangen, Wille, Durst eifrig und fieberhaft daran arbeiten, ihre Sandhäuslein hegen und behüten, gern haben, sich zueignen; ist ihnen aber die Lust daran vergangen, so werden sie alsbald jene Sandhäuslein mit Händen und Füßen zerreiben, zertreten, zerstampfen und damit ausgespielt haben: ebenso nun auch wird der erfahrene Jünger die fünf Stücke des Anhangens, und zwar Form, Gefühl, Wahrnehmung, Unterscheidung, Bewußtsein zerreiben, zertreten, zerstampfen und damit ausgespielt haben, um dahin zu gelangen, wo der Durst versiegt; denn versiegt der Durst, erlischt der Wahn. Saṉyuttakanikāyo ed. Siam. vol. III p. 169 (PTS 190). Im Lalitavistaras ist unser Gleichnis nicht mehr verstanden und stark vergröbert worden, es heißt dort, im 15. Kapitel, ed. LEFMANN p. 208: ābhir bālāḥ krīḍanti dārakā iva svamūtrapurīṣaiḥ, »mit Weibern treiben [797] Toren Kurzweil wie Kinder mit ihrem Harn und Kot«; ein typisches Beispiel wie die Bearbeiter im Mahāyānam über feinere, ihnen nicht mehr geläufige Stellen mit einer flüchtigen Erinnerung sich hinwegzuhelfen suchten. Dagegen ist denkwürdig und zeigt die scharfe gotamidische Beobachtung und Kraft der Veranschaulichung im rechten Licht, daß HOMER einst dasselbe Gleichnis gegeben hatte, Ilias XV 362/64, vom Bau der Sandburgen am Strande, die sich der Knabe in kindlicher Freude errichtet, aber dann, zu Ende des Spiels, mit Händen und Füßen wieder verschüttet. HERAKLIT hat gesagt: Kinderspiele sind der Menschen Meinungen (cf. Bruchstücke der Reden Anm. 271). Weiter und weiter bringt aber dann die 19. Rede der Mittleren Sammlung vor, bis zu dem Merkwort: »Die Dinge sind da«, S. 136. Nach allen Seiten hin dargestellt ist diese Ansicht in unserer 9. Rede 131-141. Als ein Bild der Sache, eine edle, artige Vignette dazu, kann uns GONGORAS Gleichnis am Grabe PHILIPPS III in ansprechen:
...venera, y prosigue! oh pasajero!
Tus pasos antes que se acabe el dia,
Porque es breve aun del sol la monarquía.
...verneige dich, und schreite fort, o Wandrer,
Auf deinem Pfad bevor der Tag in Dämmer fällt:
Denn baldig untergehn muß auch die Sonnenwelt.
781 Mit S Evaṃ Nigro und Yato Nigro tapassī cātuyāmao. – Die vier brahmavihārā oder heiligen Warten werden als die vier unermeßlichen Durchstrahlungen auch hier am Ende des Absatzes vorgetragen, wie ebenso in unserer 13., 17., 19. Rede, auch in der Mittleren Sammlung S. 41, 314, 33 of., 749f., 941. Die Genealogie dieser brahmavihārā, die sich in Indien bis in die vedische Vorzeit und bei uns bis zu JAKOB BÖHME und GOETHE herab ermitteln läßt, ist in der Mittleren Sammlung Anm. 454 und auch oben Anm. 549 gezeigt worden, an letzterem Orte sogar teilweise auf geschichtliche Grundlagen gestützt. Ein würdiges Beispiel und Bindeglied zwischen dem Görlitzer Schuster und dem Weimarer Olympier sei hier noch zur ersten heiligen Warte der unbegrenzten, allumfassenden Liebe aus POPE gegeben, der seinen letzten Essay on Man mit der gleichen Erkenntnis zum Abschlusse bringt, 361-372:
human soul
Must rise from individual to the whole.
Self-love but serves the virtuous mind to wake,
As the small pebble stirs the peaceful lake;
The centre moved, a circle straight succeeds,
Another still, and still another spreads;
Friend, parent, neighbour, first it will embrace;
His country next, and next all human race;
Wide and more wide, the o'erflowings of the mind
Take every creature in, of every kind;
Earth smiles around, with boundless bounty bless'd,
And Heaven beholds its image in his breast.
782 Vergl. Majjhimanikāyo, ed. Siam. II 360f. und ed. CHALMERS II 37, sowie Mittlere Sammlung Anm. 168. Der Text lautet demnach richtig: Ettha mayam anassāma sācariyakā, ettha mayaṃ panassāma sācariyakā. Der acc. pl. f. sācariyakā ist eine volkstümlich [798] gebrauchte Nebenform zu sācariyakāni, wie auch der nom. pl. m. suttā, pāṇā, dukkhā, rūpā, sattā für suttāni etc.; Gotamo selbst hat diese verkürzte Ausdrucksweise gelegentlich angewandt, z.B. in den Merksprüchen sabbe pāṇā avijjā und sabbe sattā āhāraṭṭhitikā: siehe Anm. 955.
783 Mit S etc. richtig yvāhaṃ bhagavantam evam avacāsiṃ. Das freiwillige Geständnis, das Bekennen der Schuld, wie es Nigrodho hier zeigt, wird in der 958. Anm. auch anderweitig belegt und mit der entsprechenden Stelle aus der Manusaṃhitā verglichen, die ihrerseits wieder auf ein noch älteres vedisches Vorbild zurückweist.
784 Mit S so yeva vo ācariyo hotu.
785 Mit S wieder beidemal richtig yo eva te uddeso so eva te uddeso hotu. Das niggahītam ober eva ist zu tilgen, es findet hier keine Nasalierung statt, da ja wie vorher eva und nicht evam gemeint ist.
786 Mit S yo ca te ājīvo so yeva te ājīvo hotu.
787 Vergl. die 10. Rede S. 138, Mittlere Sammlung 498. – Gotamo legt die Satzung dar, für jeden, und sagt von sich selbst nur: »Wegweiser ist der Vollendete«, Mittlere Sammlung S. 822. Wer der Weisung folgen, auf das Wort hören mag, ist ohneweiters auf den Weg gelangt, auf die erste Stufe gekommen, ein Hörer der Botschaft geworden. Eben darum sagt der Meister gelegentlich einmal zu Sāriputto: » ›Mitglied der Hörerschaft sein, Mitglied der Hörerschaft sein‹, so heißt es ja hier, Sāriputto: was ist aber wohl, Sāriputto, Mitglied der Hörerschaft sein?« – »Umgang mit Edlen, das ist, o Herr, Mitglied der Hörerschaft sein, edle Satzung hören ist Mitglied der Hörerschaft sein, gründliches Nachdenken ist Mitglied der Hörerschaft sein, Schritt um Schritt nachfolgen, wie die Satzung anleitet ist Mitglied der Hörerschaft sein.« – »Gut, Sāriputto, gut, Sāriputto«, stimmt Gotamo bei und billigt diese Erklärung Wort um Wort, Saṉyuttakanikāyo ed. Siam. vol. V p. 333f. (PTS 347); wie es auch entsprechend im Aṉguttaranikāyo heißt: »Ein solcher wird ein heiliger Jünger genannt, der unter dem schiefgeratenen Geschlechte geradebleibt, unter dem gehässigen Geschlechte ohne Haß bleibt, der mit dem Anhören der Satzung wohlvertraut im Angedenken an die Satzung sich übt«: Ekādasanipāto No. 12 p. 297 (330). Weitere Stellen noch in der 954. Anm. So wird denn mit dem Anhören der Satzung Verständnis gewonnen, mit dem Verständnis kommt es zu gründlichem Nachdenken, und mit dem gründlichen Nachdenken wird der eigene Kampf einsam, abgesondert, unermüdlich, in heißem, innigem Ernste durchgekämpft. Auch hier, und hier vor allem, gilt: Nisi per te sapias, frustra sapientem audias, PUBLILIUS SYRUS; oder nach dem Abschluß der Chinesisch-Deutschen Jahres- und Tageszeiten:
Mit andern kann man sich belehren,
Begeistert wird man nur allein.
788 Hierzu Anm. 406. Im Folgenden mit S etc.: Sabbe pi 'me moghapurisā phuṭṭhā mārena pāpimatā. Eine Sammlung von Gesprächen, die der Meister mit dem ehrwürdigen Rādho gehabt hat, enthält eine Reihe von etwa fünfzig Untersuchungen ausschließlich über māro, den Tod: es ist das 23. Buch des Saṉyuttakanikāyo, das Rādhasaṃyuttam, aus dem hier, als beste Erläuterung unserer obigen Stelle, gleich das erste Gespräch mitgeteilt sei, ed. Siam. vol III p. 168 (PTS 189 lücken- und fehlerhaft): » ›Der Tod, der Tod‹, o Herr, sagt man: was aber meint man, o Herr, wenn man ›der Tod‹ sagt?« – »Wenn Form, Rādho, besteht, kann der Tod sein, oder der Töter, oder wer eben zutode kommt. Darum aber, Rādho, sollst du die Form als den Tod ansehn, als den Töter ansehn, als das Zutodekommen ansehn, als Siechtum ansehn, [799] als Beule ansehn, als Stachel ansehn, als Übel ansehn, als übel geartet ansehn. Die es also ansehn, die sehn recht an. Wenn Gefühl, Wahrnehmung, Unterscheidungen, Bewußtsein besteht, kann der Tod sein, oder der Töter, oder wer eben zutode kommt. Darum aber, Rādho, sollst du das Gefühl, die Wahrnehmung, die Unterscheidungen, das Bewußtsein als den Tod ansehn, als den Töter ansehn, als das Zutodekommen ansehn, als Siechtum ansehn, als Beule ansehn, als Stachel ansehn, als Übel ansehn, als übel geartet ansehn. Die es also ansehn, die sehn recht an.« – »Was aber hat man, o Herr, vom Rechtansehn?« – »Vom Rechtansehn, Rādho, kommt Überdruß.« – »Und was hat man, o Herr, vom Überdruß?« – »Vom Überdruß, Rādho, kommt Abkehr.« – »Und was hat man, o Herr, von der Abkehr?« – »Von der Abkehr, Rādho, kommt Freiheit.« – »Und was hat man, o Herr, von der Freiheit?« – »Von der Freiheit, Rādho, kommt Erlöschung.« – »Und was hat man, o Herr, von der Erlöschung?« – »Überschritten hast du, Rādho, das Fragen, man kann den Begriff der Frage nicht fassen. Denn um in die Erlöschung zu münden, Rādho, wird das Asketenleben geführt, in die Erlöschung geht es ein, in der Erlöschung geht es auf.« Hierbei ist noch auffallend, wie sehr die Form dieses Gesprächs einer Unterredung des Yājñavalkyas mit der edlen Gārgī entspricht, in der Bṛhadāraṇyakopaniṣat III 6, wo diese kühne, scharfsinnige Denkerin, ähnlich wie DIOTIMA mit SOKRATES, über die letzten erkundbaren Dinge sich immer weiter und weiter aufzuklären sucht. Als sie aber endlich die Frage stellt, worin wohl die heiligen Stätten eingewoben und durchgewoben seien, antwortet ihr Yājñavalkyas: »Gārgī, überfrage dich nicht, auf daß der Kopf dir nicht berste: unüberfragbar sind ja die Himmlischen. Du überfragst dich, Gārgī: überfrage dich nicht.« Da hat denn Gārgī die Vācaknavī davon gelassen. – Man hört den gleichen Ton, aus einer gleichen Stimmung hervorgegangen; eine Nachahmung von der einen oder von der anderen Seite ist unwahrscheinlich, um so mehr als der Inhalt der Gespräche merklich verschieden ist. Die Gedankenkurve des Yājñavalkyas führt in eine Zeit, die dem Auftreten Gotamos lange vorangegangen war. Über manche wirklich erweisbare Beziehungen des alten Vedenmeisters zu Gotamo und zu unseren Texten findet man die Belege in den Anm. 47, 349, 402, 720, 726. OLDENBERG hat im 3. Kapitel seines Buches »Die Lehre der Upanishaden und die Anfänge des Buddhismus«, Göttingen 1915 S. 282ff., die zwei unterschiedlichen Kulturstufen mit ein paar derben Strichen umrissen und die so entstandenen Flächen recht gut mit seinen Schablonen neu übermalt; die Wiedergabe des Gesprächs der Gārgī mit Yājñavalkyas, S. 172, ist dem verehrten Mentor, obzwar er seinesgleichen weit übertrifft, leider ebenso wie dem sehr braven DEUSSEN in dessen »Sechzig Upanishad's des Veda« mißglückt: beide haben sie die richtige Lesung der Ausgabe unseres Altmeisters BÖHTLINGK, anatipra nyā vai devatāḥ, durch die verderbte, anatipra nyāṃ vai devatām, ersetzt; eine so nach Wort wie nach Inhalt widerstreitende, unmögliche Variante, die sich zwar in den modernen Bombayer Drucken zeigt, aber nur die unzureichende Kritik und Kenntnis der neuindischen Herausgeber dartut, der man immer skeptisch gegenüberstehn muß. BÖHTLINGKS Text, St. Petersburg 1889 erschienen, der auf WEBERS Ausgabe des atapathabrāhmaṇam und einer vorzüglichen Handschrift der Berliner kgl. Bibliothek beruht, ist hier unantastbar gesichert. Eine ehrwürdige Bestätigung findet man überdies in ANQUETIL DUPERRONS Oupnek'hat I I94f.: die um Jahrhunderte ältere Handschrift, der seine persische Vorlage wörtlich gefolgt war, hatte den Plural devatāḥ bewahrt.
Bei unserer Rede an Nigrodho und seine Jünger ist noch auf das Ende der 80. Ansprache in der Mittleren Sammlung, S. 596, ferner auf den Beginn der 136., S. 997 [800] nebst Anm. 497, sowie auf die wichtigen verwandten Stellen hinzuweisen, die zum 22. Stück unserer Sammlung beigebracht sind, Anm. 702. Gleichnisweise verallgemeinernd sagt der an solchen Texten herangereifte Dichter, von dem wir nur die schönsten Sentenzen aber nicht den Namen im Subhāṣitārṇavas finden, No. 6855 der Indischen Sprüche BÖHTLINGKS:
divā hy ulūko yadi nāvalokate,
tad āparādhaḥ katham aṃ umālinaḥ:
Bei Tageslicht wenn zwar die Eule nichts gewahrt,
Wie wäre das der strahlumkränzten Sonne Schuld?
Das stumpfe, lahme Verhalten jener Pilger und Freunde Nigrodhos, die bei einer so außerordentlichen Verheißung und angesichts eines solchen Mannes auch nicht einen einzigen Verständigen zeigen, der es auf einen kurzen Versuch möchte ankommen lassen – sieben Tage, was liegt daran – diese erstaunliche Schwerfälligkeit des Entschlusses, die man freilich einer alles überragenden Größe gegenüber regelmäßig und also auch hier, bei sonst hochbegabten Leuten, beobachten kann, spricht wiederum sehr zugunsten der treu bewahrten nüchternen Überlieferung, selbst bei dergleichen trivialen, nebensächlichen Zügen und Umständen. Denn der Mensch, wie er eben überall im Durchschnitt zu sein pflegt, versucht gar nicht erst, ob er doch wohl eine so kurze Strecke durchstehn kann, und beruhigt sich alsbald und sagt sich wie BION:
Ουκοιδ', ουδ' επεοικεν ἁ μη μαϑομες πονεεσϑαι.
Ein Spruch, den der herrliche Don JUAN MANUEL als Vettelweisheit bestätigt hat, in seinem Conde Lucanor, IV Ende, que dicen las viejas en Castiella: Quien bien se siede, non se lieve, Wer gut sitzt, steht nicht auf. Oder nach unserer deutsch gemächlichen Redensart: Was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß. Als Bequemling oder auch nur Skeptiker hält man es immer gern mit MONTAIGNE und seinem Bekenntnis, gegenüber dem Kanzler HENRI DE MESMES, seigneur de Roissy et de Malassise, am 30. April 1570 gegeben: Monsieur, c'est une de plus notables folies que les hommes facent, d'employer la force de leur entendement à ruyner et chocquer les opinions communes et receues qui nous portent de la satisfaction et du contentement. Kürzer gedrechselt, au gré du bonhomme: Sapperlipopette. Es ist die Erfahrung von Hinz und Kunz, die eben nichts anderes besagt als, wie POPE an SWIFT einmal schrieb: The habit of a whole life is a stronger thing than all the reason in the world. Von allen Vernunftgründen war auch jenen indischen Pilgern und Büßern die längst angewohnte, ihnen liebgewordene Lebenslüge nicht verleidet worden. So hielten sie es damals, so halten sie es heute, so wird man es immer halten wo man brav meint, daß die Mehrheit das Recht auf ihrer Seite habe. Vergl. IBSENS Volksfeind, in WOERNERS ausgezeichneter Darstellung des Dichters, München 1910, Bd. 2 S. 128f. und 364. Auch kommt wohl bei jenen indischen Büßern noch in Betracht, daß sie Angst davor haben, was man über sie sagen könnte, wie bei Pāyāsi in unserer 23. Rede, 413-417: auch dieser Mann würde gern der Wahrheit die Ehre geben, wenn er sich nur nicht fürchten müßte dadurch an seinem Ansehn Einbuße zu erleiden, für geringer und unbedeutender gehalten zu werden. Würde nämlich so einer seine bisher vertretene Überzeugung ändern, sich nunmehr einer höheren Erkenntnis unterordnen, so krampft sich ihm das Herz zusammen, wenn er erwägt bhavissanti me vattāro, »man könnte mir nachsagen«, man würde mich rügen, es würde von mir heißen: ›Wie töricht ist er doch bisher gewesen, wie schwer von Begriffen‹ und dergleichen mehr. [801] Das darf um keinen Preis geschehn, »alles, nur das nicht«, haben solche Geister schon damals gedacht, haben von dem, was einer vorstellt, in der Meinung anderer, auch keinen Schritt abweichen wollen, nach ihrer aphoristischen, nur allzu aphoristischen Lebensweisheit. Das bhavissanti me vattāro, es würde von mir heißen, ist also auch in Indien ein gar alter Gemeinplatz gewesen. Pāyāsi der Kriegerfürst hat auf ihm gerastet, Nigrodho der Pilger und seine Gesellschaft hat ihn nicht verlassen mögen; und ebenso wird er im Mahābhāṣyam, sogar viermal, breitgetreten als bhavanti vaktāra?ḥ I 4, 10 und 11 und als vaktāro bhavanti III 1, 2, IV 2, 8, das fürchterliche on dit, oder nach SCHOPENHAUER, »wie vom größten Manne ein halbes Dutzend Schafsköpfe mit Wegwerfung spricht«: ein Ausdruck, eine Redeweise, eine fama cognita, die demnach zur Zeit des Patañjalis, im vierten Jahrhundert nach Gotamo, nicht minder beliebt gewesen. Auf diesen Umstand hat Colonel JACOB, Indian Army, einer Anregung KIELHORNS folgend, im Journal of the Royal Asiatic Society 1914 p. 306 gebührend hingewiesen. Weitaus die beste Schilderung aber findet man am Ende unserer 4. Rede, S. 88, wo das Betragen des hochmögenden Priesters Soṇadaṇḍo ganz ernst nach der Anschauung und darum zugleich unübertrefflich humorvoll gezeigt wird.
789 Mit S pavaḍḍhati. Die Rede geht weiter.
790 Daḷhanemi (S Dalhanemi) ist ein aus der Smṛti wohlbekannter Herrscher der Vorzeit: Viṣṇu- und Bhāgavatapurāṇam nennen ihn, und im Vāyupurāṇam wird er gepriesen als der weithinstrahlende, Dṛḍhanemiḥ pratāpavān, ed. RĀJENDRALĀLAMITRA vol. II 37 v. 180. Der Name bedeutet so viel als ›Der mit der harten Kante‹, nämlich der Wurfscheibe, der Diskuswerfer, δισκοβολος; oder wie bei uns Eckehart ebenso besagt ›Der mit der harten Ecke‹, wo Ecke gleich Spitze, Schneide, Schwert ist, das altnordische egg, englische edge, nach acus, ακις. Dietrich von Bern führte das Schlachtschwert ›Eckesachs‹, das er dem riesigen Ecke abgenommen hatte. Daḷhanemi entspricht somit gut unserem Eckehart, als kriegerischer Beiname, der dann zum Eigennamen wurde. »Alles is kant en klaar«, sagt heute noch der Holländer, wenn er zufrieden ist; und wenn er wild wird, der Vläme, dann will er einem »van kant helpen«, von der Kante helfen, d.i. um die Ecke bringen.
791 Das Radjuwel als Wahrzeichen des besten Landes und der kaiserlichen Oberherrschaft ist der Vorfahr des heraldischen Adlers, der als Wappentier mit den römischen Legionen vorgedrungen überall den Abendländern zum Herrschersymbol wurde und jede kaiserliche Pfalz überschattet; während es hier das Rad ist, das am inneren Schloßtor als Wappen funkelt und strahlt und leuchtet, zu Häupten des Kaiserstuhls, die Augen wie blendend, den Schloßhof mit Glanz übergießend: siehe S. 465, auch vorher S. 285. – Im Folgenden richtig mit S etc. rañño Daḷhanemissa paccassosi.
792 Genauer mit S etc. samayo dāni me dibbe kāme. Ähnlich spricht König Makhadevo zu seinem Sohne, Mittlere Sammlung 624.
793 ariye cakkavattivatte vattamāne mit S. Der königliche Vater deutet seinem Sohne nach vedischer Art yathāha bhagavān Pāṇiniḥ: samāṃ samāṃ vijāyate. Es wird immer ein alter ego dasein. Im Symbol der Chāndogyopaniṣat II 9, 1: Wie die Sonne allezeit jedem und jedem gleich aufgeht, geht der Kaiserwandel allezeit jedem und jedem Nachfolger gleich auf. Das ist der Wunsch, der Segen, das Vermächtnis jener Herrscher der Vorzeit. Aber der Lebenslauf gerät in eine andere Bahn, die Dinge entwickeln sich mit der Zeit nach einer anderen Richtung.
Die uns das Leben gaben, herrliche Gefühle,
Erstarren in dem irdischen Gewühle.
[802] 794 Vergl. die nähere Ausführung dieser königlichen Vorsorge, je nach dem Stande der Bedürftigen, S. 92-93. In einzelnen Fällen gewährt der König einen unbeschränkten Steuerablaß. Der Grund hierzu ist je nach der Lage der Dinge verschieden (cf. Manus VII 133 etc.), sei es daß der König auf eine notleidende Bevölkerung Rücksicht nimmt, oder daß er gewissen Personen oder einem bestimmten Ort eine ganz besondere Auszeichnung erweisen will. Der letzte Fall wird gut durch Asoko bestätigt, als er das Dorf Luṃmini von aller Steuer befreit, aus Verehrung und in Erinnerung, wie er auf der Inschrift von Paḍeria sagt, Epigraphia Indica V 4: »Hier ist der Buddho geboren, Sakyamuni.« Darum hat der König das Dorf Luṃmini steuerlos gemacht, Luṃminigāme ubalike kaṭe, gemäß dem Ausdruck in unserer 5. Rede (Anm. 158) balim uddharati; und er hat überdies noch den Ort, als eine ihm hochbedeutende Stätte – er wiederholt nachdrücklich »Hier ist der Erhabene geboren« – mit kostbaren Gaben beschenkt, »auch Reichtums teilhaftig werden lassen«, aṭhabhāgiye ca. Nach der landestümlichen Überlieferung im Divyāvadānam p. 390 ist damit eine damals gemachte Spende von hunderttausend Goldstücken gemeint, als eine Stiftung für die von Asoko hier wie überall so tatkräftig gepflegten mancherlei gemeinnützigen Werke und Anstalten. Eine solche Millionenspende für Luṃmini ist bei Asokos Fürsorge und Freigebigkeit nichts weniger als verwunderlich. Der prachtvolle lapidare Stil der Inschrift auf der Säule von Paḍeria zeigt übrigens schon allein durch sich selbst die königliche Botschaft vom Steuerablaß und der reichen Spende so klar wie nur möglich an. Es heißt ubalike kaṭe aṭhabhāgiye ca, und das ist udbalikaḥ kṛto 'rthabhāgya ca. Mißverstanden ist die Stelle, wenn FLEET aṭhabhāgiye gleich aṣṭhabhāgyaḥ setzt, widerlegt in unserer Sammlung Anm. 454; oder neuerdings gar THOMAS darin versteckt ardhabhāgyaḥ erkennen will, Journal Royal Asiatic Society 1914 p. 392: so, daß der König die Steuer vom üblichen Sechstel erst auf ein Viertel erhöht, dann auf ein Achtel ermäßigt, also bei dieser wucherhaft ausgerechneten Quote und Teilung auf Abzug nur eine Hälfte der gesteigerten Rate nachgelassen habe. Abgesehn nun davon, daß einem Herrscher und zumal einem solchen Kaiserkönige wie Asoko, nichts ferner gelegen sein konnte als auf einer Denksäule, und noch dazu auf einer derartigen kurzen Weihinschrift, bürokratische Schikanen und Zollgebühren zu bescheinigen, hatte Asoko doch eben zuvor durch ubalike kaṭe gänzliche Steuerfreiheit gewährt: das sogleich folgende aṭhabhāgiye ca kann daher nichts anderes sein als arthabhāgya ca, und reiche Spende. Ich habe darüber ausführlich gesprochen in der Zeitschrift der deutschen morgenländischen Gesellschaft, Bd. 68 S. 721f. Asoko ist demnach der bei uns oben im Text angegebenen Weisung zum heiligen Wandel eines Kaisers nach Kräften gefolgt. Und das war bei seiner Machtfülle und Unermüdlichkeit nahezu das erreichte Ideal.
795 Kiṃ bhante kusalaṃ, kiṃ bhante akusalaṃ mit S. Zur vorher vom König gepriesenen Geduld und Milde bei Asketen und Priestern gehört der klassische Ausspruch aller Erwachten: »Geduld ist höchste Buße, Dauertugend«, S. 214; vergl. Anm. 217 die altüberlieferte Weise aus dem Harṣacaritam: »Geduld ist Wurzel aller Büßerschaft«, aus dem Kathāsaritsāgaras 66, 16: brāhmaṃ īlaṃ kṣamā nāma, »die heilige Tugend heißt Geduld«, sie ist also zugleich die oberste, reinste, ist die Tugend der brahmischen Welt, die der brahmavihārā. Dabei ist denkwürdig, daß auch bei den Spartanern die Geduld als höchste Tugend gegolten hat, wie CORNELIUS NEPOS im Leben des ALKIBIADES gegen Ende treffend bemerkt, summa virtus in patientia ponebatur. Denn Tugend kommt immer von kratus, καρτερειν, taugen, beharren, tapfer sein, innen und außen, jeder in seiner Art: das ist der Tugend Mark und Muskel. Daher auch das Wort des prophetischen Nautes in der Äneis V 710:
[803] Quidquid erit, superanda omnis fortuna ferendo est.
Was es auch sei, überwindbar ist jedes Geschick für den Dulder.
Wie aber PLATON und ARISTOTELES hier im höchsten Verstande mit Meister ECKHART überein kommen, ist in Anm. 137 belegt.
796 Der Begriff des indischen Weltkaisertums und seine geschichtliche Verwirklichung kann in den Anm. 525-527, 539, 540, 559 u. 563 etwa ein Jahrtausend hindurch, vom mythischen aber zugleich prähistorischen Könige Māthavas über Asoko und Khāravelo bis zu den guptischen Erderoberern, auf Grundlage der reichlich erhaltenen Urkunden und Inschriften verfolgt werden; Zeugnisse, die unsere im Text oben vorbildlich festgestellten Umrisse Zug um Zug bestätigen, in der praktisch durchgeführten, bestens gelungenen Nachfolge tatendurstiger Herrscher. Das Ziel, das jene Großen sich erkoren und mit unermüdlicher Heldenkraft errungen hatten, war da stets ein möglichst umfassendes, allgemein gesichertes Volkswohl gewährzuleisten; nicht anders wie es CAESAR, auf dem Gipfel seiner Macht, in den letzten Lebenstagen noch erträumt hatte, es endlich zu verwirklichen noch eifrigst beflissen war: das römische Gebiet bis zu den Grenzen aller Meere hin zu erstrecken, überall Sicherheit zu schaffen, Wüsten und Sümpfe urbar zu machen, um so immer noch mehr ungezählten Tausenden das Dasein zu erleichtern, nach PLUTARCHS trefflichem Bericht, Kap. 58 gegen Ende. Der Sehnsucht oder Wahnsucht CAESARS wie auch der gewiß noch unbändigeren NAPOLEONS, wurde aber nur die Befriedigung zuteil, die der hundertjährige blinde Faust, im täuschenden Gedanken das Meer werde eingedämmt für neues Leben und weiteres Schaffen und höhere Ziele, am Rande der ihm selbst geschaufelten Grube als Vorgefühl empfindet: wo hingegen die altindischen Heroen jenes hohe Glück nicht nur zu ersehnen, sondern als einen höchsten Augenblick vielleicht zu genießen vermochten. Freilich gilt auch von ihnen wie von allen Welteroberern letzten Endes nichts anderes als das Cui bono, das einst die Maitryupaniṣat zu bedenken gab, I 4: Atha kim etair vā pare 'nye mahādhanurdharā cakravartinaḥ kecit. Oder wie LUCANUS der Cordubenser, der Neffe SENECAS, dasselbe gesagt hat, Pharsalia I 87-91:
O male concordes, nimiaque cupidine caeci,
Quid miscere invat vires, orbemque tenere
In medio? Dum terra fretum, terramque levabit
Aër, et longi volvent Titana labores,
Noxque diem coelo totidem per signa sequetur.
Und ebenso das Urteil HEINRICHS VII TUDOR schon über einen KARL VIII VALOIS: Quae possidet, sua non sunt, et tamen ulteriora appetit; ein kurz gefaßter Ausdruck der Unterredung des KINEAS mit PYRRHOS, bei PLUTARCH Kap. 14, sehr gut von FREINSHEIM zusammengezogen in dessen Supplement zu LIVIUS XII 18: Fama est, Cineam praestanti sapientia virum, quo immodicas regis cupiditates, paratamque felicitatem praesentibus bene utendi turbaturas, ipsius quoque confessione coercendas esse ostenderet, quid devictis Romanis agere constituisset? interrogasse. Atque illo subinde alias ex aliis victorias nascituras esse demonstrante, subiecisse: quid igitur confectis istis omnibus acturi sumus? Tum vero pacis et otii bonis affatim fruituros respondente, excepisse Cineam: quid igitur vetat, o rex, quin statim iis fruamur, cum praesto sint: novis autem bellis suscipiendis corrumpi penitus amittique possint. Die ganze Unterredung ist geradezu Wort um Wort wie nachgesagt dem herrlichen Zwiegespräch, das König Koravyo mit [804] Raṭṭhapālo ein paar Jahrhunderte vorher geführt hatte, Mittlere Sammlung 620f. der König als Welteroberer hat alle Reiche in Ost und West, Nord und Süd glücklich unterjocht; aber er ist immer noch »bedürftig, nimmersatt, durstverdungen«, und darum zieht er nun mit seiner Heeresmacht jenseit des Ozeans hinüber, um auch jene Gebiete dort zu bekriegen, zu bezwingen. Hätte aber Koravyo oder wer es sonst sei wirklich die Erde erobert, dauernde Herrschaft über diese ganze Welt errungen: er wäre bald wieder so unzufrieden wie sein mythischer Ahnherr König Mandhātā der Unersättliche, dem der Erdkreis viel zu klein und dürftig war, und der darum die Kaisergewalt auch über einige der noch formhaften Himmel erkriegte, nach dem 258. Jātakam (s. 1058. Anm. gegen Ende); also wie jener, nach dem »Ein Lied« des Wandsbecker Boten im Jahr 1771 lächelnd gefragt hat:
wie hieß er doch,
Der, als er Herr war von der Welt,
Zum Mond hinauf sah noch?
Oder, um von so luftigen Träumen abzustehn und geschichtlich zu bleiben: er wäre bald wieder so unzufrieden wie bei uns der allergroßmächtigste ALEXANDER, der bekanntlich auf das Wort eines Philosophen, es gäbe viele Welten, in die Klage ausbrach: ›Und ich habe noch nicht einmal diese eine erobert!‹ Non sufficit orbis, war nach solchem Vorbild der Wappenspruch PHILIPPS II gewesen; regis Hispaniarum et utriusque Indiae; wo es auch bei dem besser geheißen hätte »Lágrimas y silencio es tu doctrina«: der letzte Gruß, den RODRIGO CARO, bald nach dem Tode des Königs, zwar nicht ihm sondern den Ruinen Roms geweiht hat. Unser HANS SACHS aber läßt den, der »bezwungen India vnd der mechtigst auff Erden worn«, den berühmtesten PHILIPPER der sich eitel zeusgezeugt nannte, vom rechten DIOGENES aus der Tonne so anreden:
Je mehr du hast, je mehr du gerst
Vnd schier die gantze Welt beschwerst.
Und in GOETHES Maskenzug (vom 18. Dezember 1818) sagt der Cid:
Aber, ach! die Jahre weichen,
Und es weicht auch das Gedächtnis;
Kaum von allerhöchsten Taten
Schwebt ein Schattenbild uns vor.
Eine Betrachtung der Weltgeschichte, die nicht nur auf ALEXANDER und NAPOLEON hinweist, vielmehr schön allgemein ebenso spanisch wie indisch und griechisch anmutet, da uns ja auch von SOPHOKLES aus dem Saytrspiel Kedalion das Wort erhalten ist: »Was auch irgend geschieht, es ist alles der Schatten eines Esels«, Ὀτι αν τι γενηται, τα παντ' ονου σκια, nach SUIDAS s.v. ονου σκια – Bei minderen Geistern nun wird der Monarchenwahn zwar meistens nur in die dementia majestatis ausarten, wo der Name Weltkaiser oder cakkavattī nicht mehr genügt und ein gar noch gewaltigerer Titel das Unerreichbare ersetzen, vortäuschen muß: daher die römischen Imperatoren sich als Vestra Aeternitas, Eure Ewigkeit, anreden ließen; oder wieder heutzutage schon so ein Herrscher wie der über die albanischen Bauern und Hirten nicht anders als Mbret, d.i. Imperator, genannt sein will, in der fiebernden Hoffnung: forsan et haec olim meminisse invabit. Darum also gab ja einst Raṭṭhapālo dem trotz seiner achtzig Jahre immer noch raubgierigen, immer noch weiter eroberungssüchtigen [805] König Koravyo das Meisterwort an: »Bedürftig ist die Welt, nimmersatt, durstverdungen.« Asoko, der ein AUGUSTUS und MARCAUREL in einer Person war, hatte sich den Namen Piyadassi, d.i. Gratius oder Gerngesehn, als ihm am liebsten erwählt. Dadurch aber hatte er nur sein huldreiches Wirken andeuten wollen, und daß er keinen Gedanken an persönliche Eitelkeit und Befriedigung hegte. Sein Leben war eine bei gar keinem anderen Erdbeherrscher zu findende Verwirklichung des Faustworts: »Die Tat ist alles, nichts der Ruhm.« Auf ihn paßt, und nur auf ihn als Monarch, wie SCHILLER seine akademische Antrittsrede schließt: er hatte die Bahn zur Unsterblichkeit beschritten, »zu der wahren Unsterblichkeit meine ich, wo die That lebt und weiter eilt, wenn auch der Name ihres Urhebers hinter ihr zurückbleiben sollte.« So aber hat er durch sein Leben und Schaffen die alte Fürstenregel bestätigt, die schon im Heldengesang der Bhārater, III 1210, zwanzig Jahrhunderte vor unseren Dioskuren als die kaiserliche Tugend gepriesen war:
Sa karma kuru mā glāsīḥ,
karmaṇā bhava daṃ itaḥ,
kṛtaṃ hi yo 'bhijānāti,
sahasre so 'sti nāsti ca.
Tu deine Tat und zaudre nicht,
Die Tat sei deine Waffe licht,
Kennt unter tausend, was getan,
Auch einer oder keiner an.
797 Mit S richtig Tam enam aggahesuṃ. – Das Versäumen der alten Sitte und schwächliche Betragen dieses letzten Kaiserkönigs mit der Mahnung seiner Räte und Hofleute zum Brauch der Väter zurückzukehren erinnert, nach verjüngtem Maßstabe, an unsere eigene Sage vom Thüringer Landgrafen, der ein gar zu milder und weicher Herr geworden war: daher denn Junker und Ritter dreist die Gebote zu übertreten und das Volk zu bedrücken begannen; bis der Herrscher einst, verirrt und unerkannt auf der Jagd bei einem Schmied im Walde eingekehrt, in der Nacht hörte, wie der voll Unmut über das Elend des Landes das Eisen mit dem Hammer bearbeitete und dabei immerzu rief: ›Landgraf, werde hart, Landgraf, werde hart wie dies Eisen: siehst du nicht, wie deine Räte das Volk plagen und dich unwert halten!‹ so daß der Landgraf es sich zu Ohr und Herzen nahm, fürderhin scharf und ernsthaftig wurde und die Widerspenstigen wieder zum alten Gehorsam brachte: GRIMM No. 550.
798 Cf. Anm. 61. – Über Darben und Notleiden, dāḷiddiyam, dessen Entstehn und immer weitere Verbreitung hier schon mit einer merkwürdig frühen volkswirtschaftlichen Begründung nachgewiesen und in diesem ganzen Abschnitt entsprechend behandelt wird, läßt PLATON den SOKRATES ganz ähnlich sprechen, im achten Buch der Republik, p. 552: »Es ist also klar«, sagt er zu ADEIMANTOS »daß in einem Staate, wo du Bettler sehn kannst, auch wohl verborgene Diebe sich ebenda finden werden, sowie Beutelschneider und Tempelräuber und alle Arten von solchen Übeltätern« usw. Die gegebenen Tatsachen bloß darstellend, ohne irgendeine Aussicht in einen künftigen Traumstaat zu geben, werden diese Verhältnisse im Aṉguttaranikāyo VI No. 45 allgemein und sodann vergleichsweise recht gründlich untersucht. »Notleiden, ihr Mönche«, sagt Gotamo, »ist schmerzlich in der Welt für den Wunschgenossen. Weil aber, ihr Mönche, der Notleider, Unfreie, Bedürftige in Schulden gerät, ist auch die Schuldenlast, ihr Mönche, schmerzlich in der Welt für den [806] Wunschgenossen. Weil aber, ihr Mönche, der Notleider, Unfreie, Bedürftige Schulden auf sich genommen hat und Verzinsung zusagt, ist auch die Verzinsung, ihr Mönche, schmerzlich in der Welt für den Wunschgenossen. Weil aber, ihr Mönche, der Notleider, Unfreie, Bedürftige, der die Verzinsung zugesagt hat, zur bestimmten Zeit die Zinsen nicht zahlen kann, drängt man ihn dann, und auch das Drängen, ihr Mönche, ist schmerzlich in der Welt für den Wunschgenossen. Weil aber, ihr Mönche, der Notleider, Unfreie, Bedürftige auf das Drängen hin nichts geben kann, wird er dann verfolgt, und auch die Verfolgung, ihr Mönche, ist schmerzlich in der Welt für den Wunschgenossen. Weil aber, ihr Mönche, der Notleider, Unfreie, Bedürftige, Verfolgte nichts geben kann, wird er dann gefangen gesetzt, und auch das Gefängnis, ihr Mönche, ist schmerzlich in der Welt für den Wunschgenossen. So ist denn, ihr Mönche, Notleiden schmerzlich in der Welt für den Wunschgenossen, dann die Schuldenlast, die Verzinsung, das Drängen, die Verfolgung, das Gefängnis schmerzlich in der Welt für den Wunschgenossen. – Ebenso nun auch, ihr Mönche, ergeht es da irgend einem, der kein Vertrauen hat zu heilsamen Dingen, keine Schamhaftigkeit vor heilsamen Dingen, keine Bescheidenheit vor heilsamen Dingen, keine Kraft zu heilsamen Dingen, keine Weisheit bei heilsamen Dingen: den heißt man, ihr Mönche, im Orden des Heiligen einen Notleider, Unfreien, Bedürftigen.« Was ein solcher in Werken, Worten und Gedanken übeltut, das ist seine Schuldenlast. Wie er sich verstellt und verbirgt, häuft er die Zinsen auf. Wie man über ihn spricht, wird er bedrängt. Reue und Ärger ist die Verfolgung. »Ist nun, ihr Mönche, so ein Notleider, Unfreier, Bedürftiger in Werken, Worten und Gedanken übel gewandelt, so wird er bei der Auflösung des Körpers, nach dem Tode, in die Gefangenschaft höllischer Welt eingezogen oder in die Gefangenschaft des tierischen Schoßes. Nicht vermag ich, ihr Mönche, auch nur eine andere Gefangenschaft wahrzunehmen, die so schrecklich, so peinvoll, so hinderlich zur Erlangung der höchsten Sicherheit wäre, als wie eben, ihr Mönche, in höllischer Welt gefangen sein oder im tierischen Schoße gefangen sein.« Diese Darlegung zeigt noch daneben das zuständige entwickelte Verhältnis von STERNES Wort vom unausfindbaren Irrgang der Schulden, Sorgen, Leiden usw., am Ende der Anm. 857 gegeben. Der Grieche aber schuf sich dafür das doppeldeutige Etymon als ein Sprichwort: Τα Τανταλου ταλαντα τανταλιζεται; cf. die Adagia des ERASMUS S.v. mit der horazischen Erklärung:
Tantalus a labris sitiens fugientia captat
Pocula, quid rides? mutato nomine de te
Fabula narratur.
Und ebenso umfassend ist die Deutung des sisypheischen Mythos, nach PHAEDRUS, Appendix No. 5:
Adversus altos Sisyphus montes agens
Saxum labore summo, quod de vertice
Sudore semper irrito revolvitur,
Ostendit hominum sine fine esse miserias.
799 Der Ausgang durch das südliche Stadttor ist darum bestimmt, weil dieses nach vedischem Ritus der untersten Kaste gebührt. Das obere Stadttor, gegen Norden, zeigt den Krieger an, das westliche den Priester, das östliche den Bürger. Daher wird auch bei einem Leichenzuge diese Ordnung bis heute noch eingehalten: die Bahre eines Mannes aus dem Kriegergeschlechte darf nur durch das nördliche Tor [807] zur Verbrennung auf den Leichenplatz gebracht werden, ein Toter von priesterlicher Abkunft nur durch das westliche, usw. Siehe Anm. 496 und S. 401. Dazu gehören noch die bemerkenswerten Andeutungen über das südliche und das nördliche Ufer des Ganges: dieses als hochheilig gehalten, jenes als minderwertig, S. 39 und oft. Offenbar darum ist Benāres, wie einst auch Kosambī usw., ausschließlich am nördlichen Gestade aufgebaut, bis zur Gegenwart; das drübenliegende Flußufer ist kahl und verlassen, ohne Pilger und Badeplatz. Der Āryer hat seine Wohnstätte nach Norden zu, das ist sein Gebiet; der Süden ist der Ort anderer Stämme, da hat er nichts zu suchen: sonst verliert er seine höhere Kaste, Baudhāyanagṛhyasūtram V 13. Dies ist sogar schon in der Ṛksaṃhitā angedeutet, X 61, 8 u. 86, 22; wobei OLDENBERG wohl für jene frühe Zeit die Frage aufstellt: »denn Verbannte gehen südwärts?«, Textkritische und exegetische Noten zum Ṛgveda, Berlin 1912, Bd. II S. 293. Aber seine Vermutung ist zutreffend, man kann ihm bejahend beinicken und darf die beiden sich ergänzenden Stellen als die älteste Bestätigung der auch bei uns oben im Text überlieferten Landessitte betrachten. Vergl. noch Bruchstücke der Reden v. 976.
800 Richtig mit S etc. sīsāni nesaṃ chindanti. Es war nun, durch den König sanktioniert, die airṣacchedikā iṣṭi, die sacratio capitis eingetreten, die »übere âchte« oder Oberacht des vogelfreien Verbrechers.
801 Aus der wissentlichen Lüge, die sich da entwickelt, geht alles fernere Übel hervor. Bisher hatte auch der Verbrecher wenigstens wahr geredet: jetzt aber hält er es wie Hippolytos beim EURIPIDES, v. 612, mit dem
ή γλωσσ' ομωμοχ', ή δε φρην ανωμοτος;
Die Zunge schwur, doch nicht geschworen hat das Herz.
Über die Verwerflichkeit der Lüge ist ausführlich in der 61. Rede der Mittleren Sammlung gesprochen, S. 453f., wo Gotamo seinem Sohne Rāhulo gegenüber damit abschließt: »daß wer sich da vor bewußter Lüge nicht scheut alles Böse zu tun imstande ist. Darum merke dir, Rāhulo: ›Nicht einmal im Scherze will ich Lüge reden‹: also hast du dich, Rāhulo, wohl zu üben.« Diese Ansprache hat Asoko auf dem Bairāter Edikt mit genauer Kennzeichnung als »Rāhulos Ermahnung: Abscheu vor Lüge« den Mönchen und Nonnen, Anhängern und Anhängerinnen zum Nachdenken empfohlen.
802 Siehe Mittlere Sammlung Anm. 482. – Eine Bearbeitung und streckenweise ungemein sorgfältige Übersetzung dieser Legendenstücke über die fortschreitende Verschlechterung der menschlichen Zustände usw. ist im Rājavaṃ as des Mahāvastu gegeben, ed. SENART vol. 1338-348. Der Stoff ist in der ganzen buddhistischen Welt, wie SENART p. 615 bemerkt, ein wohlbekannter Gegenstand gewesen, im Süden wie im Norden; bis nach China und Japan. Einen reichlichen Auszug aus dem chinesischen Kanon gibt BEAL in seiner Catena of Buddhist Scriptures p. 109-113, eine Zusammenstellung aus dem tibetischen Kanon verdanken wir CZOMA KÖRÖSI: siehe die Nachweise bei SENART p. 165 und die Analyse der fol. 419-446 vom Ende des dritten Bandes im Dul-va bei FEER, Annales du Musée Guimet, Paris 1881, II 177. Dem füge ich noch die Schilderung hinzu, die uns SCHIEFNER aus dieser guten Quelle des Kāh-gyur vermittelt hat, in seiner Abhandlung »Über die Verschlechterungsperioden der Menschheit nach buddhistischer Anschauungsweise«, im Bulletin historico-philol. de l'acad. de St. Petersb. 1851 (IX Nr. 5); einer Arbeit, die SCHOPENHAUER, beiläufig bemerkt, dem Studium empfohlen hat, im Willen in der Natur, Kapitel Sinologie Anm. 2 Zahl 6. In den feineren Einzelheiten hält die tibetische Übersetzung einer kritischen Prüfung und Behandlung zwar nicht stand, obwohl von den reichbegabten [808] indischen Sprachkennern und Sprachschöpfern aus dem Saṃskṛt-Kanon Wort um Wort übertragen, verdolmetscht, glossiert, kommentiert und superkommentiert wie vorher in China; aber sie gibt doch das ganze Stück Evolution dieser und zumal der folgenden 27. Rede unserer Sammlung mit bewundernswerter Treue des Sinns und Ausdrucks wieder. Um eine von jenen Einzelheiten zu erwähnen, die den indo-tibetischen Gelehrten nicht klar wurden: bei SCHIEFNER, am angegebenen Ort S. 6 des Sonderdrucks, heißt es: »Der Anfang der Brahmanenkaste ist folgender: Einige Menschen, die von Krankheit, Geschwüren, Schmerzen und Kummer geplagt wurden, zogen aus dem Dorf an einsame Orte, bauten sich aus Zweigen und Blättern Hütten und wohnten in denselben«; während es bei richtigem Verständnis dieser Textstelle nur so heißen kann: »Einige Menschen, denen die allgemeine Verderbtheit der Welt Schmerzen und Kummer bereitete, zogen aus dem Dorf« usw. Nicht mit Unrecht weist übrigens SCHIEFNER in seiner Einleitung auf die verwandten Sagen der Griechen hin, insbesondere auf den Mythos bei HESIOD, wo eine ähnliche Verschlechterung der Menschenalter und -zustände gezeigt ist, Erga v. 109-201 (mit dem entsprechenden Abschluß κακου δ' ουκ εσσεται αλκη); und er führt noch PRELLER an, der in seiner »Demeter und Persephone« S. 222ff. wirkliche Zustände als Grundlage solcher Schilderungen annimmt. Man kann dem nur zustimmen, ohne sich als laudator temporis acti auf Mythologeme stützen zu müssen. Man braucht sich nur an das Taote-king zu erinnern, wo LAO-tse in seiner unvergleichlichen Weise das Verhältnis im 18. Kapitel darstellt; oder wie, ein Jahrhundert später, PERIKLES vor den Athenern geredet hat, daß sich alles in der Welt mit der Zeit zu verschlimmern pflegt, THUKYDIDES II 64, und wie, ein halbes Jahrtausend nach LAO, der sanfte HORAZ von der progenies vitiosior spricht, von den immer schlechter werdenden Nachkommen – recht als der Chinese in Rom; oder weiter herabsteigend, an das Wort GRACIANS vom glühenden Aufgang (Osten) und dem frostigen Untergang (Westen), oriente del fervor y ocaso de la tibieza, Comulgador, Meditacion XXVII am Ende. Oder auch wie sich dessen Zeitgenosse J. DE LAET, ein Freund des HUGO GROTIUS, über die Amerikaner geäußert hat, über die Irokesen und Apatschen von damals, natürlich, die ja immerhin noch, wie man sagt, bessere Menschen gewesen sein sollen, gewiß: Ex omnibus, quae diximus, apparet, gentes utriusque Americae ... a maligno spiritu regi, et misere torqueri: plurimasque adeo omnem humanitatem penitus exuisse. De origine gentium Americanarum, Amsterdam 1643, in BRUCKERS Historia critica philosophiae, vol. VI, appendix, p. 1005, Leipzig 1767. Dagegen würde nun allerdings der großartig entwickelte Gemeinsinn, Makler- und Technikergeist der neuen Emporkömmlinge und Schlotfürsten einem J. DE LAET oder FLACCUS a non flaccendo als eine fabelhafte Fortbildung, als ein Ausbruch erscheinen, eine Expansion, Expulsion, Kulturexplosion sondergleichen: fragt sich nur, ob nach oben oder nach unten? LEOPARDI hat eine Storia del genere umano im letzteren Sinne geschrieben. Mit aller wünschenswerten Nüchternheit hat aber BACO VON VERULAM die Frage untersucht und ist zu dem Ergebnis gelangt: in sedit animis hominum penitus opinio, quod sit perpetuus defluxus per aetatem, tum quoad diuturnitatem vitae, tum quoad magnitudinem et robur corporis, omniaque labi et ruere in deterius: Historia vitae et mortis, ed. 1694 fol. 516 § 23 i.f. Hierzu noch der letzte Absatz der folgenden Anmerkung. Anderseits wird doch wohl, vom breiten Standpunkt des Völkerpsychologen aus betrachtet, PASCALS Gedanke (II 17 108) zu Recht und Trost bestehn: Les inventions des hommes vont en avançant de siècle en siècle. La bonté et la malice du monde en général reste la même.
[809] 803 kudrusako, Secale cornutum, gehört zu kudhānyam, nach u rutas I 196, 21 etc. Vergl. noch kodravādi, das Paspalum scrobiculatum, auch πασπαλη, παιπαλη, eben als Staubmehl mit Honigtau, Mutterkorn, Brandpilzen. Denn der kodravas ist eine Art Tollkorn oder Lolchgras, das da zumeist mit dem Mehltau der Brandsporen keimt und körnt und in manchen Landstrichen angebaut den unteren Volksschichten wirklich auch zur Nahrung dient. Das daraus bereitete Brot oder Fladengebäck hat einen niederträchtigen Geschmack nach Fäulnis, der im Hals eine lang anhaltende Schärfe hinterläßt, wie nach einem ätzenden Fusel oder Rachenputzer. Der kudrusako, Mehltau usw., als die beste Speise jener entarteten Geschlechter ist aber so zu verstehn: gleichwie jetzt etwa das feinste Korn, Reis, Gerste usw., als āliyavādipiṣṭam, σεμιδαλις, similago, Semmelmehl, gebacken wird und als die gesündeste Nahrung gilt, ebenso nun auch wird bei jenen gänzlich verkommenen Menschen Mehltau, Mutterkorn usw. als ein ungleich kräftigerer Ersatz dafür befunden werden, viel vernünftiger als die primitive Küche und Kost einer längst entschwundenen Getreidezeit. Man wird also ohne Zweifel ein chemisches Präparat schaffen und statt, wie einst, Brot vom Bäcker zu holen nur Pillen und Tabletten vom Apotheker beziehn, wird es endlich so weit gebracht haben und den natürlichen Brotbedarf auf ein Jahr als künstliches Surrogat in einer Kapsel dosiert einstecken können. Durch diese ungemein praktische Ernährung aus Brandpilzextrakten kommt es aber dann im Laufe der Zeit, wie wir bald sehn werden, mit dem Menschengeschlecht zur selben Reinkultur, die unser JOHANN AUGUST APEL in der fünften Szene seiner Zauberliebe schon recht vorausgemeldet hat:
Auch hab' ich gebraut aus aller Kraft
An dem neuen köstlichen Wundersaft,
Aus Spinnenfett und Milch von Kröten,
Jegliche Liebe damit zu töten.
Wer's getrunken, dem wird alles gleich,
Er zählt sein Geld auf des Bruders Leich,
Sieht Menschen und Vieh gelassen schlachten,
Verkrummen, verkrüppeln und gar verschmachten.
's ward sonst aus fremdem Land gebracht,
Wir haben's seit kurzem erst nachgemacht. –
Bei der letzten Äon von zehn Jahren entspricht ein Jahr unserem heutigen Abschnitt von zehn Jahren, deren zehn das gehörige Alter ausmachen, wie es Inder und Griechen (so noch ARTEMIDOROS DALDIANOS II 70) zu hundert Jahren ansetzten. In unserem obigen Fall ist aber die höchste Grenze zehn Jahre, so daß der landläufige Durchschnitt weit darunter bleibt, also eine Generation, wie wir sagen, nur etwa drei Jahre währt. Der Biologe K.E. VON BAER hat einmal die Hypothese von einem Minutenmenschen aufgestellt, dessen Lebensalter ungefähr dreiviertel Stunden dauern würde, der aber mit seinem millionenmal rascheren Pulsschlag in seinem Leben die selbe Anzahl von Sinneseindrücken und Erfahrungen wie wir hätte: vergl. Anm. 284. Die Annahme einer dreijährigen Generation ist damit, wie man sieht, noch tief unterboten; sie wäre demnach naturwissenschaftlich durchaus nicht undenkbar. Wie richtig der Inder übrigens die Relativität aller Zeitbegriffe schon erkannt hatte, zeigt sich auch daran, daß er das Nu oder den kleinsten Zeitteil auf die verschwindende Maßeinheit eines aṇu und paramaṇu gebracht hat, eines Bruchteilchens, das etwa einer vierzigtausendstel Sekunde gleich ist, Yogasūtram I 40 etc. Diese halb mythische halb mathematische Erkenntnis [810] war bereits dem Philosophen von Ferney vor 150 Jahren aufgegangen, als er am Ende seiner indischen Novelle »Le Blanc et le Noir« die Meinung vertrat, daß Brahmā alle Ereignisse der Völker, die sich, der Annahme nach, in geschichtlichen Erinnerungen über 800000 Jahre erstrecken, ebenso leicht in den Zeitraum einer Stunde zusammenziehn kann wie wir sie im Verlauf derselben Zeit in einem Abriß durchlesen können. Es ist klar, schließt dann der damals schon so wundersam tief erfahrene Freund indischer Anschauungen, daß sich alle Ereignisse, vom Beginn der Welt bis zu ihrem Ende, der Reihenfolge nach in einer viel kürzeren Spanne Zeit abspielen können als es der hunderttausendste Teil einer Sekunde ist. – Die kantische Lehre von der Idealität der Zeit hatte also hier zugleich ihren mächtigen Schatten 17 Jahre vorher gezeigt.
Jene Welt der Knirpse und Alberiche aber ist längst schon in der Ilias III 6 mit den ανδρασι Πυγμαιοισι angedeutet. STRABON bezieht sich darauf, Geograph. II 70, wo er etwas auch über diese Wichte nach KTESIAS und anderen spricht und sie als in Indien eingeboren und drei Spannen hoch angibt, τρισπιϑαμους. In SCHWANBECKS Ausgabe der Bruchstücke des MEGASTHENES, Bonn 1846, ist p. 65 das indogriechische Verhältnis unserer bösartigen Fäustlinge besprochen. Der älteste schwach geschichtliche stark fabelhafte Bericht ist der des KTESIAS, der in Persien ein paar indische Legenden über sie nach Hörensagen aufgezeichnet hat, ungefähr um dieselbe Zeit als unser Text oben seine letzte Gestalt erhielt, gegen Ende des fünften Jahrhunderts vor Chr. Die Angaben des wackeren Reisenden sind auf ihre teilweise Glaubwürdigkeit am besten von KARL MÜLLER untersucht worden, CTESIAE etc. fragmenta, Paris 1862, p. 94 b u. 105 a, wo die Bemerkung des GELLIUS IX 4 angefügt ist, die Pygmäen lebten im äußersten Indien und erreichten höchstens eine Größe von 21/4 Fuß. Weiter sodann gehört noch dazu wie PHILOSTRAT als Dichter sehr geistvoll die Begegnung des Herakles mit den Pygmäen behandelt, im 2. Buch der Eikones, Pariser Ausgabe 1608 fol. 816f., unverkennbar das Vorbild von SWIFT. Besonders merkwürdig aber paßt die Erdgeschichte und Devolution GRACIANS hierher, im Criticón II 2, mit dem Ergebnis, »que vàn degenerando los hombres, y siendo mas pequeños, quanto mas và: de suerte, que cada siglo merman un dedo, y a este passo vendràn à parar en titeres, y figurillas, que ya poco les falta à algunos; sospecho, que tambien los coraçones se les vàn achicando«, sowie natürlich die Schilderung, die der Philosoph von Brobdingnag entwirft, nach dem Zeugnisse Gullivers im 7. Kapitel, wo er versichert, »that nature was degenerated in these latter declining ages of the world, and could now produce only small abortive births, in comparison of those in ancient times.« Der Philosoph dort hatte wohl ebenso scharfsinnig dieses heiklige Verhältnis der Entwicklung ausgefunden, wie der Astronom von Laputa, im 3. Kapitel, auch schon vor der späteren Bestätigung die beiden Marsmonde genau berechnet und entdeckt hatte, und wie auf der letzten dieser denkwürdigen Reisen sogar die jetzt erst bei unseren Pferden erforschte höhere geistige Vorstufe zur gesteigerten Wesenleiter an den Houyhnhnms längst beobachtet worden war. Bei uns in Steiermark heißt es nach einer Sage, daß die Leute immer schlechter und schlechter werden bis zum Weltuntergang. Es wird schreckliche Verwirrung und Verwüstung sein, der eine wird sich über den anderen erheben, jeder wird herrschen wollen und keiner gehorchen, und die Menschen werden durch Krankheiten und Seuchen dahinsterben wie die Mücken. »Dann wird Kaiser Friedrich mit seinen Leuten kommen und den Krieg anfangen, in dem mehr als die Hälfte der Menschen umkommen werden. Ein Bauer wird beim Schloßberg (in Graz) vorbeifahren, schnalzen, und rufen: Da is amol die Grazerstadt g'standen'«: [811] VERNALEKEN, Mythen und Bräuche des Volkes in Österreich, Wien 1859, S. 120. – Umfängliche Erörterungen über die denkbaren Grenzen der menschlichen und überhaupt planetarischen Lebenserscheinungen und Lebensbedingungen nach abwärts wie auch wieder empor sind zur 14. Rede, in Anm. 284 gesammelt. KANT hat im Anhang zur Allgemeinen Naturgeschichte und Theorie des Himmels diese Art von Betrachtung insbesondere auf »die Bewohner der Gestirne« erstreckt, nämlich der entfernteren Planeten, und hat aus wohlgeprüften Erwägungen angenommen, die Wesen dort könnten dauerhafter entwickelt sein und ein weit höheres Lebensalter als wir auf der Erde erreichen, »so wie die Hinfälligkeit des Lebens der Menschen ein richtiges Verhältnis zu ihrer Nichtswürdigkeit hat.« Dann aber bringt ihm der Anblick des bestirnten Himmels in einer heiteren Nacht, bei der allgemeinen Stille der Natur, eine unnennbare Sprache zum Bewußtsein, mit Begriffen, »die sich wohl empfinden, aber nicht beschreiben lassen.« Und er schließt die ganze Betrachtung in einer Weise ab, die der gotamidischen Welterkenntnis auch hier wieder erstaunlich gemäß ist, indem er die Antithese aufstellt: »Wie unglücklich ist diese Kugel, daß sie so elende Geschöpfe hat erziehen können? Wie glücklich aber ist sie andererseits, da ihr unter den allerannehmungswürdigsten Bedingungen ein Weg eröffnet ist, zu einer Glücksäligkeit und Hoheit zu gelangen, welche unendlich weit über die Vorzüge erhaben ist, die die allervortheilhafteste Einrichtung der Natur in allen Weltkörpern erreichen kann.«
804 sālimaṃsodanam, sālimaṃsodano, ein Mus von saftigem Reis; sālimaṃsam ist der edle, großkörnige Reis, dessen Körper fleischig genannt wird, im Gegensatz zur dürren kleinhülsigen Reisfrucht: diese muß zur richtigen Musbereitung erst fein zerrieben werden und heißt dann odanamiñjā, odanamiñjam, Mus von Reismark oder markigem Reis. An Fleisch oder Mark von Tieren, wie man vermeint hat, ist hier natürlich ebensowenig zu denken, als wenn bei uns etwa von einer saftigen fleischigen Birne oder von markigen Kartoffeln die Rede ist. Zu odanamiñjā cf. Majjhimanikājo, ed. Siam. II 519. Über die Reisbereitung und die Tunke dazu und dergl. m. ist das nähere in Anm, 552 angegeben.
805 S stets pūjā; es ist pujjā als Variante weniger gut, da pūjā = pūjyāḥ nähersteht. Der folgende sambhedo wäre wörtlich durch Kommunismus wiederzugeben, insofern man darunter Weibergemeinschaft versteht; ohne Scheu der freien Liebe zu pflegen, d.i. nach Viehes Sitte sich zu begatten, wie es der Text oben angibt; und wie es, am fahlen kahlen Morgen, die entrauschte Dido auch nicht anders in der Erinnerung fühlt: vitam degere more ferae, Aeneis IV 550f. – Die obige Schilderung im Text ist völlig identisch wiederzufinden, Punkt um Punkt zutreffend, in der hier nochmals zu nennenden Storia del genere umano LEOPARDIS, gegen Ende, wo scheinbar alle Menschen auf Erden in ein einziges Volk und Vaterland aufgehn, »in una sola nazione e patria«, wirklich aber nunmehr bei solcher grenzenlosen Egalität und Verluderung ein jeder alle anderen haßt und nur sich selbst liebt: genau wie es in der Smṛti, z.B. im Mahābhāratam gegen Ende des dritten Buches, ausführlich dargestellt ist als ekavarṇas tadā loko bhaviṣyati yugakṣaye, »eine einzige Kaste wird dann die Welt sein, im Verfall der Zeiten«; insbesondere noch weiter gezeigt im Harivaṃ am, im letzten Teil, der Bhaviṣyaparva, Buch der Zukunft, heißt. Das dritte und vierte Kapitel dort ist geradezu als eine Bearbeitung des Abschnitts unserer obigen Rede zu erkennen, mit den deutlich anklingenden Ausdrücken, Aussagen, Wendungen, svarakṣaṇaparāyaṇāḥ, caurayānāḥ parasparaṃ, brahmadūṣaṇatatparāḥ, etc., āyus tatra ca martyānāṃ paraṃ triṃ ad bhaviṣyati, und dann wieder der Aufstieg zu besseren, edleren Epochen, im immer [812] wechselnden Wandel der Zeiten, usw. usw. Das große Sagen- und Sammelwerk Harivaṃ am hat hier zwar aus einer allgemein volkstümlichen Quelle geschöpft: aber daß diese doch schon an der buddhistischen Wasserscheide lag und auch von ihren Zuflüssen gespeist wurde, zeigt Vers 15 des 3. Kapitels durch die Bemerkung ūdrā dharmaṃ cariṣyanti, ākyabuddhopajīvinaḥ, wo also die Nachfolge der Tiefstgeborenen als Jünger des Sakyerasketen zur Kennzeichnung der argen Zeit mitverwendet wird. Für uns doppelt lehrreich: die Smṛti kennt die buddhistisch weitergebildeten Sagen und macht, wenn auch von ihrem Standpunkte natürlich polemisch, kein Hehl daraus. Das Schema von den Weltperioden ist sicher auch in Indien seit alter Zeit überliefert, da es durch die Inschriften Asokos als damals schon allbekannt bestätigt wird; wozu man in der Anm. 714 die Nachweise findet. Wie eine Zusammenfassung solcher Anschauungen aus weiter Vergangenheit, mit wenigen kräftigen Strichen al fresco entworfen, frei entwickelt und dabei merkwürdig ähnlich, führt uns OVID im ersten Buch der Metamorphosen das Eiserne Zeitalter vor, v. 127-150. Da ist omne nefas, fugere pudor, verumque fidesque, es herrscht nur amor sceleratus habendi,
Vivitur ex rapto, non hospes ab hospite tutus,
Nec socer a genero, fratrum quoque gratia rara est.
Imminet exitio vir coniugis, illa mariti,
Lurida terribiles miscent aconita novercae,
Filius ante diem patrios inquirit in annos.
Victa iacet pietas, et virgo caede madentes
Ultima coelestum terras Astraea reliquit.
Und er kommt der furchtbaren Anschaulichkeit des Messerstichalters, am Ende unseres Absatzes im Text oben, ganz nahe Ep. ex Ponto I 3, 57:
Hostis adest dextra laevaque a parte timendus,
Vicinoque malo terret utrumque latus.
Nicht von Mythen, nur vom Alltag seiner Zeit ist SENECA ausgegangen, wenn er im 107. Briefe sagt, es sei der Mensch verderblicher als alle Bestien, homo perniciosior feris omnibus. Auch SCHILLER hat in der Epoche der Liberté, fraternité, égalité das selbe erlebt und darum die geflügelten Worte gesprochen, die man trefflich als Motto unseren obigen Ausführungen voranstellen könnte:
Nichts Heiliges ist mehr, es lösen
Sich alle Bande frommer Scheu;
Der Gute räumt den Platz dem Bösen,
Und alle Laster walten frei.
Gefährlich ist's, den Leu zu wecken,
Verderblich ist des Tigers Zahn;
Jedoch der schrecklichste der Schrecken,
Das ist der Mensch in seinem Wahn.
Über diesen natürlichen Zustand der Menschengemeinschaft hat KANT in der Kritik der Urteilskraft § 63 einige Bemerkungen angebracht: »vernünftige Thiere«, nennt er da die Menschen, »in wie niedrigem Grade es auch sei«; es sind »gewisse armselige Geschöpfe«, die sich im fortwährenden Kampf um die Lebensnotdurft bis nach Grönland, Sibirien usw. verbreitet haben: und dies kommt daher, daß »nur die größte Unverträglichkeit der Menschen unter einander sie bis in so unwirthbare Gegenden hat [813] versprengen können.« Ausführlicher stellt er dann den teleologischen Zusammenhang in § 83 dar, wie die Natur den Menschen »in ihren verderblichen Wirkungen, in Pest, Hunger, Wassergefahr, Frost, Anfall von andern großen und kleinen Thieren u.d.gl. eben so wenig verschont, wie jedes andere Thier; noch mehr aber, daß das Widersinnliche der Naturanlagen ihn selbst in selbstersonnenen Plagen, und noch andere von seiner eigenen Gattung, durch den Druck der Herrschaft, die Barbarei der Kriege u.s.w. in solche Noth versetzt und er selbst, so viel an ihm ist, an der Zerstörung seiner eigenen Gattung arbeitet, daß selbst bei der wohlthätigsten Natur außer uns, der Zweck derselben, wenn er auf die Glückseligkeit unserer Species gestellet wäre, in einem System derselben auf Erden nicht erreicht werden würde, weil die Natur in uns derselben nicht empfänglich ist.« So wird man denn freilich zugestehn müssen, daß das gegenseitige Verfolgen und Vertilgen, wie es im Text oben gezeigt ist, nicht auf das kurze Messerstichalter beschränkt, vielmehr jederzeit Kennzeichen des Weltgeschehns ist. Das wird gut im Hitopade as I 6 veranschaulicht, wo ein Jäger ein Reh erlegt und weiterhin einen Eber anschießt: der aber stürmt noch im Todeskampf auf ihn los und schlitzt ihm den Bauch auf, so daß nun alle drei hingestreckt daliegen. Das sieht von ferne ein Schakal, freut sich der großen Beute, und herangeschlichen beginnt er, um den gewaltigen Vorrat an Aas vernünftig auszunützen, zunächst die Bogensehne des Jägers zu benagen; da schnellt nun der gelöste Bogen ihm ans Herz, und auch er fällt tot hinzu, wieder als Speise für andere. Schön kommt der gleiche Gedanke auch in LENAUS »Die Drei« zur Geltung, wo drei Reiter nach verlorener Schlacht langsam dahintraben: aus ihren tiefen Wunden quillt das Blut, tropft von Sattel und Zaum herab; sie sehn sich traurig an, der eine spricht von der schönsten Maid, die ihn daheim erwartet, der andere von Haus und Hof, die er lassen muß, der dritte, daß er nichts habe als den Blick in Gottes Welt, und daß ihn das Sterben doch schwer gemute.
Und lauernd auf den Todesritt
Ziehn durch die Luft drei Geier mit.
Sie teilen kreischend unter sich:
»Den speisest du, den du, den ich.«
In solchen Bildern ist das Dasein überhaupt gezeigt, die hungrige Welt, wie sie SCHOPENHAUER nennt, wo zahllose millionen lebender, aber geängstigter und gequälter Wesen nur dadurch eine Weile bestehn, daß eines das andere auffrißt, Parerga II § 69. Die Parabel aus dem Hitopade as ist als »ein frappanter Vorwurf für einen Maler« im Nachlaß, ed. GRISEBACH § 473, verkürzt wiedergegeben. Auch sei noch erinnert an Hamlets ironisches Wort vom Gastmahl des Polonius, IV 3, 18ff., nicht wo er ißt, sondern wo er gegessen wird: eine gewisse Einberufung von gemeinsinnigen Würmern hat eben bei ihm statt; als Tauschverhältnis und Wechselbegriff unsterblich auf die gleiche Weise humorisiert von Gotamo mit dem Wort von der »Nächstenspeise«, parabhattam, dem »Mahl für andere«, Saṃyuttakanikāyo vol. III p. 143, übersetzt in meiner Buddhistischen Anthologie [Band III, S. 938], und Lieder der Nonnen v. 469.
806 Mit S etc. yāpessanti.
807 Mit S Diṭṭhā bho sattā jīvasi, tvaṃ diṭṭhā bho sattā jīvasīti.
808 Außer diesen drei Seuchen oder Krankheiten keine anderen, im Gegensatz zur Zeit des Redners, wo es nämlich deren achtundneunzig andere noch gibt: Bruchstücke der Reden v. 311; Anguttaranikāyo X No. 60. Su rutas, der Ahnherr und Asklepios der indischen Medizin, behandelt demgemäß in seinem immer noch lebensfrischen āstram [814] die gesamte Heilkunde nach einem ähnlichen Schema, indem er alle Krankheiten in hundertzwanzig Abschnitte einreiht, wobei er Methode und Systematik mit glücklichstem Erfolge durchführt und den ungeheuren Stoff unter den Haupttiteln der Anatomie und Embryologie, Chirurgie und Pathologie, Therapie und Toxikologie, Diätetik und Hygiene darstellt. Ein kurzer Überblick in JOLLYS Medizin, BÜHLERS Grundriß der indo-ārischen Philologie, Straßburg 1901, III. Band 10. Heft § 8. Man beachte auch Lieder der Mönche v. 756f. – Die drei Seuchen oder Grundgebresten der Menschheit: Begierde, Hunger, Greisentum, scheinen wie bei uns oben auch im Rāmāyaṇam, Uttarakāṇḍe 5, 7, so verstanden zu sein: trayo ghorā ivāmayāḥ. Die beiden ersten hat SCHILLER sehr wohl erkannt, im ironischen Gedicht über die Weltweisen, wo er damit abschließt, daß die Natur den Bau und Bestand der Welt verbürgt: sie erhält das Getriebe
Durch Hunger und durch Liebe.
Die drei Erzübel, die τρια νοσηματα, die PLATON (Leg. 782/3) als Hunger, Durst und Geschlechtstrieb kennzeichnet, mochte der Dichter füglich in zwei zusammenfassen, wie er sie als die Springfedern des Perpetuum mobile wahrnimmt, der leidigen Verkettung, die nie abbricht, nie abläuft, immerdar »ganz erträglich schlecht« geht. – Hunger, anasanam, wörtlich: Nichtessen, Fasten, das ist Hungerleiden; daher das bekannte ana anavratam, das Gelübde des Hungerns, bei vedischen Priestern und Büßern. Der »Dīghanikāya« des R. OTTO FRANKE, Göttingen 1913, S. 269, hat dieses anasanam, Hungern, in »Appetitlosigkeit« verwandelt: nur als Folge übersetzerischer Verdauungsbeschwerden erklärbar. Plus stomacho quam consilio dedit.
Im Anguttaranikāyo, Sattakanipāto No. 70, ist im Verlauf einer ähnlichen mythischen Episode für die tiefere Äon der sechzigtausendjährigen Menschen eine etwas andere Einteilung, in sechs Seuchen, gegeben: Frost und Hitze, Hungern und Dürsten, Koten und Harnen. Um diese Zeit, heißt es da, wird schon ein Meister, Arako mit Namen, seine Jünger so belehrt haben: Kurz ist das Leben der Menschen, von spärlicher, geringer Dauer, voller Leiden, voller Qualen. Man muß nachdenken lernen, muß günstig wirken, vollenden muß man als Asket, kein Leben gibt es ohne Tod. Und er vergleicht schon damals das Dasein des Menschen einem Tautropfen am Grashalm bei Sonnenaufgang, der sich alsbald verflüchtigt, einer Wasserblase im Gischt des aufklatschenden Regens, einer Ringwelle, die ein Stab im Teiche zurückläßt, einem Strom, aus Gebirgsklüften entsprungen, der seine reißenden Fluten immer forttreibt und keinen Augenblick, kein Weilchen, kein Nu beharrt, nur dahinstürzt, dahinstürmt, dahineilt, usw.; also ganz so wie uns von HERAKLIT eben dieses Gleichnis, sogar dreimal gebraucht, überliefert wird, am besten vielleicht in der letzten Fassung: In dieselben Ströme steigen wir und steigen nicht – wir sind und sind nicht: bei Mullach, Fragmenta philos. Graec. vol. I p. 326 No. 83 (317 No. 21f.). So beginnt denn auch FRANCISCO DE RIOJA das »Soneto à la fugacidad del tiempo«: Como se van las aguas de este rio | Para nunca volver, asì los años; und GOETHE sagt: in dem selben Flusse | Schwimmst du nicht zum zweitenmal.
Über Krankheit im allgemeinen spricht Gotamo kurz folgendermaßen, Anguttaranikāyo, Catukkanipāto No. 157 (ed. Siam. p. 196): »Zwei Arten von Krankheit, ihr Mönche, gibt es: und welche zwei? Körperliche Krankheit und geistige Krankheit. Man findet, ihr Mönche, Wesen, die sich von körperlicher Krankheit ein Jahr hindurch frei halten mögen, auch zwei Jahre, auch drei, vier, fünf Jahre hindurch, auch zehn, zwanzig, dreißig, vierzig, fünfzig Jahre, die sich sogar hundert Jahre und darüber von körperlicher [815] Krankheit frei halten mögen. Aber schwerlich, ihr Mönche, sind Wesen in der Welt anzutreffen, die sich von geistiger Krankheit auch nur einen Augenblick frei halten können, es seien denn Wahnversiegte.« Zusammengefaßt im Saṃyuttakanikāyo, zu Beginn des dritten Bandes: »Wer sich mit diesem Körper herumtragend auch nur einen Augenblick für gesund halten möchte, wie wär's anders als aus Torheit?« Hieran schließt sich das Gespräch mit der Darstellung der Gesundheit als des höchsten Gutes in der 75. Rede der Mittleren Sammlung, 544-547: einer Gesundheit, die freilich mit der Welt nichts mehr zu schaffen hat. Denn wie ein Blindgeborner von einem Feinde schrecklich getäuscht werden kann, wird der gewöhnliche Mensch von diesem Leibe schrecklich getäuscht, als ob etwa an dem auch nur irgendetwas nicht bresthaft wäre; recht wie Meister ECKHART erkannt hat: »was an dir und in dir ist, es ist alles gar siech und verdorben«, ed. PFEIFFER p. 561; oder wie KANT einmal, wunderbar tief, gesagt hat, daß »jedes Gefühl überhaupt pathologisch« ist, Kritik der praktischen Vernunft I, 1 3, 1. Aufl. S. 133. Wenn wir also hier zu dem Ergebnis gelangen »Leben ist Krankheit«, so ist das zugleich Ergebnis der neuen Diagnostik »Krankheit ist Leben«, gegenseitig gültig, je nach dem Standpunkte: VERWORN, Kausale und konditionale Weltanschauung S. 31f. Und was wir Lebensgefühl nennen ist eigentlich nach der berühmten Definition im Macbeth III 2, 21-23, nichts anderes
Than on the torture of the mind to lie
In restless ecstasy. Duncan is in his grave;
After life's fitful fever, he sleeps well.
Das meint eben nur der grausige Macbeth, könnte man da einwenden: aber der zarte METASTASIO hat es mit dem gleichen schneidenden Klarblick durchschaut, als er in einem Sonett, geschrieben zu Wien 1733, sagte:
Tutto è menzogna, e delirando io vivo:
Alles ist Lügenwerk, und Fieberwahnsinn was ich lebe.
Bei jener Darstellung nun in der 75. Rede der Mittleren Sammlung, wo Gotamo seine Lehre bis zur verborgensten Faser deutlich macht, erhält erst GOETHES Hallenser Prologfrage
Ist nicht Gesundheit allen uns das höchste Gut?
die letzte gültige Antwort. Wohl könnte man hier noch entgegnen: alle Welt für krank erklären und nur sich für gesund halten ist eine sattsam bekannte Erscheinung des Wahnsinns. Es gibt ja
so manchen Schwärmer zu schauen,
Der sein luftig Gespinst mit der soliden Natur
Ewigem Teppich vergleicht, den echten, reinen Gesunden
Krank nennt, daß ja nur er heiße, der Kranke, gesund.
Ganz recht: auch der Wahnsinnige meint, nur er sei geistig gesund und jeder andere verrückt. Die Frage ist jedoch, ob er sich dabei vollkommen wohlfühlt. Mit anderen Worten: es kommt nicht auf das Rechthaben an. Dies und das Grübeln darüber, gewöhnlich Philosophie genannt, hat Gotamo abgelehnt. Ob also einer für geisteskrank oder geistesgesund zu gelten habe, wäre somit nicht nach seiner Betrachtung der Dinge auszumachen, da diese immer nur auf bloße Wortunterschiede hinausläuft; wirklich aber handelt es sich darum, ob er ein Mensch ist, »der ohne Selbstqual, ohne [816] Nächstenqual schon bei Lebzeiten ausgeglüht, erloschen, kühl geworden ist, sich wohlfühlt, heilig geworden im Herzen«, Mittlere Sammlung, Ende der 51. Rede: wobei ein weiteres Behaupten und Bestreiten, alles fernere Vermeinen der neunmal Weltweisen sich erledigt, und ihnen der »stille Denker« der 140. Rede (S. 1031) nichts anderes sein kann als ein stiller Narr.
809 Zu avīci maññe, »ohne kahle Stelle, so zu sagen«, die Parallele im Anguttaranikāyo, ed. Siam. I 103, Tikanipāto No. 56. Etymologisch entspricht avīci a-vice, sine vice, ohne vice versa, d.i. ohne Wechsel von voll und leer, ohne Zwischenraum gepfropft. Auf diesem Begriff der Enge, hier noch nichts anderes als strotzende Fülle bezeichnend, ist in späterer Zeit der gegensinnige einer qualvollen Bedrängnis, einer Hölle Avīci entstanden, in purāṇischen Legenden, so auch der Mahāvīcis oder Große Höllenrachen bei Manus IV 89 usw. In PORSONS launiger Ballade »The Devil's Walk«, des Teufels Spaziergang, womit die Welt gemeint ist, wird eine verwandte Anschauung vermittelt: der Böse macht sich auf,
To visit his snug little farm of the earth,
And see how his stock goes on.
Das aber ist eben Māros Bereich, das in dichtester Fülle hart aneinandergedrängte Leben, von dem auch Mephistopheles als wie von seiner Avīci-Hölle spricht, Faust 11652f.:
In Winkeln bleibt noch vieles zu entdecken,
So viel Erschrecklichstes im engsten Raum!
Unsere Stelle oben gibt ein vorgeschichtliches Volksempfinden wieder, als üppige Fülle wie einst bei den vedischen Vorvätern noch nicht leidig befunden war. Gotamo selbst deutet, in den Bruchstücken der Reden v. 706, die Welt schlechthin als »diese Hölle« an.
810 Reinhold, Sankho, eigentlich: so rein wie die Muschel, insbesondere die sogenannte Pilgermuschel. Vergl. Mittlere Sammlung Anm. 451 Ende.
811 Die hier angeführte Verkündigung Metteyyos soll Gotamo, der Legende nach, in der Umgebung von Takkasilā, dem Taxila der Griechen, ausgesprochen haben: im Gedenken daran hat Asoko dort auf einem steilen Felsenkegel, heute Srikot genannt, ein etwa dreißig Meter hohes Kuppelmal errichten lassen, dessen Wahrzeichen weithin in der Runde über die blühenden Wiesen und Felder emporragt. HIUEN-TSIANG hat das Denkmal in gutem Zustande gesehn und beschrieben, in späterer Zeit scheint es restauriert und wieder verschlossen worden zu sein, jetzt ist nur die Ruine übrig. CUNNINGHAM hat die Reste entdeckt, nachgemessen und einen Abriß gegeben, Archaeological Survey of India vol. II p. 139-141 und Tafel IX. Mit den Meistern der Vorzeit und Gotamo ist Metteyyo sodann auf einem Fresko zu Ajaṇṭā, über dem Eingang zur 17. Felsenkammer, als der künftige Heiland dargestellt. Ein künstlerisch wertvolles Bildnis aus Kupfer, vom Kuppelmal bei Sopārā, ist in Anm. 285 besprochen. Beachtung verdient auch die Inschrift am Tempel von Buddhagayā, auf der ein barmanischer König des 13. Jahrhunderts kundgibt, daß er ebendieses Denkmal, auch einst von Asoko errichtet und nun verfallen, wiederherstellen habe lassen, und dann seine Urkunde mit dem Herzenswunsche besiegelt: »Möchte dieses verdienstliche Werk mich der Wahnerlöschung näher bringen, möchte ich ein Jünger Metteyyos werden, des künftigen Erwachten!«, von TAW SEIN κο veröffentlicht in der Epigraphia Indica vol. XI p. 118-120. Wie das Volk im Inneren von Zeilon heute noch ebenso [817] auf Metteyyo Bezug nimmt, ist in der Mittleren Sammlung Anm. 261 berichtet. Es zeigt sich da eine Gesinnung, die lebhaft an die letzten Worte PLATONS erinnert, die PLUTARCH gegen Ende seiner Biographie des MARIUS anführt. Am öftesten wird Metteyyo in den Apokryphen genannt, so Mahāvastu III 240, etc. In der Aṣṭasāhasrikā prajñāpāramitā schließt der 8. Abschnitt, der manche Stellen unserer Pāli-Texte, zumal aus der vorliegenden Sammlung, wörtlich wiederbringt, mit der Verheißung, daß dereinst auch Metteyyo (Maitreyas), in der unvergleichlichen vollkommenen Erwachung auferwacht, ganz wie jetzt Gotamo an ebendiesem Orte genau die selbe höchste Erkenntnis vortragen werde: asminn eva pṛthivīprade e enām eva prajñāpāramitām bhāṣiṣyate, ed. RĀJENDRALĀ LAMITRA, Bibliotheca Indica, Calcutta 1887, p. 199. Wenn im Wandel der Weltperioden erwachte Meister auftreten, so ist nämlich immer die Gangesebene der Schauplatz ihres Erscheinens. Es ist das im buddhistischen Kanon die Lehre von der ewigen Wiederkunft des Gleichen bis in die kleinsten Einzelheiten; bei uns, nach ZENON dem Stoiker, wiederum von NIETZSCHE übernommen. Diese Ansicht war in Indien vor zwei Jahrtausenden schon volkstümlich gewesen, da sie durch mancherlei Denkmale bezeugt ist. In den Nordwestlichen Provinzen z.B. besteht heute noch das Dorf Sankisa, vormals die Königsburg Sāṃkā yā des Rāmāyaṇam, Mitte des Wegs zwischen Mathurā und Sāvatthī; da liegen die Reste eines Kuppelmals, das, nach der Volksmeinung, an dem Orte errichtet war, wo im Laufe der Äonen die vier zuletzt erschienenen Meister geweilt hatten, Kakusandho, Koṇāgamano, Kassapo, Gotamo: immer an der selben Stelle, unter den selben Umständen, in die selbe Erkenntnis, Schauung, Erlöschung eingegangen. Die Auffindung dieser Stätte bei Sankisa ist 1842 CUNNINGHAM geglückt, der dann, nach wiederholtem Besuche und sorgsamen Ausgrabungen, noch die erste Erklärung und Skizze der Ruinen gegeben hat, Archaeological Survey of India vol. I, Simla 1871, p. 271-279. Unser Gedankengang oben im Text ist übersichtlich dargestellt im Register auf der Tafel »Ahnenreihe«. In den Liedern der Mönche v. 490 ist ein Spruch vorgetragen, der ebenso dem kommenden Metteyyo zueignet:
Den selben Weg, den einst gewandelt Vipassī,
Den selben Weg, den Sikhi kam und Vessabhū,
Kakusandho, Koṇāgamano, Kassapo:
Dieselbe, Bahn ist hingegangen Gotamo.
812 Mahāpanādo, der große Weitberühmte, war ein Kaiser in ferner Vergangenheit; vergl. Lieder der Mönche v. 163f.:
Panādo hieß der Kaiserherr,
Der goldne Burgen einst gebaut,
Mit sechzehn Sälen, Tor an Tor,
Auf tausend Erkern tausendfach, usw.
Er ist der siebente von den sechs unvergeßlichen Weltbeherrschern, deren Namen die Smṛti in dem Merkspruch aufbewahrt hat, erhalten im Subhāṣitārṇavas, BÖHTLINGK2 4830:
Māndhātā Dhundhumāra ca,
Hari candraḥ Purūravāḥ,
Bharataḥ Kārtavīrya ca:
ṣaḍ ete cakravartinaḥ.
[818] Diesem scheint dann der Spruch von den sieben Herrschern unserer 19. Rede nachgebildet zu sein, S. 343. Die interessanteste Gestalt unter ihnen ist Māndhātā, dessen Legende im zweiten Abschnitt der 1058. Anmerkung kurz ausgezogen ist. – Die oben im Text genannte Säule des großen Weitberühmten stand auch in dem »schönen, mit hunderten von Denkmälern und Säulen geschmückten Lande des wahrhaftigen Königs Bhīṣmas«, Mahābhāratam I 109, 13f.: eine Angabe, in der schon BÜHLER einen Beleg für das vorbuddhistische Alter solcher Kunstbauten erkannt hat, Epigraphia Indica II 313.
813 Idaṃ kho bhikkhave bhikkhuno āyusmiṃ richtig mit S. Zur Sache: Anm. 419. Dazu paßt wohl die Einsicht des POSEIDONIOS, die wir SENECAS Sammeltreue danken, in den lucilischen Briefen: Unus dies hominum eruditorum plus patet quam imperitis longissima aetas. Hier wie dort der selbe Gedanke, wechselseitig erläutert immer klarer und durchsichtiger verständlich geworden. Mit herüber sprüht es dann noch aus einem Sonett MICHELANGELOS auf:
Di morte certo, ma non già dell'ora.
Der Nachschein unserer oben vorgetragenen bedingten Wahlfolge, die ein Durchbestehn je nach Belieben mit ihrem Vorbehalt auch schon berichtigt, ist jedoch besser als irgendwo bei DUARTE DA GAMA, dem Zeitgenossen Dom VASCOS von Indien, wahrzunehmen, anders und einig zugleich:
As cousas d'aquesta vida
Todas vem a uma conta,
Poys vemos que tanto monta
Ser curta como comprida.
Was im Leben hier bestanden,
Alles eilt zur einen Wende:
Sehn wir doch das gleiche Ende,
Kurz wie lange, sicher stranden.
Zu weiterem Beleuchten, richtiger Durchleuchtung unseres Gedankenkreises taugen sehr gut die Strophen 110-115 des Dhammapadam, mit welchen man etwa noch den zehnfachen dhammapariyāyo aus dem Anguttaranikāyo, Dasakanipāto No. 58, vergleichen kann: »Im Willen wurzeln alle Dinge, durch Nachdenken kommen alle Dinge zustande, durch Berührung entwickeln sich alle Dinge, in Empfindung fließen alle Dinge zusammen, Einigung geht allen Dingen voran, der Einsicht sind alle Dinge untertan, Weisheit steht allen Dingen zuhöchst, Erlösung ist der Saft aller Dinge, in Unsterblichkeit tauchen alle Dinge ein, Erlöschung ist aller Dinge Ziel.« Die wichtige Stellung, die der Wille, chando, hier und im Text oben einnimmt, kommt auch im Chakkanipāto No. 86 zur Geltung, wo gesagt ist: wer den Ausgang zu erreichen sucht, der muß zuversichtlich, willenstark, chandiko, und gewitzigt werden. Vergl. noch insbesondere die 1015. Anmerkung.
814 Vāseṭṭho und Bhāradvājo sind die beiden befreundeten jungen Priester, von uradeliger Abkunft, von denen wiederholte Unterredungen mit Gotamo berichtet werden: so im 13. Stück unserer Sammlung, S. 167-180, im Gespräch über die drei Veden, und im 98. Stück der Mittleren Sammlung, 751-759, über die Kastenfrage, den Adel usw. – Die Bearbeitung und größtenteils wörtliche Übersetzung des 26. und vorzüglich dieses 27. Stücks unserer Sammlung in den Kreisen der hochasiatischen [819] Schulen von Nepāl, Tibet und China ist in der 802. Anmerkung gewürdigt worden.
815 Diese feindliche Gesinnung der Priester gegen die Mönche wird wiederholt geäußert, auch Gotamo gegenüber: S. 60, Mittlere Sammlung 365 durch eine Reihe verächtlicher Gleichnisse noch verschärft. Der Hauptgrund ist der, daß man nach dem priesterlichen Gesetz verpflichtet ist einen Hausstand und Familie zu besorgen und erst in vorgerückten Jahren der Welt entsagen darf, Manus VI 1f. Daher lehren die Priester: »Wer im Hause bleibt kann Echtes erwirken, heilsames Recht; wer vom Hause fortzieht kann es nicht«, Mittlere Sammlung 760, nach Manus III 77f., VI 89f. gṛhastha ucyate reṣṭhaḥ, der Hausner ist der beste Stand. Gotamo dagegen preist Kampf und Askese in der glücklichen Jugend, in der ersten Mannesblüte, und hält nur wenig von alten Asketen, die da meist unwissend, ungeschickt, ungelehrig, mißmutig sind, Anguttaranikāyo, Pañcakanipāto No. 59f. u.a.m. Solche Erfahrung spricht auch DEMOKRIT aus: »Es hat mal ein Junger Verständnis, aber Alte verstehn nichts: denn zur Einsicht erzieht nicht die Zeit, sondern gehörige Pflege und Angewöhnung«; DIOGENES hat kurz gemeint: »Einem Toten Arzenei und einem Alten Belehrung geben ist eins«, MULLACH, Fragm. philos. Graec. I 349 No. 139; II 302 No. 36. SEUSE, der milde, immer gütige, sagt: »Wer aber heut unbereit ist, der mag morgen viel unbereiter sein: je älter, je zäher. Man findet viel mehr, die sich späterhin bösern als die sich bessern«, ed. BIHLMEYER p. 445. Zu dieser geistigen und geistlichen Erfahrung gibt aber der würdige Dogberry die Erläuterung, ganz natürlich begründet: »When the age is in, the wit is out«, Much Ado III 5 i.f. Ein alter Priester, der auf seine Abstammung sich was einbildet und dabei unwissend geblieben ist, wird sogar in der Smṛti nur als ein bhovādī bezeichnet, z.B. Harivaṃ am III 3, 13: ein Epitheton, das man noch mit KANTS »Jaherr«, Anthropologie § 85, zutreffend wiedergeben kann. – Bei bandhupādāpacco ist es nach oberflächlicher Betrachtung recht verlockend an das Ṛkmantram X 90 12 zu denken: padbhyāṃ ūdro ajāyata, worauf sich wirklich Buddhaghoso besonnen zu haben scheint, obzwar ungenau und mangelhaft: siehe RHYS DAVIDS, Dialogues of the Buddha, London 1899, vol. I p. 112 n. 1 und die dementsprechende Wiedergabe »offscouring of our kinsman's heels«, sowie R. OTTO FRANKE, Dīghanikāya, Göttingen 1913, der dann gläubig nachspricht »Abkömmlinge aus den Füßen des Verwandten«, bald auch »Abkömmlinge aus dem Fuße des Verwandten«, oder auch »Abkömmlinge aus den Füßen unseres Stammvaters«, S. LV, 91, 274. Diese kasuistische Auffassung scheint aber ungehörig zu sein, weil dem in unserem Text vorangehenden brahmajā doch wohl ein brahmapādāpacce nachfolgen müßte, wenn auf den vedischen Ausdruck Bezug genommen wäre. Es heißt eben bei uns bandhupādāpacce, und bandhu kann da nur als Genosse, Geselle gemeint sein, eine Gesellschaft von Asketen, wie verächtlich gesagt wird, wo ein solcher Geselle immer den Fußstapfen eines anderen nachfolgt, »einer dem anderen auf den Fersen folgt.« Der höchst seltene Umstand, daß der Kommentator auch einmal etwas Vedisches weiß und es anbringen will, ist also leider gerade hier fehl am Ort. Der bloße Gleichklang hat ihn irregeleitet. Es ist ungefähr so wie a vaḥ, asso im Siṇhalesischen zu as wird und doch nicht = assa, ass, Esel, sondern Pferd ist. Im 2. Kapitel der Buddhaghosuppatti, der Lebensbeschreibung Buddhaghosos, ed. GRAY p. 42, wird erzählt, daß der große Gelehrte in seiner Jugend als Brāhmanenschüler täglich sechstausend vedische Worte auswendig gelernt habe; nur hat er sich leider dann später, wie auch dieser Fall wiederum zeigt, auf das zugehörige nicht mehr besonnen, müssen wir ergänzen.
816 Vergl. die näheren Ausführungen im Gespräch mit Assalāyano, Mittlere Sammlung S. 709-716.
[820] 817 Zu byokiṇṇo (vokiṇṇo), wie S richtig hat, durcheinandergemischt, cf. unsere 15. Rede S. 226.
818 Mit S so nesam aggam akkhāyati.
819 Richtig mit S Sakyā kho pana Vāseṭṭhā rañño Pasenadissa Kosalassa anantarā (sic) anuyantābhavanti. Über die Geschichte der Sakyer spricht Gotamo in der 3. Rede, 61f. dem jungen Ambaṭṭho gegenüber recht ausführlich, ganz kurz, aber einzig großartig, vor König Bimbisāro, Bruchstücke der Reden v. 422f. Die Sakyer waren Landesfürsten, nicht Könige im eigentlichen Sinne, nur Allodialherren auf ihrem Grund und Boden, die zugleich die Feudalpflichten kosalischer Gefolgschaft übernommen hatten: was auch aus unserer Stelle oben im Text hervorgeht. Sie leisteten wohl dem angrenzenden mächtigen Kosalo Heeresfolge, blieben aber dabei unmittelbare Reichsfürsten, als die eingebornen Edlen, Besten, āryās, αριστοι, nobiles, optimates, auf ihren Stammburgen in Kapilavatthu, Metāḷumpan, Devadaham in den Vorbergen des Himālayo, deren Mauern und Trümmer heute im südöstlichen Nepāl teils gefunden, teils noch zu suchen sind. Mehr als unabhängig herrschende Fürsten wollten sie nicht sein: sie waren rājaññā, rājanyās, Kriegerfürsten, die in niemandes Lehen standen, und die ihren Besitz, wie auch bei uns in alter Zeit das Wort dafür war, als Sonnenlehen betrachteten. Der junge Gotamo spricht daher also zu Bimbisāro, dem König von Magadhā, Bruchstücke der Reden v. 423:
Vom Sonnenstamme stamm' ich ab,
Ein Sakyer bin ich von Geburt:
Ich habe solchem Haus entsagt,
Genießen, das begehr' ich nicht.
Und dieser Ausdruck erinnert in gewisser Weise an jenes ruhmvolle bretonische Fürstengeschlecht, das auch, ohne königliche Oberhoheit zu besitzen, frei und selbsteigen seinen Anteil im Landesgebiet einst beherrschte, und dessen Wappenspruch war:
Roy ne puys,
Duc ne daygne,
Rohan suys.
Der Ahnherr des Kriegerstamms der Sakyer, König Okkāko, hatte den Namen schon altererbt: Sakyer, die Gewaltigen, die Herren, ist Denominativum von 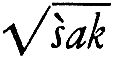 , akvan, mächtig sein, vermögen, akma, akti, Macht, Kraft; und er hat ihn dann zugleich, wie solche Dinge in Indien von den vedischen Meistern her beliebt waren, auch auf den schönsten stolzesten Baum des Himālayo bezogen, auf akas, Tectona grandis, die indische Eiche, wie man sagen könnte. Denn er hat seine Söhne, aus einem bestimmten Anlaß, einmal als sakkische Eichen, stolze sakkische Eichen gekennzeichnet, S. 61: ähnlich wie jene alten Pelasger, die einst an den Abhängen des Parnaß gesiedelt waren, nach der dort wachsenden Eiche, απο δρυος, Dryoper genannt waren, d.i. Eichner, eichenartige Leute. Wir haben ferner ein prächtiges Gegenstück bei robur, Macht, Kraft, das zugleich Kernholz bedeutet, insbesondere aber der Name der sehr harten Steineiche ist, der Quercus Robur; woher sich das kühne Kriegergeschlecht, dem der Mars- und Musenfreund Papst JULIUS II entsprossen war, DELLA ROVERE genannt hatte, »die vom Eichenstamm«: also in überraschender Parität zum Namen der Sakyer, dem sich dann auch noch Ortsnamen, wie Rovereto, Robledo, Eichstädt, Eichmannshausen = Sakyanigamo, Sakyānaṃ nigamo, anreihen. Dabei spielt nun die [821] weitere sprachliche Beziehung mit, daß sakiyo, von svakas, svakīyas, außerdem »eigen« bedeutet, ein eigener Mann sein, ein freier Mann. Es sind also im Namen der Sakyer die drei Begriffe Macht, Ansehn und Freiheit innig verbunden, obschon eigentlich nur die erste Ableitung von
, akvan, mächtig sein, vermögen, akma, akti, Macht, Kraft; und er hat ihn dann zugleich, wie solche Dinge in Indien von den vedischen Meistern her beliebt waren, auch auf den schönsten stolzesten Baum des Himālayo bezogen, auf akas, Tectona grandis, die indische Eiche, wie man sagen könnte. Denn er hat seine Söhne, aus einem bestimmten Anlaß, einmal als sakkische Eichen, stolze sakkische Eichen gekennzeichnet, S. 61: ähnlich wie jene alten Pelasger, die einst an den Abhängen des Parnaß gesiedelt waren, nach der dort wachsenden Eiche, απο δρυος, Dryoper genannt waren, d.i. Eichner, eichenartige Leute. Wir haben ferner ein prächtiges Gegenstück bei robur, Macht, Kraft, das zugleich Kernholz bedeutet, insbesondere aber der Name der sehr harten Steineiche ist, der Quercus Robur; woher sich das kühne Kriegergeschlecht, dem der Mars- und Musenfreund Papst JULIUS II entsprossen war, DELLA ROVERE genannt hatte, »die vom Eichenstamm«: also in überraschender Parität zum Namen der Sakyer, dem sich dann auch noch Ortsnamen, wie Rovereto, Robledo, Eichstädt, Eichmannshausen = Sakyanigamo, Sakyānaṃ nigamo, anreihen. Dabei spielt nun die [821] weitere sprachliche Beziehung mit, daß sakiyo, von svakas, svakīyas, außerdem »eigen« bedeutet, ein eigener Mann sein, ein freier Mann. Es sind also im Namen der Sakyer die drei Begriffe Macht, Ansehn und Freiheit innig verbunden, obschon eigentlich nur die erste Ableitung von 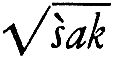 , vermögen, zu Recht besteht. Der in der Sprache wurzelnde Ausdruck ist nach verschiedenen Seiten, für Grammatiker zwar nicht der Regel gemäß, lebendig entwickelt. Man darf hier noch ein verwandtes Beispiel mit anführen, das artig dazupaßt. ZELTER berichtet an GOETHE von dem ausgezeichneten Kupferstecher G.F. SCHMIDT, der ein ganz von selber ausgebildeter Charakter gewesen und »in damaliger Künstlerumgebung für herb und roh gehalten, weil er das Kläglichthun der Stümperey kalt von sich wies und überhaupt moralisch der Sinnesart seines Königs [FRIEDRICHS des Großen] war, die eben nicht im Ansehn stand.« Über diesen Originalen äußerte nun einmal jemand zu ZELTERS Vater: »Ich sage Ihnen, Schmidt ist ein eigener Mann.« – »Ein eichener Mann!« rief mein Vater, – »der weiß was seyn muß.« Brief Nr. 803, unter dem 15.-17. September 1831. Unsere mannigfachen Anspielungen und Beziehungen hat man in China, schon zu Beginn der Missionstätigkeit, nicht mehr wiederzugeben vermocht, auch wohl kaum verstanden, und hat daher am unglücklichsten gewählt, bei der Wiedergabe jener Worte König Okkākos, wo er selbstbewußt von seinen mächtigen, freien, eichenartigen Söhnen spricht: denn die chinesischen Übersetzer und Bearbeiter des Kanons lassen da den König betroffen ausrufen »Ist es möglich«; sie haben also ākyā, die »Vermögenden« usw., »vermögend sein« mit »möglich sein« verwechselt oder vertauscht, und dazu waren sie grammatisch nicht unberechtigt. Aber weil ihnen eben das feinere Verständnis fehlte, weil ihnen hier die Kenntnis von Land und Leuten mangelte, hatten sie die stärkste Intensität zu einer verzagten hypothetischen Frage herabgedrückt und daraus dann den Namen der Sakyer erklärt: nach EITEL, Hand-Book of Chinese Buddhism, second edition London 1888, s.v. Ikṣvākus. – Vergl. noch Anm. 467; Mittlere Sammlung S. 388, 675, 778.
, vermögen, zu Recht besteht. Der in der Sprache wurzelnde Ausdruck ist nach verschiedenen Seiten, für Grammatiker zwar nicht der Regel gemäß, lebendig entwickelt. Man darf hier noch ein verwandtes Beispiel mit anführen, das artig dazupaßt. ZELTER berichtet an GOETHE von dem ausgezeichneten Kupferstecher G.F. SCHMIDT, der ein ganz von selber ausgebildeter Charakter gewesen und »in damaliger Künstlerumgebung für herb und roh gehalten, weil er das Kläglichthun der Stümperey kalt von sich wies und überhaupt moralisch der Sinnesart seines Königs [FRIEDRICHS des Großen] war, die eben nicht im Ansehn stand.« Über diesen Originalen äußerte nun einmal jemand zu ZELTERS Vater: »Ich sage Ihnen, Schmidt ist ein eigener Mann.« – »Ein eichener Mann!« rief mein Vater, – »der weiß was seyn muß.« Brief Nr. 803, unter dem 15.-17. September 1831. Unsere mannigfachen Anspielungen und Beziehungen hat man in China, schon zu Beginn der Missionstätigkeit, nicht mehr wiederzugeben vermocht, auch wohl kaum verstanden, und hat daher am unglücklichsten gewählt, bei der Wiedergabe jener Worte König Okkākos, wo er selbstbewußt von seinen mächtigen, freien, eichenartigen Söhnen spricht: denn die chinesischen Übersetzer und Bearbeiter des Kanons lassen da den König betroffen ausrufen »Ist es möglich«; sie haben also ākyā, die »Vermögenden« usw., »vermögend sein« mit »möglich sein« verwechselt oder vertauscht, und dazu waren sie grammatisch nicht unberechtigt. Aber weil ihnen eben das feinere Verständnis fehlte, weil ihnen hier die Kenntnis von Land und Leuten mangelte, hatten sie die stärkste Intensität zu einer verzagten hypothetischen Frage herabgedrückt und daraus dann den Namen der Sakyer erklärt: nach EITEL, Hand-Book of Chinese Buddhism, second edition London 1888, s.v. Ikṣvākus. – Vergl. noch Anm. 467; Mittlere Sammlung S. 388, 675, 778.
820 Atha kho naṃ dhammaṃ yeva mit S; ebenso hernach Iminā kho evaṃ Vāseṭṭhā pariyāyena veditabbaṃ.
821 Mit M etc. samaṇā Sakyaputtiyā'mhāti paṭijānātha. S hat paṭijānāthāti.
822 Hierzu Mittlere Sammlung 129 und 351. Der Ausdruck brahmakāyo, brahmabhūto, heilig leibhaftig, heilig verkörpert, ist nach vedischer Art gebildet. Ein Kenner und Erklärer des heiligen Wissens ist die höchste Erscheinung, die es gibt: denn »der Meister ist das Brahma selbst« sagt Manus II 225, d.h. er ist das sichtbar verkörperte Brahma, das leibhaftig gewordene Urwesen oder Urwort, ācāryo brahmaṇo mūrtiḥ, also = brahmakāyo, brahmabhūto, wie Gotamo sagt. Vergl. noch Anm. 930 und Anm. 760 am Ende. Der ebenso unpersönlich angewandte, rein auf die Sache bezogene Ausdruck dhammabhūto iti, »verkörperte Lehre« oder »verkörpertes Recht«, kehrt auf einer Inschrift wieder als dharmmāvatāra iti, der herrlichste Lobspruch und Ehrentitel, birudam, des tapferen Königs Mahā ivaguptas, der um 800 n. Chr. das große Kosaler Reich in Mittelindien beherrschte, ein Nachkomme mutterseits aus dem alten Māgadher Fürstengeschlecht: Zeile 9 Vers 12 auf der Steintafel der 1906 wiedergefundenen pra asti von rīpuram, Epigraphia Indica XI 191. Es ist das eine idiomatische Wendung, die so genau sonst nicht wiederholt ist, nur ähnlich wie z.B. im Rāmāyaṇam I 23, 6: Ikṣvākūṇāṃ kule jātaḥ sākṣād dharma ivāparaḥ, dhṛtimān usw. Dharmakāyaḥ, leibhafte Lehre, ist von den Mahāyānisten in Nepāl und Tibet zur Hypostase abstrakter Mentalität, einem angenommenen Grundstoff reiner Geistigkeit vergeheimnist worden, wogegen die leibliche Verkörperung des Erwachten, der rūpakāyaḥ, nur ein Scheinbild, ein Abglanz[822] davon sei, schon Divyāvadānam p. 19 zu finden; was dann von den Gnostikern als der höchste Aion gegenüber dem bloß doketischen Leibe des Erlösers aufgenommen wurde. – Als Kuriosität erwähne ich, daß der sehr gelehrte ehemalige Leiter der Klosterschule am Maligakandapariveṇa in Kolombo, mein vortrefflicher Gönner HIKKAḌUWE SUMANGALA, als er bei der Interpretation der Texte an unsere obige Stelle gelangt war, mir allen Ernstes brahmabhūto als gleich brahmābhūto erklärt hat.
823 Ebenso in der 1. Rede S. 14, mit der weiteren Erkenntnis S. 19: »Unendlich ist diese Welt, rings ohne Grenzen.« Vergl. ebenda Anm. 27 das Ergebnis aller möglichen Naturbetrachtung in geradliniger Entwicklung aus dem Puruṣasūktam der Ṛksaṃhitā. Daher wurde denn auch von den Sehern der früheren Upanischaden die Erde als im Äther gegründet, als frei schwebend im Raume gezeigt: ākā e pṛthivī pratiṣṭhitā, Taittirīyopaniṣat III 9, und sagt Yājñavalkyas zu Gārgī auf deren Frage, worin doch nur alle Dinge Himmels und der Erden bestehn, »in den Raum eben ist das eingewoben und durchgewoben«: ākā a eva tad otaṃ ca protaṃ ca, Bṛhadāraṇyakopaniṣat III 8, 7, und belehrt Pravāhaṇo Jaivalis in der Chāndogyā seinen Jünger: »Alle diese Wesen da kommen eben aus dem Raume hervor und kehren wieder zurück in den Raum, der Raum ist über ihnen, der Raum ihre Hinkunft« I 9, 1: alle Welten aber sind in das Selbst, in den ātmā, eingewoben und durchgewoben, heißt es dann noch in der Subālopaniṣat, X Ende. Aus diesen Anschauungen der Seher der Vorzeit ist also auch die oben dargestellte Ansicht hervorgegangen, von den Wesen, die selbstleuchtend im Raume kreisen, in Schönheit bestehn, lange Wandlungen durchdauern. Das ehrwürdige Alter dieser Ansicht, die über zwei Jahrtausende zurückreicht, hindert sie freilich gar nicht, daß sie heute noch ebenso lebendig funkelnd anzumuten vermag wie dazumal, da sie eigentlich schon das selbe gibt wie sich der zweite Band der Welt als Wille und Vorstellung eröffnet: »Im unendlichen Raum zahllose leuchtende Kugeln, um jede von welchen etwan ein Dutzend kleinerer, beleuchteter sich wälzt, die inwendig heiß, mit erstarrter, kalter Rinde überzogen sind, auf der ein Schimmelüberzug lebende und erkennende Wesen erzeugt hat; – dies ist die empirische Wahrheit, das Reale, die Welt.« Dieser Blick in die Unendlichkeit des Weltraums, von KOPERNIKUS, BRUNO, GALILEI sicher erschlossen, war von DESCARTES in das auch ihm noch höchst feuergefährliche schöne Bekenntnis seiner ketzerischen Ansicht gebracht worden: Cognoscimus praeterea hunc mundum, sive substantiae corporeae universitatem, nullos extensionis suae fines habere. Ubicunque enim fines illos esse fingamus, semper ultra ipsos aliqua spatia indefinite extensa, non modo imaginamur, sed etiam vere imaginabilia, hoc est realia esse percipimus; ac proinde etiam substantiam corpoream indefinite extensam in iis contineri: Principiorum philosophiae pars II Νο. 21. Daher ja auch VOLTAIRE gesagt hatte, im Abschnitt De la tolérance universelle: »Ce petit globe, qui n'est qu'un point, roule dans l'espace, ainsi que tant d'autres globes; nous sommes perdus dans cette immensité. L'homme, haut d'environ cinq pieds, est assurément peu de chose« etc.: wo also der Mensch dem ungeheuren Weltall ganz im gleichen Ausdruck und Maß gegenübergestellt ist, wie Sāriputto in der 28. Rede der Mittleren Sammlung, S. 208, vom All und vom Menschen spricht, »von diesem Körper da, der acht Spannen hoch ist«, und von dem ›nichts ist sein‹ in Wirklichkeit gilt. Nicht so abgeklärt, vielmehr bitter und scharf stimmt hierzu was uns KANT von einem witzigen Manne erzählt, der die Bewohner der Erde den Bewohnern der Wälder auf dem Kopf eines Bettlers vergleicht, die ihn für eine unermeßliche Kugel halten und sich selber als das Meisterstück der Natur ansehn. Und als nun einmal eins von diesen Wesen den Kopf eines anderen Menschen gewahr wird – den Kopf eines Edelmanns, [823] sagt jener Schäker – da kündet es seinen Mitwesen entzückt an: »Wir sind nicht die einzigen belebten Wesen der ganzen Natur: sehet hier ein neues Land, hier wohnen mehr Läuse.« Der beschränkte Blick des gewöhnlichen, unerfahrenen Menschen, der sich durch die Entdeckung anderer Planeten und ihrer Bewohner schon hochbeglückt und erhaben fühlt, dem also Mathematik und Astronomie, kurz bloße Physik völlig genügt, ist da so trefflich gekennzeichnet, daß KANT selbst, der friedliebende und wo er nur kann beschönigende KANT, sich nicht enthalten mag noch hinzuzufügen: »Laßt uns ohne Vorurtheil urtheilen. Dieses Insekt, welches, sowohl seiner Art zu leben, als auch seiner Nichtswürdigkeit nach, die Beschaffenheit der meisten Menschen sehr wohl ausdrückt, kann mit gutem Fuge zu einer solchen Vergleichung gebraucht werden.« Allgemeine Naturgeschichte und Theorie des Himmels, 3. Teil, Anhang, Von den Bewohnern der Gestirne, ed. ROSENKRANZ S. 207f. Kurz aber stimmt in diesen Chorus der Denker hier noch ABRAHAM A SANCTA CLARA mit ein: Lass' sterben, ein mächtiges Wesen ... diesen Leimlümmel, diesen Krätzenmarkt, dieses sechs Schuh lange Nichts, dieses Spottmuster, diese kleine Portion Erde, lass' sterben, lass' verderben, Omnis militia i.f.; und LEOPARDI, wenn er in der Ginestra die azurne Nacht mit ihren flimmernden Sternen und Nebelflecken über diesem dunklen Staubkorn, Erde geheißen, und die winzigen Menschlein darauf betrachtet, die sich an Wissen und Kultur allen Zeiten überlegen dünken: so daß er schließlich nicht weiß, ob in seinem Herzen das Lachen oder das Mitleid überwiegt. Auf die früheren indo-europäischen Spiegelungen dieser Art der Betrachtung, so bei EPIKUR und seinen Metakosmien, ist in der Anm. 293 hingewiesen. Doch das prächtigste Bild hat PLATON entworfen, am Ende des Timaios: Θνητα γαρ και αϑανατα ζωα λαβων και ξυμπληρωϑεις ὁδε ὁ κοσμος, ούτω ζωον όρατον τα ὁρατα περιεχον, εικων του νοητου, ϑεος (sic BEKKER recte cum codicibus) αισϑητος, μεγιστος και αοριστος, καλλιστος τε και τελεωτατος γεγονεν; είς ουρανος ὁδε, μονογενης ων, »Sterbliche aber und unsterbliche Wesen enthält sie und ist davon erfüllt, diese Welt, so als Wesen sichtbar das Sichtbare umfassend, ein Gleichnis des Geistigen, der versinnlichte Gott, der größte und unbegrenzte, der schönste und vollkommenste geworden: der eine Himmel da, in einziger Art bestanden.« – Solche sonnenäugig rings umblickende Naturgeschichte Himmels und der Erden, wenn sie auch unserem Geiste nach seiner Anlage und Denkfähigkeit als die allein würdige erscheint, ist trotzdem oder vielmehr eben darum nur von bedingter Gültigkeit und nur gleichnisweise und wie ein Rätsel zu verstehn und zu deuten, nach dem gotamidischen Merkspruch »Wie aus Diesem Jenes wird«, Bruchstücke der Reden v. 502; oder wie der Wahnumfangene, der Unerwachte, wird er einmal tief berührt und erschüttert, alsbald zu wittern und schaudernd im Herzen zu begreifen vermeint, daß unser Leben ein Traum sei, und ihm ein Schimmer zu dämmern beginnt, eine ahnende Gewißheit aufgeht:
Es todo el cielo un presagio,
Y es todo el mundo un prodigio.
Es ist der ganze Himmel ein Bedeuten,
Und ist die ganze Welt uns ein Verwundern.
So auch hatte der FREIDENKER, der mit Kaiser FRIEDRICH II. im Osten herumgefahren gründlich aufgeklärt war, es in seiner »Bescheidenheit« erkannt:
Swaz wir noch fröuden hân gesehen,
Daz ist uns als ein troum geschehen.
[824] Ja selbst unser weltfroher Sangesherr WALTHER war schon gar mächtig davon ergriffen als er abschloß:
Owê war sint verswunden alliu mîniu jâr!
Ist mir mîn leben getroumet, oder ist ez wâr?
Daz ich ie wânde, daz iht waere, was daz iht?
Dar nâch hân ich geslâfen, und enweiz ez niht.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Owê wie uns mit süezen dingen ist vergeben!
Ich sihe die gallen mitten in dem honege sweben.
Diu werlt ist ûzen schoene, wîz, grüen unde rôt,
Und innân swarzer varwe, vinster sam der tôt.
Alles erklären wollen, so daß die Dinge wie nach einer algebraischen Gleichung restlos aufgingen, ist eine Denkweise, die man bei jenen sinnigen Geistern vergebens suchen würde. Das Wunderbare, ā caryam, ist ihnen allen wie dem Inder notwendige Voraussetzung; ein Element, das auch in den großartigen späteren Dichtungen, Sagen, Dramen der östlichen Meister immer der pulsierende Lebensnerv ist. Darum sagt GOETHE, weit zurück- und vorausblickend: »Wohl findet sich bei den Griechen so wie bei manchen Römern eine sehr geschmackvolle Sonderung und Läuterung der verschiedenen Dichtarten, aber uns Nordländer kann man auf jene Muster nicht ausschließlich hinweisen: wir haben uns anderer Voreltern zu rühmen und haben manch anderes Vorbild im Auge. Wäre nicht durch die romantische Wendung ungebildeter Jahrhunderte das Ungeheure mit dem Abgeschmackten in Berührung gekommen, woher hätten wir einen Hamlet, einen Lear, eine Anbetung des Kreuzes, einen standhaften Prinzen?« Populär gesprochen bezeichnen wir also diese blütende Gattung schlecht und recht als romantisch. Besser könnte man sie »carwhichitish« benennen, nach den so getauften Fragen; wo die Plattmützenweltweisheit mit ihrem Anspruch auf Beantwortung der letzten Dinge so kurz als gründlich abgeführt wird, z.B. mit der Bitte um Aufklärung: »How far is it from the first of July to London Bridge?«, oder bei der Rechenaufgabe: »Wenn ein Schock Äpfel drei Mark kostet, wie lange wird dann eine Auster brauchen um sich durch einen Block Seife hindurchzufressen?« Beim ā caryam wie beim carwhichit findet eben insbesondere statt, läßt sich immer beobachten, mit Fug und Recht anwenden was im Rezitativ einer Kantate BACHS in herrlichster Einfalt erklingt: »Ich wundre mich, denn alles was man sieht muß uns Verwundrung geben«; vom Ysop, der an der Mauer wächst, bis zum fernsten Nebelfleck – die unbegreifliche Unendlichkeit, oder mit den Worten KANTS, »ganze Gebirge von Millionen Jahrhunderten«, »eine Milchstraße von Welten gegen sie anzusehn, wie man eine Blume, oder ein Insect, in Vergleichung gegen die Erde ansiehet«, da denn alles was groß ist, klein wird, »ja es wird gleichsam nur ein Punkt, wenn man es mit dem Unendlichen vergleicht.« Wer möchte dieser dhammatā oder Dinglichkeit von außen beikommen, ohne sich doch schon von der BOURIGNON eines Besseren belehren lassen zu müssen, der Denkerin, die den Weltweisen ihrer Zeit die Diagnose gestellt hat: »Es ist eine Krankheit der Philosophen, daß sie alles vernünftig erklären wollen.« Den Gegensatz dazu gibt unser NOVALIS an, als Kommentator: »Es ist seltsam«, sagt er, »daß in einer guten Erzählung allemal etwas Heimliches ist – etwas Unbegreifliches. Die Geschichte scheint noch uneröffnete Augen in uns zu berühren, und wir stehn in einer ganz anderen Welt, wenn wir aus ihrem Gebiete zurückkommen.« So vergleicht auch SCHOPENHAUER seine Lehre zwar »einem Rechenexempel, [825] welches aufgeht; wiewohl keineswegs in dem Sinne, daß sie kein Problem zu lösen übrig, keine mögliche Frage unbeantwortet ließe. Dergleichen zu behaupten, wäre eine vermessene Ableugnung der Schranken menschlicher Erkenntniss überhaupt. Welche Fackel wir auch anzünden und welchen Raum sie auch erleuchten mag; stets wird unser Horizont von tiefer Nacht umgränzt bleiben. Denn die letzte Lösung des Räthsels der Welt müsste nothwendig bloß von den Dingen an sich, nicht mehr von den Erscheinungen reden. Aber gerade auf diese allein sind alle unsere Erkenntnissformen angelegt: daher müssen wir uns Alles durch ein Nebeneinander, Nacheinander und Kausalitätsverhältnisse fasslich machen.« Hauptwerk II Kapitel 17 gegen Ende. Diese Betrachtung und Untersuchung je nach dem Standpunkte, pariyāyena, je nach Antinomie und Paralogismus der Vernunft, ist freilich mit höchster Besonnenheit von KANT durchgeführt worden. Gegenüber den Ergebnissen der Naturwissenschaft besteht nämlich ebenso bedingt gültig das problematische Urteil, daß alles Leben eigentlich nur intelligibel sei, nichts als eine bloße Erscheinung, und die ganze Sinnenwelt ein bloßes Bild, welches unserer jetzigen Erkenntnisart vorschwebt, und, wie ein Traum, an sich keine objektive Realität habe, usw. (vergl. hiermit noch Anm. 720): doch muß man sich bei solch einem problematischen Urteil hüten es im Ernste behaupten zu wollen, also in das andere Extrem zu geraten. Denn man kann ebenso wenig durch bloße Erfahrungsgesetze das ganze Feld möglicher Dinge an sich selbst umspannen, als man außerhalb der Erfahrung für unsere Vernunft irgend etwas auf gegründete Art erwerben kann: man kommt zu keiner absoluten Gültigkeit, eines so gut wie das andere Urteil ist nur hypothetisch brauchbar, taugt nur jeden dogmatischen Dünkel abzulehnen. »In dieser Qualität aber muß man sie erhalten und ja sorgfältig verhüten, daß sie nicht, gleich als an sich selbst beglaubigt und von einiger absoluten Gültigkeit, auftreten und die Vernunft unter Erdichtungen und Blendwerken ersäufen«: Kritik der reinen Vernunft, Methodenlehre I 3 Ende. SCHOPENHAUER hat uns diese schwierige Art der Betrachtung außerordentlich erleichtert, Parerga II § 85, wo er die kosmogonische und geologische Entwicklung vorführt und dann zum kantischen hypothetischen Begriff zurückkehrt: das Bewußtsein bedingt die in Rede stehenden physischen Vorgänge, vermöge seiner Formen; ist aber wiederum durch sie bedingt, vermöge ihrer Materie. Der Regressus an der Hand der Prinzipien a priori aller möglichen Erfahrung leitet, einigen empirischen Datis folgend, zu ihnen hin: er selbst aber ist nur die Verkettung einer Reihe bloßer Phänomene, die keine unbedingte Existenz haben. Auf diese Weise kann man, so oder so, nie über eine hypothetische Erklärung hinausgelangen. Die Welt ist demnach weder als eine mathematisch usw. bestimmbare Größe noch auch als ein bloßes Traumgesicht usw. zu betrachten. Und die gleiche höchste Besonnenheit hat, unbeugsam und unerbittlich wie es hierbei KANT gewesen, Gotamo gezeigt, als er alles Behaupten »Dies nur ist Wahrheit, Unsinn anderes« abgelehnt hat, bescheiden mit der Erkenntnis: »In eben diesem klaftergroßen Leibe da, dem wahrnehmen und denken anhaftet, lass' ich die Welt verstanden sein, die Weltentwicklung, die Weltauflösung und den zur Weltauflösung führenden Pfad«, Saṃyuttakanikāyo ed. Siam. vol. I p. 84 (PTS 62, mit S sasaññamhi samanake); vergl. oben Anm. 764 Ende.
824 Nach der voranfänglichen Phase der leuchtenden kreisenden Himmelsgestalten wird nun die weitere Entwicklung auf Erden als aus den Niederschlägen einer ungeheueren Wassermenge – »einzig Wasser geworden aber ist es zu jener Zeit, tiefdunkel, tiefdunkle Finsternis« – zu verstehn gesucht: im unendlich wogenden Chaos dieser Fluten kommt es zur Keimung und Bildung der ersten irdischen Wesen schlechthin, [826] »die Wesen sind nur eben als Wesen aufzuweisen«, entsprechend der ṛgvedischen Anschauung apsu 'kṣitaḥ I 139 11, den Gewässern als den Müttern X 9 usw., ihrem Sprößling der Wogen apāṃ napāt X 30 usw. usw. Eddische Ufer umkreisend läßt RICHARD WAGNER sein nordisches Tonpurāṇam aus dem Wellengrunde des Rheins erfolgen; auch wieder stark südöstlich steuernd und mit einlaufend, von verwandten Gestirnen freundlich geleitet, in die altgriechische Kosmogonie, nach der aus dem Ozean alle Dinge entstanden sind, Ilias XIV 246: der Ausgangspunkt der Weltbetrachtung des Milesiers THALES, des ersten Philosophen der Griechen, nach PLUTARCH, De plac. philos. I 3, 1. Sagt doch eben dieser Denkerfürst der Edlen, wie GOETHE meisterlich zusammenfaßt, Faust 8435ff.:
Alles ist aus dem Wasser entsprungen!!
Alles wird durch das Wasser erhalten!
Ozean, gönn' uns dein ewiges Walten!
Besser noch freilich wird der Kreis dann am Ende der walpurgischen Werdelust, 8480-83, umschrieben und beschlossen, als ein richtiges Vedenmantram:
Heil dem Meere! Heil den Wogen,
Von dem heiligen Feuer umzogen!
Heil dem Wasser! Heil dem Feuer!
Heil dem seltnen Abenteuer!
Ist also geradezu gleich der Atharvasaṃhitā XIX 2, 5: aṃta āpaḥ ivā āpo etc.; während die Ṛk X 129 dazu das ganze Urbild aufweist: nāsīd rajo no vyomā paro yat – na rātryā ahna āsīt praketaḥ, ānīd avātaṃ svadhayā tad ekaṃ, tasmāddhānyan na paraḥ kiṃ canāsa, tama āsīt tamasā gūlḥam agre, apraketaṃ salilaṃ sarvam ā idaṃ, »kein Wolkensaum, und jenseit war kein Himmel – nicht war aus Nacht erschienen Tageshelle, es wallte windlos in sich selbst das Eine, nicht war noch irgend außer ihm ein andres, das Finster war in Finster einst versunken, ein unsichtbares Fluten war dies alles.« Wenn nun unser Text oben und in der 24. Rede, S. 442, solche vedische Kunde weiterentwickelt, bis zum Auseinanderballen der Welt, dem Herabsinken der himmlischen Wesen mit dem großen Brahmā, der tiefdunklen Finsternis, wo es noch keinen Mond und keine Sonne, keine Sterne und Planeten, weder Tag noch Nacht gibt, keine Monate und Wochen, keine Wenden und Jahre usw.: so gehört diese ganze Darstellung ohne Zweifel zum Bestande einer uralten indo-ārischen Weltansicht, ist ein Erbstück aus jener Sagenüberlieferung. Denn sie ist fast Wort um Wort von ARISTOPHANES wiedergegeben, in der herrlichen Parabase der Vögel: Χαος ην, και Νυξ, Ερεβος τε μελαν πρωτον, και Ταρταρος ευρυς; γη δ', ουδ' αηρ, ουδ' ουρανος ην, κτλ. 693-702. Die Stelle war so berühmt, daß noch SUIDAS s.v. Chaos nur sie vollständig und sogar richtig anführt. Ferner ist unser Stück, auch mit erstaunlicher Treue, in das Wessobrunner Gebet verarbeitet worden, dessen Hauptteil sicher aus germanischer Vorzeit und noch weiter herstammt. Was ist es anders als ein Nachhall, wenn es dort wie beim attischen Dichter und seinem Ερως heißt: »Das erfuhr ich mit Menschen, Menschenweisheit größte: daß Erde nicht war noch oben Himmel, noch Baum noch Berg noch irgend etwas. Noch die Sonne nicht schien, noch der Mond nicht leuchtete, noch die gewaltige See. Als da nichts und nichts irgend war, weder Enden noch Wenden, da war der eine allmächtige Gott, der Mannen mildester. Da waren auch manche mit ihm, göttliche Geister ...« Hiermit bricht das Stück ab, und es werden einige christliche Phrasen angehängt.
[827] 825 taṇhā ca nesam okkami mit S etc. Der genießbare saftige Erdeschaum, der sich da aus der See abhebt, die erste Atzung der Wesen, ist der körperbildende Nährstoff, also das Ἁλμαιον und Salgamum der Alten. Eine spätere Entwicklung davon scheint jene Meeralge zu sein, die BACO VON VERULAM beschreibt: Aiunt, in quodam apud Indos mari herbam natantem reperiri, quae Salgazus vocata per undas se dispergit, ut prati instar intuentibus praeferat. Sylva sylvarum, ed. 1694 § 645. Wir verstehn nun um so besser warum Proteus dem nach körperhafter Entstehung gelüstenden Homunculus anrät:
Im weiten Meere mußt du anbeginnen!
Da fängt man erst im kleinen an
Und freut sich Kleinste zu verschlingen;
Man wächst so nach und nach heran
Und bildet sich zu höherem Vollbringen.
826 Mit S etc. tabbhakkhā tadāhārā. Im folgenden Satz ist kharattam natürlich gleich kharatvam. R. OTTO FRANKE, ein zweiter Pistol in der Kunst des Danebengreifens und des unmöglichsten Ausdrucks, verwechselt hier kharao, grob, hart, mit kṣārao, salzig, ätzend, und er sagt daher in seinem »Dīghanikāya«, Göttingen 1913, S. 278, es »entwickelten sich immer stärker gewisse Säuren in ihrem Körper«: womit er auch bei dieser Stelle, wie bei hundert weit wichtigeren, nichts weniger als eine Übersetzung gegeben, vielmehr nur eine verzweifelte Ähnlichkeit mit Sodbrennen erzeugt hat. Und der so entstandene Gastrizismus jener Wesen wird dann in FRANKES Behandlung zum chronischen Magenkatarrh gesteigert: denn es »entwickelten sich in noch immer höherem Maße Säuren in ihrem Körper«, »entwickelten sich noch immer mehr Säuren in ihrem Körper«, das Krankheitsbild der saburralen Pyrosis. Nur im Text ist es eben nicht zu finden, und auch nicht in der guten, sehr gewissenhaften Bearbeitung im tibetischen Kanon, deren Wiedergabe wir SCHIEFNER verdanken (s. Anm. 802), von FRANKE, nach einem Hinweis OLDENBERGS, zwar genannt, aber offenbar gar nicht angesehn. Dort wird gesagt: es »erlangte ihr Körper Härte und Schwere«, ganz entsprechend unserer älteren Fassung und Vorlage oben, S. 480: »mehr und mehr sind jene Wesen immer gröber geworden an Körperart.« Sie waren ja aus geist- oder gasförmig leuchtenden Nebelgebilden im Verlaufe langer Wandlungen allmählich zu immer düsteren, dichteren, gröberen Formen bis zum Dasein in Wasser-, Erde- und Pflanzenwelt herabgesunken, und die Schönheit ihrer einstigen, voranfänglich strahlenden Himmelserscheinung war »in Unschönheit übergegangen.« Nach abendländischen Begriffen wäre das freilich eine Entwicklung zu immer fortschreitender Scheidung und Unterschiedlichkeit, also statt einer Entartung eine Vervollkommnung. Dergleichen Betrachtungen sind eben nur relativ, je nach dem Standpunkte gültig, je nachdem man minimales oder maximales Dasein, Bewußtsein, Ausgesondertsein als den irrationalen Weltbruch und Welteinbruch einer Götter- und Menschendämmerung für das endliche Ziel oder den beginnenden Verfall ansetzt. Sicher aber hat jener alte Mythos bedingt bestehende astrophysische Verhältnisse wie nach ahnender Erinnerung zu versinnlichen vermocht. Nicht mit Unrecht ist die Darstellung in der buddhistischen Welt aller Völker, in Indien wie in Tibet, China und Japan, jederzeit verbreitet und beliebt gewesen; so sehr, daß z.B. noch der Historiograph der Ostmongolen, Ssanang Ssetsen, ein Nachkomme Dschingis Khans, sein großes Geschichtswerk mit ebendiesem Kapitel von der Weltentstehung eröffnet, in 1. J. SCHMIDTS Ausgabe und Übersetzung, St. Petersburg 1829, S. 2-9. Da ist denn im [828] Laufe »ungebildeter Jahrhunderte das Ungeheure mit dem Abgeschmackten«, nach GOETHES Wort über den Geschmack (Anm. zu Rameaus Neffe), das gerade hier völlig zutrifft, immer mehr und mehr in Berührung gekommen.
827 kiñcid eva surasaṃ labhitvā mit S etc. Das Mahāvastu hat dafür subhojanakhāditā, I 340, 15. Im folgenden Satz ist aggaññam als agra + anyam zu erklären: was ferner ist als die Spitze, vor dem Anfang, voranfänglich; agrajñaḥ, die Etymologie des Kommentars, würde gerade das Gegenteil besagen: den Anfang kennend. Der Bearbeiter im Mahāvastu stand dem Worte ganz ratlos gegenüber, bildete gar ein *agninyam, feuerig. Sehr richtig bemerkt da SENART, I 617: »Nous devons être en présence de quelque confusion.« Er fügt aber hinzu: »Je trouve en pâli un adjectiv aggañña, composé de agra + jña, qui a à peu près le même sens que le sanscrit agraja«: und das ist, eben nach dem Kommentar gedeutet, eine rein willkürliche Behauptung und platterdings unmöglich. So wird regelmäßig in den Apokryphen des Mahāvastu, Lalitavistarapurāṇam etc. bei bedenklichen, das ist den Bearbeitern unverständlichen Stellen hin und her geschwankt und endlich das Unmöglichste von allem gewählt. Entscheidend kann da nur der erwiesene Sprachgebrauch des Pāli sein. Wer den nicht kennt, muß immer unentschieden bleiben wie BURIDANS Esel oder DANTES liber uomo oder der ισον απεχων des ARISTOTELES bei SCHO PENHAUER, Freiheit des Willens III gegen Ende. Er wüßte ja nie wo der Schutzengel steht, dem er trauen darf, da jeder von beiden rechthaben könnte, ganz nach der Black-letter Ballad in der PEPYS Collection:
St.George he was for England; St. Dennis was for France;
Sing, Honi soit qui mal y pesne.
Der Begriff aggañño ist durch drei Ansprachen vollkommen sichergestellt, die im Catukkanipāto des Anguttaranikāyo erhalten sind, No. 28-30, ed. Siam. p. 35-41. »Es gibt, ihr Mönche«, sagt Gotamo, »vier heilige Stammbäume, voranfängliche, vorzeitliche, vorentstammte, einstige, unverimpfte, die niemals verimpft wurden; man verimpft sie nicht und wird sie nicht verimpfen, sie bleiben unangetastet von Asketen, Priestern, Verständigen: und welche vier sind das? Da ist, ihr Mönche, ein Mönch, zufrieden mit was immer für einem Gewande und preist das Lob der Zufriedenheit mit jeglichem Gewande«, er ist zufrieden mit was immer für Almosenbissen, zufrieden mit was immer für Sitz und Lager, und es beglückt und erquickt ihn geistige Übung, beglückt und erquickt ihn Entsagung. Um all dies überhebt er sich aber nicht und verachtet auch keinen anderen. »Wer nun darin geschickt und behende ist, klar bewußt, wohl besonnen, den heißt man, ihr Mönche, einen Mönch auf dem einstigen, voranfänglichen, heiligen Stammbaum bestanden.« Und in den beiden sich anschließenden Reden werden dann die vier dhammapadāni, Pfade der Wahrheit, oder Spuren der Satzung, gezeigt: unbegehrlich sein, ungehässig sein, rechte Einsicht üben, rechte Einigung üben. »Das sind, ihr Mönche, die vier Spuren der Satzung, voranfängliche, vorzeitliche, vorentstammte, einstige, unverimpfte, die niemals verimpft wurden; man verimpft sie nicht und wird sie nicht verimpfen, sie bleiben unangetastet von Asketen, Priestern, Verständigen.« So ist denn durchgängig das agra + anyao wie oben bei uns s.v.a. die erste Voraussetzung, was allem vorangeht, vor dem Anfang, voranfänglich, von Anbeginn, ανεκαϑεν; und ebenso rattañño, vorzeitlich, cf. dīgharattam. Bemerkenswert ist die verwandte pleonastische Zusammensetzung primordium, »der erste Anfang«, die primordia mundi bei OVID, oder wie LUKREZ, voll im Ton vorspielender Purāṇen, sein Werk beginnt, I 55-57:
[829] Disserere incipiam, et rerum primordia pandam,
Unde omnis natura creet res, auctet, alatque,
Quove eadem rursum natura perempta resolvat.
Heute haben wir daher, in der Geologie, das Wort Primordialzeit.
828 kalambakā richtig mit S etc. Es wird eine kleinere Art giriphalasā, Grewia asiatica, gemeint sein: eine Brotbeerenstaude, die im Gebirge wächst, wohlbekannt ist. Vorher hat das Mahāvastu, I 341, hier wieder wie beim erstenmal das Aufschluchzen der Wesen eingeschaltet: was aber gar nicht hergehört, weil der Wandelprozeß von der Erdbodensprosse zur Rankenbeere, die beide ganz gleich aussehn und schmecken, ein zu gelinder ist um den Wesen einen Anlaß zu so heftiger Wehklage zu geben. Der Zusatz im Mahāvastu ist demnach eine mißverstandene »Ergänzung« von seiten der nördlichen Schule, bloß lehrreich zur Kenntnis jener sehr oft nur grob mechanischen Bearbeitung. Er ist also nichts weniger als »eine wesentliche Verbesserung«, die das Mahāvastu unserem Texte bringt, wie OLDENBERG in seinen, übrigens mustergültigen, Studien meint, Nachrichten der Göttinger Gesellsch. der Wissensch., phil.-hist. Kl. 1912, Heft 2, S. 131, Anm. 1; und nicht die Ausfüllung einer Lücke, die »nicht dem Text selbst, sondern der Überlieferung zur Last« fällt: sondern es ist eine vorwitzige Spaltung des Zusammenhangs mit eingelegtem Füllsel. Dieser Einschub ist dann auch in den tibetischen Kanon übergegangen, bei SCHIEFNER S. 4 (s. Anm. 802).
829 kenacid eva dukkhadhammena phuṭṭhā mit S, M etc., Mahāvastu I 341, 9 spṛṣtā; hernach immer ebenso akkharam anusaranti, na tvev' assa.
830 Ist altvedischer Hochzeitbrauch, nach Hiraṇyake igṛhyasūtram I 21 Ende (vergl. insbes. SENARTS Anmerkung zu Mahāvastu I 618 l. 15), auch heute noch üblich; wie ja ganz ähnliche uralte Volksitte ziemlich allerwärts gilt, siehe HILLEBRANDT in BÜHLERS Grundriß III 2 S. 4: »Diese weitverbreitete und noch heut in Indien vielfach lebendige Sitte Braut und Bräutigam zu bewerfen, findet bei arischen Völkern ihr Analogon. – Die Griechen kannten die καταχύσματα, bei den Römern streute der Bräutigam Nüsse« usw. Die Sizilier werfen Weizen nach, die Berrichons (CAESARS Bituriger) Hafer, die Bulgaren Hirse. Anmutige Bilder, wo dieses Nachwerfen von Schollen, Schuhen und dergleichen hinter den Neuvermählten zu sehn ist, findet man auf griechischen Vasen, so auf einem rotfigurigen Krug im Nationalmuseum zu Athen. Der ethnische Glaube legt der Handlung Abwehr böser Einflüsse und Segenswünsche zu: bei uns oben ist es ethisch gewertet, als ein Brauch, der in eine ferne Vorwelt hinaufreicht und ein einst bestandenes feineres Verträgnis andeutet, freilich nicht etwa geschichtlich einzuordnen, sondern immer einer Zeitebene eigen, wo die Trauung zum Ehstand und Wehstand nur als remedium nuptiale angesehn wird, wie Sankt BERNHARD nicht weniger nüchtern als jene voranfängliche Gesellschaft es benannt hat, in der Convers. ad cleric. cap. XXIX i.f., ed. Par. 1621 fol. 857. Die derben Grundlagen des Kontrakts der Gattenschaft, ohne Zier, ohne Fassade, weist ein Spruch auf, den BAYLE s.v. Abéliens nach FURETIERE gibt:
Boire et manger, coucher ensemble,
C'est Mariage, ce me semble.
Die brennende Sucht nach Paarung aber, infolge der Teilung der Wesen in Mann und Weib, kommt nach der Bṛhadāraṇyakopaniṣat I 4, 4 f, daher, daß der Ātmā oder das Selbst, der ursprünglich ganz allein dawar, endlich aus Unbehagen »eben sich selbst entzwei [830] gespalten hat: daraus ist Gatte und Gattin geworden. ›Wir sind da jeder wie eine Halbscheid‹, sagte deshalb einst Yājñavalkyas.« Denselben Mythos erzählt ARISTOPHANES in PLATONS Symposion, p. 191: »Jeder von uns ist also ein Stück Mensch, entzwei geschnitten wie etwa die Schollen, aus einem zwei geworden« und daher von der Sucht erfüllt, wieder »aus zweien eins zu werden«, εκ δυειν εἱς γενεσϑαι, p. 192, usw. Bei KANT wird das Verhältnis aller Mythik entkleidet und kommt doch, rein teleologisch betrachtet, auf dasselbe hinaus: er nennt es »die Organisation beiderlei Geschlechts in Beziehung aufeinander zur Fortpflanzung ihrer Art«, und er wirft die Frage auf: »warum mußte ein solches Paar existiren? Die Antwort ist: Dieses hier macht allererst ein organisirendes Ganze aus, ob zwar nicht ein organisirtes in einem einzigen Körper.« Kritik der Urteilskraft § 82, 2. Absatz. Auf die von PLATON überlieferte Figur hat der grundgelehrte RABELAIS sich bezogen und das corpus binum lustig verspottet: »Et faisoyent eux deux sonnent ensemble la beste a deux dos«, sagt er im Gargantua I 3; woher die Ausdrucksweise dann offenbar ein geflügeltes Wort wurde, da sie noch siebzig Jahre später im Othello gleichlautend wiederkehrt, Mitte der ersten Szene des ersten Aufzugs, als »making the beast with two backs.« Der junge BRUNO hat um dieselbe Zeitperiode das Thema am Ende des vorletzten Aktes im Candelajo mit ergetzlichem Humor behandelt; der Dialog, den er da gibt, ist so gelungen, daß er im nächsten Jahrhundert sogar von MOLIÈRE in der Comtesse d'Escarbagnas, 19. Auftritt, wörtlich übernommen wurde. Bei SCHOPENHAUER ist, wie bekannt, jene brennende Sucht Anfang und Ende der Welt. Man könnte sogar behaupten, daß der unablässig beunruhigende Geschlechtstrieb und seine Affekte, »einen beständigen, gelinden Wahnsinn im Menschen unterhalten, so lange er unter dem Einfluß jenes Triebes oder jenes Teufels, von dem er stets besessen ist, steht; so daß er erst nach Erlöschen desselben ganz vernünftig würde.« Frei nach SHAKESPEARES Sonnet CXXIX:
Mad in pursuit, and in possession so;
Had, having, and in quest to have, extreme;
A bliss in proof, – and proved, a very wo,
Before, a joy proposed; behind, a dream.
Es zeigt sich, daß er »der unmittelbare oder mittelbare Urheber fast alles und jedes Unheils ist, das den Menschen trifft oder bedroht.« Ist aber die Sucht erloschen, dann ist »der eigentliche Kern des Lebens verzehrt.« Parerga I, letztes Kapitel gegen Ende. Eben dasselbe hatte schon DOSITHEOS der Kilikier in den lapidaren Satz gefaßt: »Durch Gemeinschaft ist der Welt Anfang gewesen, durch die Alleinschaft will sie das Ende finden«, s. Mittl. Samml., Anm. 444; während Sankt HIERONYMUS recht vierschrötig und drastisch genug JOVINIAN gegenüber einmal sagte, daß »die Tugend des Teufels in den Lenden steckt«, diaboli virtus in lumbis est, von MONTAIGNE III 5 Mitte besprochen. Doch hört man hier immer noch eine unbefriedigte Stimme, einen unausgeglichenen Groll nachklingen, und den persönlichen Ärger des Geprellten, dem die »eenparigheid« des RUBENS, jene höchste Liebeshuld, im Augenblick des Verweilens auch schon zu BRUEGHELS »tweedrachtigheid« wird; und wie er hier privatissime und gratis die philosophische Erfahrung macht: diese ganze Eintracht der Welt besteht aus Zwieträchtigkeiten, tota haec mundi concordia ex discordibus constat, nach SENECA, Natur. quaest. VII 27. Tiefer und tiefer kennbar in seiner ruhigen, gelassenen Weise, vergleicht Gotamo, nur als Arzt, die Sucht nach Paarung der Schlafsucht und der Trunksucht. »Drei kann man, ihr Mönche, immer wieder pflegen und [831] wird nicht satt: und welche drei? Schlaf kann man, ihr Mönche, immer wieder pflegen und wird nicht satt; berauschende und berückende Getränke kann man, ihr Mönche, immer wieder pflegen und wird nicht satt; Paarung begehn kann man, ihr Mönche, immer wieder pflegen und wird nicht satt. Das sind, ihr Mönche, die drei, die man immer wieder pflegen kann und wird nicht satt.« Anguttaranikāyo III Nr. 109 (PTS 104).
831 Mit S etc. richtig sakid eva catūhāya, beidemal.
832 Evaṃ bho ti kho so Vāseṭṭhā satto tesaṃ sattānaṃ mit S etc. Vorher ist im Mahāvastu I 348, 3 an Stelle unserer legendär älteren, nicht näher bestimmten Angabe sālīnam bhāgam, »ein Teil der Reisernte«, in sozusagen mehr geschichtlicher Fassung bemerkt ṣaṣṭhaṃ ālibhāgam, »den sechsten Teil vom Reis«; offenbar mit Rücksicht auf die wirklich bestehenden Staatsgesetze, wie nach Manus VII 150f. Der Kāh-gyur hält in seiner Übersetzung hier die Mitte und begnügt sich mit den Worten »einen entsprechenden, gesetzlichen Anteil (von der Ernte)«, nach SCHIEFNER, in dessen früher genannter Abhandlung (cf. Anm. 802) auf Seite 6, und ebenso der chinesische Kanon, in BEALS Catena p. 112. Auch dieser, scheinbar so unbedeutende Umstand weist der Legende, wie der Pāli-Kanon sie bewahrt hat, die ältere Stufe an. Er ist ein gutes typisches Beispiel zur Erkenntnis der mit den Zeiten und Orten erst sachte und kaum merklich und dann immer mehr und mehr sich verändernden und ausgestaltenden Überlieferung, bei verhältnismäßig noch frühen Schichten.
Die Einsetzung der Königswahl nach gegenseitig freiwilliger Übereinkunft aller Gleichberechtigten – ein Vorgang, der vom altverlogenen Gottesgnadenherrschertum scharf absticht und als der einzig richtige, längst schon zu verwirklichende Idealzustand eines menschenwürdigen Staatswesens altera parte altiori generi alteri dünken muß – diese tüchtig selbstbewußt geschaffene Verfassung, wie sie oben dargestellt wird, ist auch bei uns im Abendland einmal durchgeführt worden, gewissermaßen als eine prachtvoll gelungene Beglaubigung des so fernen indischen Vorbildes: und zwar von den tapferen Aragoniern des 12. Jahrhunderts, die genau so gesprochen und gehandelt haben wie es, nach unserer obigen Sage, einstens die Inder getan. Denn die Könige von Aragon hatten Versprechen und Eid auf eine solche Verfassung zur Wahrung einer wohlverstandenen und wohlgesicherten Freiheit aller mit allen im Palast von Saragossa vor der gesamten Bürgergemeinde abzulegen. Kurzgefaßt gibt MARIE VON BUNSEN in ihren Schilderungen aus Spanien den Vorgang so wieder, Deutsche Rundschau 1913 S. 273: »Der Justiciar mayor sah ihnen in die Augen und sprach die berühmte Formel: ›Herr, wir, von denen jeder ebenso viel gilt wie du, und die wir zusammen mehr gelten als du, erheben dich zu unserem König, damit du unseren Freiheiten, unseren Fueros, unseren Gesetzen Achtung verschaffst. Wenn nicht – nicht.‹ Das bedeutet: tust du das nicht, halten wir uns nicht an unsere Pflichten dir gegenüber gebunden.« Es ist also hier dieselbe sozialpolitische Klugheit und Stärke zu erkennen, wie sie uns oben im Text, etwa sechzehn Jahrhunderte früher schon, mit erquickender Offenheit begegnet. Die von Christentum und Kirche doch nicht ganz auszurodende Tüchtigkeit des spanischen Volkstums, das dem altindischen auch in manch anderer Hinsicht oft merkwürdig nahesteht, oft merkwürdig wahlverwandt anmutet, hat übrigens niemand besser aufgefaßt und bezeugt als ALFIERI, Vita III 12 gegen Ende, wo er sagt: fast der einzige Volksstamm in Europa, der sich, zumal in den tiefen und mittleren Schichten, noch die Art und Sitte bewahrt hat, sind die Iberer. Er hatte sie, nach seinem kernigen Ausdruck, als eine vorzügliche materia prima kennengelernt, sehr geeignet zur Hingabe an große Taten, hauptsächlich bei kriegerischer [832] Zucht; denn sie haben in hohem Grade alle Anlagen dazu: Mut, Ausdauer, Anstand, Gelassenheit, Gehorsam, Geduld und erhabene Gesinnung. – Auf den Vorplatz zur freien Volkswahl oben im Text, der in vedische Räume hinaufreicht und von der brāhmanischen Kultur bereits gründlich gepflastert worden war, ist in der Anm. 605 letzter Absatz hingewiesen. Das Verhältnis zeigt sich demnach vollkommen gemäß der theoretischen Erörterung des HELVÉTIUS, über die Wahl der höchsten Obrigkeit, schon in seiner Épître sur le plaisir kurz formuliert:
Pour réprimer ces maux, on vit dans les États
Le public intérêt créer des magistrats.
Chargés de protéger la trop foible innocence,
La loi leur confia le glaive et la puissance:
On jure entre leurs mains de soutenir leurs droits;
Ils jurent, à leur tour, de maintenir les lois.
Diese Theorie zur Praxis der alten Inder und Aragonier ist in der Rechtslehre SCHOPENHAUERS wirklich ganz ehrlich zu Ende gedacht: »Der große Werth, ja die Grundidee des Königthums scheint mir darin zu liegen, daß, weil Menschen Menschen bleiben, Einer so hoch gestellt, ihm so viel Macht, Reichthum, Sicherheit und absolute Unverletzlichkeit gegeben werden muß, daß ihm für sich nichts zu wünschen, zu hoffen und zu fürchten bleibt; wodurch der ihm, wie Jedem, einwohnende Egoismus, gleichsam durch Neutralisation, vernichtet wird, und er nun, gleich als wäre er kein Mensch, befähigt ist, Gerechtigkeit zu üben und nicht mehr sein, sondern allein das öffentliche Wohl im Auge zu haben.« Hauptwerk II Kap. 47 Mitte. Oder wie, sehr knapp aber nicht minder deutlich, Gotamo selbst es gesagt: Der mit der Königsweihe gesalbte Kriegerfürst ist des Wunsches beschwichtigt worden, ein Mensch, der keinerlei Hoffnung mehr hegt, Anguttaranikāyo III Nr. 13, ed. Siam. p. 135-137: ein Bild gegenüber dem Wahnversiegten, der auch nichts mehr zu erhoffen hat.
833 Die Ableitung brāhmaṇo, Priester, von bāhitā, als partizipial oder gerundiv karmaṇi geprustet, oder substantivisch als actu kartari Prüster, an Stelle von barhādi = purogaḥ, πρεσβυς, priscus, ist eine beliebte Umdeutung, wie dergleichen seit den ältesten Zeiten gebräuchlich war, siehe die häufigen, meist volkstümlichen Beispiele in Mantram und Brāhmaṇam; wo man ja dem nāmakāyagrahaṇamātram nicht weniger wie anderwärts huldigte, also längst schon im Sinne SEBASTIAN FRANKS, der sagt: »Böser Nam tödt den Man«, nach der oft bestätigten Maxime: Conveniunt rebus nomina saepe suis, oder besser wie Toxilus im Persa des PLAUTUS zu bemerken findet: Nomen atque omen quantivis est pretii. Die Römer waren immer der Ansicht, belehrt uns AGRIPPA VON NETTESHEYM, »infaustis nominibus in felicia mutatis, rerum quoque fortunam in melius mutari«, De occulta philosophia, Lyoner Ausgabe 1550, p. 557. Aber insbesondere bei den Griechen spricht PLATON höchst anregend darüber, im Kratylos p. 394-396, wo er die tiefwurzelnde Bedeutung der Dinge und ihrer Bezeichnungen aufweist und die Namen vieler Heroen erklärt, z.B. den Atreus κατα το ατειρες και κατα το ατρεστον και κατα το ατηρον, nach seiner Unbändigkeit, Unerschrockenheit und Vermessenheit, und daß ihm der Name ganz richtig so zukommt: er heißt und ist ein »Hartmuth«. Bei uns wurde dann, umgewandt, ein Muothart daraus, Muotshart und – MOZART. Noch bei den großen indischen Dichtern kehren dergleichen Deutungen wieder, und Kālidāsas hat keinen Anstand genommen vom König und seiner höchsten Würde und Eigenschaft zu erklären
[833] tathaiva so 'bhūd anvartho
rājā prakṛtirañjanāt:
So war er wirklich für das Volk
Der Fördrer, darum Fürst genannt,
nach der anvarthasaṃjñā oder dem anvarthagrahaṇam: ein Wort in dem Sinne auffassen und darlegen, der am nächsten liegt, sich von selbst ergibt, der dem Ausdruck eigentümlich ist, keiner weiteren Ansage oder Übereinkunft bedarf, Raghuvaṃ am IV 12. Hierbei ist eine allgemein indo-europäische Neigung unverkennbar, ein leichtes Hinüberschwingen der Sprachgeister und -meister in einer Laune, die witzig gedeutet, bald geglaubt bald bespöttelt wurde. Ich erinnere hier an SHAKESPEARES »mollis aer we term it mulier«, Cymbeline, oder an die gelungene Auslegung PHILOSTRATS: die Amazonen heißen so, weil sie ihren Kindern als Ammen entzogen Stutenmilch geben, ονομα ταις Αμαζοσιν εκ του μη μαζῳ τρεφεσϑαι κτλ., Heroika gegen Ende. Gut meint es CICEROS Etymon von Jupiter, »id est iuvans pater, quem conversis casibus appellamus a iuvando Iovem«, De natura deorum II 25. Recht indisch ist auch der Name Augustus paryāyeṇa erklärt, bei SUSTON 7 i.f.; ab auctu, vel ab avium gestu gustuve, sicut etiam ENNIUS docet scribens:
Augusto augurio postquam inclyta condita Roma est.
Das erweitert nun wieder RAYMUNDUS LULLIUS in seiner Rhetorica: Ut AUGUSTUS rempublicam auxit Romanam, ita litterarum et ecclesiae AUGUSTINUS. So wurde wiederum der Name RAYMUNDUS in Spanien bei San REYMUNDO DE PEÑAFORTE, dem Vorgänger des LULLIUS und Verfasser der Summa Raymundiana und endlich hundertjährigen Anachoreten, als Rey del mundo, König der Welt, erklärt, nach GRACIANS Discurso XXXI: De la agudeza nominal. Und der berühmte Scholastiker NECKAM hat das Epitaph bekommen:
Vir bene discretus, et in omni more facetus:
Dictus erat Nequam, vitam duxit tamen aequam.
Das bedenkliche Verhältnis, das oft wie ein Verhängnis über Namen und ihren Deutungen zu walten scheint, hat GOETHE lebhaft empfunden, als HERDER ihm den Namen von Göttern, von Gothen oder vom Kote ableiten wollte: »denn der Eigenname eines Menschen ist nicht etwa wie ein Mantel, der bloß um ihn her hängt und an dem man allenfalls noch zupfen und zerren kann, sondern ein vollkommen passendes Kleid, ja wie die Haut selbst ihm über und über angewachsen, an der man nicht schaben und schinden darf, ohne ihn selbst zu verletzen.« In unseren Texten wird, nebst vielen ähnlichen, insbesondere die oben aus der alten legendären Erzählung hübsch entwickelte Ableitung gern wiedergegeben. Man wußte wohl, daß sie zwar nicht dem Etymon, dem wurzelhaften Sinn oder yogas entsprach, um so besser aber der Konvention, der hergebrachten Annahme oder rūḍhi, nach bāh, bāhṛ, prayatne, jehṛ, gatyartho 'pi, wofür sich sogar der Dhātupāṭhas erklärt: lauter Worte für nichts anderes als ausprusten, kräftig von sich geben, d.i. ausspeien, sich entleeren, entäußern, reinigen, nämlich von den schlimmen, unheilsamen Dingen; wie dies eben dem wirklichen Priester zukommt, sein Kennzeichen sein soll, die Art und Weise wie er, nach unserer alten Litotes zu reden, durch Ausprusten zum Prüster und daher zum Priester wird. Diese unermüdlich, prayatne, erworbene Reinheit von allem Bösen, pāpabāhitatā, ist dann, dem Volke gegenüber, sein auszeichnendes [834] Merkmal geworden, ihm schlechthin eigentümlich; und er gilt somit als bāhitapāpo brāhmaṇo, als »Priester, weil er das Böse ausgeprustet hat.« Ein uraltes Gegenstück dazu findet sich im Bṛhadāraṇyakam II, 2 Ende, wo einer der mächtigsten Seher der Vorzeit, der weise Atriḥ als attiḥ erklärt wird, und das heißt »Esser«, von 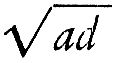 , atti essen: der nämlich hat alles Gute in sich genommen, während unsere brāhmaṇā als bāhitapāpā alles Schlechte von sich getan haben. Vergl. noch Mittlere Sammlung, Anm. 33 und Wahrheitpfad Anm. zu v. 388. Bei der Möglichkeit dieser glücklichen Wiedergabe indischer Begriffe und Wörter durch deutsche, die einander genau entsprechen und kaum etwas von ihrer Kraft einbüßen, kann man eine ähnliche Beobachtung machen wie beim Festmahl zu Ehren des Candide in Eldorado, wo der König bei bester Laune in der Landessprache geistreichelt, und der Diener des Gastes die königlichen Witzworte gleich erklärt: wobei diese, obzwar übersetzt, immer noch bons mots bleiben. Von allem aber, was den Gast dort in Erstaunen setzte, meint VOLTAIRE, sei das nicht das wenigste gewesen. – Unsere Priester nun sind, nach der obigen Legende und dem aus ihr gewonnenen Ergebnis, wieder die ersten besonnenen Menschen, die sich keinen Träumereien und keinen Täuschungen mehr hingeben, die das Leben kennen, Aufgeklärte, schon mit denselben Gedanken wie sie PETRARCA, in der fünften Ecloga, als Pietas pastoralis angeschaut hat:
, atti essen: der nämlich hat alles Gute in sich genommen, während unsere brāhmaṇā als bāhitapāpā alles Schlechte von sich getan haben. Vergl. noch Mittlere Sammlung, Anm. 33 und Wahrheitpfad Anm. zu v. 388. Bei der Möglichkeit dieser glücklichen Wiedergabe indischer Begriffe und Wörter durch deutsche, die einander genau entsprechen und kaum etwas von ihrer Kraft einbüßen, kann man eine ähnliche Beobachtung machen wie beim Festmahl zu Ehren des Candide in Eldorado, wo der König bei bester Laune in der Landessprache geistreichelt, und der Diener des Gastes die königlichen Witzworte gleich erklärt: wobei diese, obzwar übersetzt, immer noch bons mots bleiben. Von allem aber, was den Gast dort in Erstaunen setzte, meint VOLTAIRE, sei das nicht das wenigste gewesen. – Unsere Priester nun sind, nach der obigen Legende und dem aus ihr gewonnenen Ergebnis, wieder die ersten besonnenen Menschen, die sich keinen Träumereien und keinen Täuschungen mehr hingeben, die das Leben kennen, Aufgeklärte, schon mit denselben Gedanken wie sie PETRARCA, in der fünften Ecloga, als Pietas pastoralis angeschaut hat:
Millia sunt hominum curarum, millia mille:
Quisque sibi sapiens, unde haec tibi somnia, frater?
Pellere pauperiem labor est mortalibus ingens,
Cui nunquam speranda quies; nos sorte maligna
Vivere per silvas vix ulla possumus arte.
834 Alte Asketenregel, hier wörtlich nach der Vorschrift Manus überliefert, VI 56:
Vidhūme sannamuṣale vyangāre bhuktavajjane
vṛtte arāvasampāte bhikṣāṃ nityaṃ yati caret.
Vītangārā vītadhūmā sannamusalā (so zu lesen) steht, wie häufig, für vītangārāya etc., also absoluter Instrumental; pāto pātarāsāya gehört hier nicht her, ist von den Abschreibern aus dem vorangehenden Abschnitt, wo es am Orte ist, mechanisch wiederholt worden. Vergl. noch Yājñavalkyadharma āstram III 59: Apramatta caret bhaikṣaṃ sāyāhne, nātisandhitaḥ. Auch schon im Sāmavidhānabrāhmaṇam, I 4, 1, wird der Asket angewiesen: bhaikṣārthāyaiva grāmaṃ pravi et, nur um die Almosenspeise zu empfangen soll er das Dorf betreten. Die Regel, wie Manus und unser Text sie gibt, war ebenso in der Paramahaṃsopaniṣat wiederholt, obzwar sie in den uns zugänglichen Ausgaben fehlt: in der persischen Vorlage des ANQUETIL DUPERRON war sie noch enthalten, da die Stelle von ihm wörtlich übersetzt wird: »(ubi) homines omnes escam coxerint et comederint, et fumus in domo eorum non fuerit, et ignis in domibus lumen non sit, et mendici omnes, ut mendicationem egerint, abierint; in illo tempore, propter robur (corporis servandum) in urbem veniat; et cum domo (ad domum aliquam) eat; quòd (ubi) aliquis eum non cognoscat, et honorem ei multum non faciunt«, Oup nek'hat, Straßburg 1802, II 284. Vergl. noch WEBER, Indische Studien II 175. Übereinstimmend mit dieser Speiseregel vedischer Asketen berichtet, beiläufig gesagt, ATHANASIOS in seiner Biographie des ägyptischen ANTONIOS: er aß einmal des Tags nach Sonnenuntergang, ησϑιεν τε άπαξ της ἡμερας μετα δυσιν ήλιου, ed. Augsburg 1611 p. 13. – Dem Herausgeber nun der Pāli Text Society waren die Beziehungen verborgen, er hatte wie gewöhnlich keine[835] Ahnung vom Inhalt, geschweige daß er die Parallele zu Manus gemerkt hätte. Seine Textredaktion ist daher fehlerhaft und als Material zu einer Übersetzung unbrauchbar. R. OTTO FRANKE hat nach solcher Vorlage kürzlich auch dieses Stück zu übersetzen versucht, in seiner Auswahl aus dem Dīghanikāyo, Göttingen 1913. Die betreffende Stelle lautet bei uns oben im Text, S. 485 richtig, wie gezeigt vollkommen sicher gegründet, so: »Sie haben nun tief im Walde sich Hütten aus Laub errichtet und dort ein beschauliches Dasein geführt. Wenn die Kohlen am Herde verglühn, der Rauch sich verzogen hat, in der Küche nicht mehr gerührt wird, am Abend, da sind sie um das Abendmahl nach den Dörfern, Märkten und Städten hinabgestiegen, die Reste der Mahlzeit einzusammeln.« FRANKE aber hat sich um eine kritische Textgestaltung gar nicht gekümmert und auch hier verschwenderisch mit Fragezeichen drauf losgearbeitet. Er sagt, S. 282: »Sie errichteten sich Blätterhütten in der Einöde und trachteten darin nach der Versenkung, ohne einen Funken Feuer und ohne Rauch (auf dem Herd), mit Mörserkeulen, die (höchstens?) aus (zusammengerollten?) Blättern bestanden (?), gingen sie abends zum Abendessen und morgens zum Frühstück in die Dörfer, Flecken und Hauptstädte, um Essen zu bekommen.« Das ist gestammelter Unsinn, aus Mangel an Bekanntschaft mit den kulturhistorischen Grundlagen unserer Texte; wie denn überhaupt die ganze, sehr fleißige aber immer wieder mit verdrehten Begriffen angepackte Arbeit dieses etwas schusseligen Gelehrten in bezug auf die Kenntnis des Pāli und was damit zusammenhängt, auch mit dem unaufhörlich aus der Präparationsmühle schlabbernden Schwappergeplapper, leider noch unter dem Pegel bleibt, wo etwa ein zeilonesischer Junge sich zu schneuzen beginnt und Texte buchstabiert oder bei uns ein Tertianer die Ilias zerhackt. Seine Schöpfung wird sich jedem beim ersten Prüfen schon als ein im Spülicht aufgedunsenes Mondkalb erweisen, ein armer ausgebluteter Abortus, partus immaturus. Und der wird auch dadurch nicht lebensfähig, daß in der Einleitung zu diesen, von seiten der Königlichen Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen herausgegebenen »Quellen der Religionsgeschichte« meine zunächst gern bestohlenen Arbeiten – das bin ich nun freilich schon von mancher Seite gewohnt, aber erst jetzt unter königlicher Flagge – zwanzig Quartseiten lang wütend mit stinkendem Geifer bespien und verleumdet werden, um nämlich durch Verschweinigeln Gäste zu verscheuchen und abzuhalten nach den verpönten Früchten zu greifen, die trotz aller vereinten schändlichen Mühe nicht mehr zu verbergen und verheimlichen und nicht zu vernichten sind, uff! Es ist das eine Tapferkeit, die verzweifelt an die russischen Kriegsberichte erinnert, auf die man mit BISMARCKS »à corsaire corsaire et demi« erwidern muß; ob ja schon, wie mir scheint, die Urteilslosigkeit der Menge und die Tücke der Gewerbsleute schließlich doch wohl selbst genügen und auf eine zu schwere Probe gestellt sein werden, will sagen: es kommt wuppdich zum avaṃsiropapatanam oder εκκυβιστημα, praecipitatus, Kopfüberhinkollern, Burzelbaumschlagen, culbuter, ärschlings zum Teufel gehn, wie es GOETHE verdeutscht; weil ja Dies cedens schon in Kraft getreten ist, nach
Tribonian und Notar April,
Der zu Regensburg von der Treppe fiel.
Oder nach dem lustigen Bildchen im Pañcatantram:
Und springt auch die Erbse jach empor,
Sie sprengt den Bratherd nicht entzwei.
[836] 835 hīnasammataṃ taṃ kho pana zu lesen. Vergl. vorher S. 482. – In Hinsicht auf eine solche Veränderung in Sitte und Lebensart und das immer weitere Abweichen vom einstigen Brauch und Gebot äußert sich, im besten Einvernehmen mit unserer obigen Rede, TERTULLIAN im Apologeticus, am Ende des sechsten Kapitels: Habitu, victu, instructu, censu, ipso denique sermone proavis renuntiastis. Laudatis semper antiquos, sed nove de die vivitis. Per quod ostenditur, dum a bonis maiorum institutis deceditis, ea vos retinere et custodire quae non debuistis, cum quae debuistis non custoditis.
Das Verfassen von Schriften ist oben im Text, echt indisch, als minderwertig bezeichnet. Denn die hohe Art von Wissen ist rein persönlich angesehn: vijjācaraṇasampanno, wissend und wandelnd muß man bewährt sein, wie der Spruch am Ende unserer Rede sagt. Es folgt an zweiter Stelle die kaṇṭhasthā ruti, die Wissenschaft, die man in der Kehle hat, die mündlich überlieferte, Wort um Wort genau gemerkte und bewahrte Kunde, das Wissen der Gelehrten, die mantravidyā der Vedenkenner: Chāndogyopaniṣat VII 1, 3, Bṛhadāraṇyakam VI 1, 4 usw. Und an letzter Stelle kommt das Wissen, das man nur schriftlich zusammengetragen hat, in Schriftzeichen niederlegt, die geringste Art der Wissensbetätigung, die Schriftstellerei, das Büchermachen, ganthakaraṇam, das die »Fleißigen« oben betreiben. Diese Kunst galt im alten Indien sehr wenig, wenn sie auch keineswegs vernachlässigt wurde. BÜHLER hat mit aller wünschenswerten Ausführlichkeit nachgewiesen, daß der Gebrauch der Schrift um Jahrhunderte vor Gotamo zurückreicht, in der Abhandlung »On the Origin of the Indian Brāhma Alphabet«, 2. Aufl. Straßburg 1898, S. 5-27. Der Meister der indischen Paläographie, mein unvergeßlicher Lehrer, war da bereits zu dem Ergebnis gekommen: »The introduction of writing cannot have taken place about 400 B.C., but must be earlier at least by some centuries.« Ein in doppelter Hinsicht bedeutsames Beispiel, das die sicher schon vorasokische Pflege der Inschriften bezeugt und zugleich eine recht bedingte Würdigung der bloß aufgeschriebenen Kunde und Kenntnis zu verstehn gibt, bietet Anguttaranikāyo III No. 133 (PTS 130), ed. Siam. p. 369f. Da werden dreierlei Arten von Menschen gezeigt: und sie werden verglichen einer in Felsen gegrabenen Schrift, einer auf den Erdboden geschriebenen und einer ins Wasser gezeichneten. Ein Mensch von der ersten Art ist einer, der leicht zornig wird, und bei dem der Zorn lange anhält: gleichwie etwa die einem Felsen eingeritzte Schrift nicht so rasch durch Wind oder Wasser zerstört wird, lange bestehn bleibt. Menschen der zweiten Art werden leicht erzürnt, aber der Zorn dauert nicht an: wie die auf die Erde gezeichnete Schrift durch Wind oder Wasser bald verlöscht wird, nicht lange bleibt. Und ein Mensch der dritten Art wird, wenn auch angefahren, grob und unfreundlich behandelt, sich gleich wieder sammeln, besänftigen und verglätten: wie die in das Wasser gezeichnete Schrift sich auch schon wieder verzogen hat, nicht lange bestehn kann. – Die Wesen, die so nun »Priester«, dann »Geistliche« und dann nur mehr »Fleißige« geworden waren, führen immer noch ein eheloses Leben: die Wahl einer Gattin kommt erst dem »Bürger« zu, wie aus dem folgenden Absatz im Text oben hervorgeht. Denn auch den »Fleißigen«, wenn sie gleich nur mit dem »Verfassen von Schriften beschäftigt« sind, wäre nach vedischer Sitte und Gewöhnung Hausstand und Familie hinderlich. Der richtige »Fleißige«, ajjhāyako, adhyāyakas, ist ein amātāputrādhyāpakas, »ein Gelehrter, der weder Mutter noch Kind kennt«, nach der Kā ikā zu Pāṇinis VIII 1 67, vergl. GOLDSTÜCKERS Dictionary s.v.; wie das nicht minder einleuchtend unser »Fleißige«, der gelehrte und vielbewanderte und -gewanderte KONRAD CELTES in einer seiner Oden, III 23, bestätigt, angeführt in BRUCKERS Historia critica philosophiae IV 1 p. 452:
[837] rara libris cura, ubi foeminae
Quieta turbant tecta philosophi,
Diesque ac noctes cor mariti
Per stimulos agitant acerbos.
Darum schließt auch der hochweise Mágico prodigioso die jornada primera so ab:
Ni libros ni estudios quiero,
Porque digan que es amor
Homicida del ingenio.
Eine gleiche Erfahrung ist bei den Pythagoreern fein angedeutet, Bruchstücke der Reden Anm. 814.
836 brāhmaṇo pi Vāseṭṭhā mit S.
837 Besser mit S vimissadiṭṭhiko und sukhadukkhaṃ paṭisaṃvedī hoti. In Zeilon hat man an vītimissā aus der 47. Rede der Mittleren Sammlung anknüpfen zu sollen vermeint, was aber in anderem Zusammenhange steht und hier nicht hergehört. Auch die barmanischen Handschriften haben übrigens oben bei uns das echte vimissa überliefert.
838 Über einen Bauer, der bei Gotamo Asket wurde, ist im Saṃyuttakanikāyo ein kurzer Bericht erhalten. Er war ein schlichter Knecht, ein ganz gewöhnlicher Rinderhirt, der auf den Wiesen in der Au am Ganges bei Kosambī die Kühe seines Herrn weidete. Eines Tages nun war Gotamo, wie immer von Ort zu Ort wandernd, mit den Jüngern dorthin ans Gestade gekommen. Er sah da, wie ein Stück Holz im Flusse hinabtrieb, und nahm alsbald diesen Anblick zum Ausgangspunkt einer Rede, worin er den Mönchen in trefflicher, innig ermunternder Weise veranschaulichte, wie dieses Stück Holz etwa doch noch auf dem langen Wege bis zur Mündung und ins Meer gelangen könne, unbeschadet der vielen, vielen Hindernisse, als wie des Antreibens rechts oder links oder mitten auf eine Sandbank, des Hängenbleibens am Ufer, des Fassens und Wegschleppens durch Menschen oder Nichtmenschen, des Untersinkens im Strudel, oder des innen Fauligwerdens und Zerfallens; entgeht es aber all diesen möglichen Umständen, dann kann es zum Meer gelangen, weil eben die Strömung des Ganges nach dem Meere sich neigt, nach dem Meere sich beugt, nach dem Meere sich hinsenkt: ebenso nun auch kann der Jünger zur Erlöschung gelangen, wenn er es versteht den Gefahren, die nun auf seinem Wege zum Ziel entsprechend verglichen werden, auszuweichen. Während Gotamo aber so diese anschauliche, wie von selbst verständliche Darlegung gab, war Nando, wie er hieß, der Bauer, der Rinderhirt, in der Nähe gestanden und hatte aufmerksam zugehört. Und der rauhe Landmann, ohne jede Bildung und Verbildung aufgewachsen, war da so mächtig ergriffen, daß er den Meister unverzüglich um Aufnahme bat, ihn anflehte, sogleich bei ihm bleiben und ihm nachfolgen zu dürfen: denn er wolle nicht, wie etwa jenes Stück Holz, an einer Sandbank scheitern, oder angetrieben und weggeschleppt werden, oder im Strudel versinken, und auch nicht innen faulig werden. Darauf sagt ihm nun Gotamo: »Wohlan denn, Nando, so bringe die Kühe den Eignern zurück.« Der Hirt aber antwortet: »Die werden schon gehn, o Herr, aus Liebe zu ihren Kälbern.« – »Bringe sie doch erst, Nando, den Eignern zurück«, weist ihn Gotamo an. Es geschieht. Der Hirt kehrt wieder, wird aufgenommen, erhält die Ordensweihe. Nicht lange aber, heißt es nun weiter, war der ehrwürdige Nando in den Orden aufgenommen, da hatte er, einsam, abgesondert, unermüdlich, in heißem, innigem Ernste gar bald was edle Söhne gänzlich vom Hause fort in die Hauslosigkeit lockt, jenes höchste Ziel des Asketentums noch [838] bei Lebzeiten sich offenbar gemacht, verwirklicht und errungen. ›Versiegt ist die Geburt, vollendet das Asketentum, gewirkt das Werk, nicht mehr ist diese Welt‹ verstand er da. Auch einer war nun der ehrwürdige Nando der Heiligen geworden. (Bd. IV S. 222-225 der ed. Siam., in der Pāli Text Society 179-181 fehlerhaft.) Ebendiesen Nando, den einstigen Bauer, rühmt und preist dann später einmal Gotamo und stellt ihn als Vorbild auf: einen Edelgeborenen dürfe man Nando mit rechtem Ausdrucke nennen, einen tapferen Mann, dessen Anblick erfreut, einen Tiefdurchdrungenen: wie anders wär' er als so imstande wachsam, klar besonnen im Orden das geläuterte, geklärte Asketenleben zu führen: Anguttaranikāyo, Aṭṭhakanipāto No. 9. Dieser frühere Bauer ist aber durchaus kein seltenes Beispiel der Art, gar manche Tiefstehende oder ganz und gar Ausgestoßene sind ohne weiters als Sakyersöhne aufgenommen worden, und gerade solche sind es oft gewesen, die dann sehr bald das letzte Ziel errungen haben. Denn die Rede Gotamos ist wie die Tatze des Löwen: was sie da trifft, hoch oder niedrig, das trifft sie gründlich, »bis herab zu den Speisenträgern und Fischerknechten«, Pañcakanipāto No. 99. Auch der niedrigst Geborne vermag hoch emporzukommen; und nur so spricht der Meister: »Kein Geringer, ihr Mönche, kann das Höchste erreichen, zuhöchst aber kann man das Höchste erreichen«, Saṃyuttakanikāyo II 27 (aggena ca kho aggassa patti hoti mit S, PTS 29 fehlerhaft). Nach Anlaß und Umstand vielfach verschiedene Berichte, außerordentlich schön in ihrer lebendigen Anschaulichkeit und Wahrhaftigkeit, finden sich zumal in den Liedern der Mönche, z.B. v 557-566, 620-631, 705-725, gleichwie auch in den Liedern der Nonnen, v. 23 bis 26, 72-76, 122-126, 291-311, wo man, bei der frei und gewaltig brausenden Erinnerung an das einst persönlich Erlebte, den Pulsschlag der Ereignisse deutlicher als irgendwo merken kann: wie das der rein improvisatorischen und rhapsodischen Weise dieser Urkunden eben vollkommen gemäß ist. Ein besonders merkwürdiger Fall ist uns auch in der Mittleren Sammlung aufbewahrt, in einer Reihe lose zusammenhängender Stücke, die einen Abriß der Geschichte Angulimālos geben, eines berüchtigten Räubers und Mörders, 657-665. Wie dieser, als Abschaum der Menschheit von allen verflucht und geächtet, einst Gotamo antrifft und, plötzlich erschüttert, alsogleich Zugang erhält, kündet er selbst in folgenden Strophen:
Schon lang ist's her, als einst der hohe Meister,
Der Mönch erschienen mir in Waldes Mitte:
Da rief ich aus: »Entsagen tausend Sünden
Will ich um eines Wortes deiner Wahrheit!«
Ein Räuber war ich, ja, war Mord und Marter,
War grausam, gräßlich wie die Höllengründe:
Zu Füßen lag der Räuber dem Willkommnen,
Den Auferwachten fleht' er an um Weihe.
Und Er, der auferwacht ist, mild und heilig,
Der Herr der Welt mit allen ihren Göttern,
»So komm', o Jünger!« sprach zu mir der Meister,
Nahm also auf mich in den Jüngerorden.
Und dieser verruchte, von allen verfluchte blutrünstige Würgerich, ein Greuel und Scheuel der Leute, der viele hunderte umgebracht hatte, zur Lust an Mord und Totschlag gewohnt, war von der Wurzel aus umgewandelt, neugeboren, »ohne Strafe und ohne Schwert bezwungen worden«, wie es dann weiter heißt, von dem, der »Unbändige [839] bändigt, Unstillbare stillt, Unaussöhnliche aussöhnt.« Und: »Auch einer war nun der ehrwürdige Angulimālo der Heiligen geworden.« Er war an die Grenze der äußersten Verworfenheit gelangt: »da brach der Strom die Bresche durch« und trieb ihn zum anderen Ufer hin. Dieser erstaunlichen Umwandlung, Einkehr und Aufnahme eines gänzlich Verkommenen und Ausgestoßenen steht als lehrreiches Gegenstück die Bekehrung eines anderen, eines Vatermörders, gegenüber, des Königs Ajātasattu von Magadhā, der zwar seine furchtbare Schuld vor Gotamo bekennt und bereut und sich nunmehr als Anhänger erklärt, gleichwohl aber von einer wirklichen Aufnahme weit entfernt bleibt: Ende der 2. Rede. Geburt, Kaste, Vorrecht, Vorurteil, konnte hier so wenig wie dort helfen. Auch das Christentum ist übrigens dieser Anschauung treu geblieben, schon vom mitgekreuzigten gelehrig umgewandelten Verbrecher an, der zugleich mit dem Heiland von allem Gesetz erlöst ist, nach LUKAS 23, 40-43. Darum sagte recht gut einmal der Abbé FURETIERE, zitiert von BAYLE in seinem Artikel über PASCAL fol. 606 No. 38: »Es gibt Heilige, die Advokaten waren, Soldaten, sogar Schauspieler: kurz, es gibt keinen Stand, so niedrig er auch sein mag, aus dem Heilige nicht hervorgegangen wären; aber Staatsanwalt ist keiner gewesen.« Volksmäßig ist dergleichen Erfahrung in einer alten Legende aus dem Paderbörnischen ungemein ansprechend von GRIMM gegeben, Märchen No. (200) 6: Die drei grünen Zweige.
839 Vergl. Mittlere Sammlung, Anm. 50. Zur Gestalt des Ewigen Jünglings in der Sage ist in unserer 18. Rede S. 325f. das nähere zu finden. Den selben Spruch wie oben sagt der Meister als einmal einer der besten Redner des Ordens, der ehrwürdige Mahākappino, auf Besuch kommt, Saṃyuttakanikāyo II vorletztes Stück: »Seht ihr wohl, Mönche, den Mönch dort heranschreiten, den blassen, schmächtigen, spitznasigen?« – »Ja, o Herr.« – »Das ist, ihr Mönche, ein hochmächtiger Mönch, ein hochgewaltiger. Nicht leicht kann man wohl eine Einkehr zu sich finden, die von diesem Mönche nicht schon erreicht worden wäre. Warum aber edle Söhne gänzlich vom Hause fort in die Hauslosigkeit ziehn, jenes höchste Ziel des Asketentums hat er noch bei Lebzeiten sich offenbar gemacht, verwirklicht und errungen.« Also sprach der Erhabene. Als der Willkommene das gesagt hatte, sprach fernerhin also der Meister:
»Der Krieger ist der höchste Herr
Von allen, die von Adel sind;
Der wissend, wandelnd ist bewährt
Ist höchster Herr bei Gott und Mensch.
Bei Tage strahlt der Sonne Licht,
Bei Nacht der milde Mondenschein,
In Waffenglanz der Krieger strahlt,
Der Priester strahlt in sich vertieft:
Den ganzen Tag, die ganze Nacht
Erstrahlt der Wache hell verklärt.«
Über das für jeden Beruf, jeden Stand, jede Rasse gleiche Recht, als die einige und die allein sittlich gegründete Weltordnung, hat Gotamo oft und immer in der so zutreffenden, im besten Sinne zeitgemäß – weil zeitlos – anmutenden Weise gesprochen: am ausführlichsten in der 96. Rede der Mittleren Sammlung. Er ist es gewesen, der zuerst auf dieser Erde gleiches Recht für alle verkündet und begründet und damit die starre Priesterdoktrin seiner Zeit und seines Landes geistig überwunden hat. Im wirklichen [840] Leben hatte persönliche Tüchtigkeit ohne Zweifel schon lange vorher auch in Indien diese zur Selbsterhaltung gegen fremde Stämme einst notwendig gewesene Schranke manchmal durchbrochen. Ein starker Beweis hierfür ist der sogar von den Priestern überlieferte Bericht aus der Chāndogyopaniṣat, wo ein Bastard, der Sohn einer Magd, die ihm den Vater gar nicht anzugeben weiß, durch eigene Lauterkeit und Wahrhaftigkeit zur höchsten Weihe und Priesterschaft emporgelangt IV 4-9. Von dem in der Ṛksaṃhitā vielgepriesenen Landesfürsten Paijavanas, dem Förderer und Freunde des priesterlichen Sehers Vi vāmitras, bringt das Mahābhāratam XII 2306 in Erinnerung, daß er, obzwar von Geburt ein ūdras oder Bauer, unermeßliche Macht erwarb und hunderttausendfache Gaben verschenkte, ūdraḥ Paijavano nāma sahasrāṇāṃ ataṃ dadau: von WEBER schon 1851, im 2. Bande der Indischen Studien S. 194, angemerkt. Ein anderes Beispiel, wie ein ganz Ausgestoßener, ein Paria, ein kastenloser Caṇḍālas, trotzdem allgemeine Anerkennung und Verehrung seiner Verdienste erwirbt, ist nach altvedischer Überlieferung in den Bruchstücken der Reden, v. 137 bis 139, vorgeführt: ein Mann, heißt es da, der Sohn eines Schinders, jener völlig verworfenen Kaste der Hundefleischesser entsprossen, Mātango, wie er nach seiner niederen Abkunft genannt wurde, der war hochgefeiert, hochberühmt, eben infolge seiner vortrefflichen Eigenschaften, seiner Tüchtigkeit, seiner heilsamen Betätigung:
Den höchsten Ruhm gewann er hier,
Mātango, wie kein andrer kaum:
Ihm aufzuwarten kamen sie,
Der Fürsten viele, Priester viel.
Gotamo führt dieses altüberkommene Beispiel dem hochmütigen Feuerpriester Bhāradvājo gegenüber an um ihm zu zeigen, daß ehedem schon, nach gültiger Sitte der Vorzeit, nicht die Geburt sondern die Tat den Stand des Menschen bestimmt hat, wie er ist und was er gilt. Durch diese, im gegebenen Falle sehr passende Erinnerung an Mātango wird denn auch der stolze Priester alsbald von der Sittlichkeit der gotamidischen Rechtslehre überzeugt. Mātangos Geschichte war ihm ja aus der Taittirīyopaniṣat geläufig, wo der Mātanger als höchster Caṇḍālas sogar den königlichen Titel und Namen Tri ankus trägt. Denn daß der Tri ankus der Upanischad und unser Mātango wirklich ein und derselbe ist, der zu unwidersprochenem Adel gereifte Paria, das war bis in die späten Kreise des Divyāvadānam unvergessen geblieben, wo er uns als Tri ankur nāma Mātangarājā wiederbegegnet, p. 621. Auf diese bestimmte Erzählung mit ihrer allgemeinen Gültigkeit bezieht sich offenbar noch der Spruch im Subhāṣitārṇavas, in BÖHTLINGKS Sammlung 26912:
In jedem Stande gibt's Geschmeiß,
In jedem Stande Priestertum:
Geschmeiß kommt auch bei Priestern vor,
Wie Priester vorkommt bei Geschmeiß.
Vergl. ferner die verwandte wichtige Stelle in der Bearbeitung im Kāh-gyur, die CSOMA KÖRÖSI angezeigt hat, in der Ausgabe von FEER, Annales du Musée Guimet, Paris 1881, Bd. 2 S. 287 No. 11, und die dazugehörigen Verse aus der Vajrasūcī des [841] A vaghoṣas, beigebracht in der Mittleren Sammlung Anm. 273 u. 307. Zu der an letzterem Orte herangezogenen Bemerkung KANTS aus der Abhandlung »Von den verschiedenen Rassen«, daß nämlich alle Menschen auf der weiten Erde zu einer und derselben Naturgattung gehören, so große Verschiedenheiten auch sonst in ihrer Gestalt mögen angetroffen werden, ist weiterhin auf jenes Wort in der Kritik der reinen Vernunft (II 2 2, 3, 7 2 gegen Ende, ed. ROSENKR. p. 517/18) hinzuweisen, über die Verschiedenheit der Maximen der Naturmannigfaltigkeit oder der Natureinheit, welche sich gar wohl vereinigen lassen: »aber solange sie für objektive Einsichten gehalten werden, nicht allein Streit sondern auch Hindernisse veranlassen, welche die Wahrheit lange aufhalten, bis ein Mittel gefunden wird, das strittige Interesse zu vereinigen und die Vernunft hierüber zufriedenzustellen.« Ein solches Mittel nun hatte Gotamo mit überstrahlender Klarheit gezeigt, als er sagte, Mittlere Sammlung S. 741, ed. Siam p. 595: Ariyaṃ kho pana ahaṃ brāhmaṇa lokuttaraṃ dhammaṃ purisassa sandhanaṃ paññāpemi: »Ich aber, Priester, verkünde ein heiliges, überweltliches Recht als Besitztum des Menschen.« Und damit wäre denn der Kreis der Betrachtung wieder am Ausgang unserer Rede vom Voranfang angelangt. Man darf hier aber ja nicht vergessen, um eben die Vernunft, wie KANT sagt, zufriedenzustellen, daß Altindien von unserem heutigen Völkerbrei und der greulichen Rassenvermischung, -kreuzung, -verquerung weltenweit entfernt war. Es müßte daher als jesuitisch oder verlogen gelten, wenn man nicht ehrlich, ohne reservatio mentalis und ohne Rücksicht auf springgiftige Neider und Finsterlinge bekennen wollte: infolge der kunterbunten Promiskuität und Epikoinonie oder Verwurstlung unserer Gesellschaft erscheinen, bei hoch wie bei niedrig, nicht selten auch Typen, die sich z.B. als mehr einem Berber, einem Neger, oder gar dem Azteken, Pescherä usw. unverkennbar verwandt darstellen, sei es blutverwandt sei es wahlverwandt, die also jedenfalls in eine merklich tieferstehende Menschenentwicklung einschlagen, jenen Spielarten und Abarten zugehören, die in der Regel völlig unfähig sind ein »überweltliches Recht als Besitztum des Menschen« auch nur zu ahnen, geschweige zu verwirklichen; es sei denn, es hätte hie und da einmal einer oder der andere wie LESSINGS Tempelherr
Geträumt, ein Jude könn' auch wohl ein Jude
Zu sein verlernen;
daß er bis zur wurzelständigen gemeinsamen Entelechie vorzudringen und die angeborene Rasseneigentümlichkeit in unermüdlichem Kampfe umzuschaffen vermöchte, mit dem Doctor Marianus sich
zu seligem Geschick
Dankend umzuarten.
Der wäre dann auf dem Wege, wie der Spruch Brahmās, Des ewigen Jünglings, die Rede oben ausleitet, »der höchste Herr bei Gott und Mensch« zu werden: vollzähligen Feingehalt zu erwerben, seinen Arithmos zu erreichen, Summe und Inbegriff zu verwirklichen, die letzte ογδοας oder aṣṭamī zu erleben, den Feiertag, an dem nichts mehr zu schaffen übrig ist; yad vai neti na preti yat sthitaṃ, tad aṣṭamasyāhno rūpam, Aitareyabrāhmaṇam V 18 1. Er geht und schlägt nach allen Seiten, wie der König im Schachspiel, nur einen Schritt weit ringsum, aber in die Runde der Stetigkeit vorgerückt. So auch war es der Gang Asokos gewesen, als er nach einer siebenunddreißigjährigen tapfer-gerechten Weltherrschaft, anders wie KARL V., jenseit jeglichen Königs- und Kastentums, auf dem Gipfel des Goldenen Felsens bei Rājagaham sein Leben als Einsiedler [842] beschloß, mit dem Stempel besiegelnd: »Kein Ding ist der Mühe wert«; ganz wie einer unserer glücklichen Armen gesagt hat:
Was wir außer uns erschwingen
Ist fürwahr der Müh nicht wert.
Eine sehr gute volkstümliche Kennzeichnung der Stände und Menschen überhaupt wird von Gotamo in einem Gespräch mit dem Priester Jāṇussoṇi, auf dessen Bitte hin, gegeben, im Anguttaranikāyo, Chakkanipāto No. 52: »Die Krieger sterben nach Reichtum, suchen Weisheit zu gewinnen, Kraft erlangen ist ihr Zweck, die Erde haben ihr Wunsch, Herrschaft ihr Ziel. Die Priester streben nach Reichtum, suchen Weisheit zu gewinnen, Sprüche erlangen ist ihr Zweck, Opfer haben ihr Wunsch, brahmische Welt ihr Ziel. Die Bürger streben nach Reichtum, suchen Weisheit zu gewinnen, Handwerk erlangen ist ihr Zweck, Geschäfte haben ihr Wunsch, Geschäfte abschließen ihr Ziel. Die Weiber streben nach Männern, suchen Schmuck zu gewinnen, Kinder erlangen ist ihr Zweck, keine Nebenbuhlerin haben ihr Wunsch, Herrschaft ihr Ziel. Die Räuber streben nach Aneignung, suchen Besitz zu ergreifen, Waffen erlangen ist ihr Zweck, Finsternis haben ihr Wunsch, ungesehn bleiben ihr Ziel. Die Asketen streben nach Geduld und Milde, suchen Weisheit zu gewinnen, Tugend erlangen ist ihr Zweck, garnichts haben ihr Wunsch, die Erlöschung ihr Ziel.« Dieses Ziel nun ist oben im Text durch den abschließenden Spruch angedeutet, wo der »höchste Herr bei Gott und Mensch« gezeigt wird; entsprechend Saṃyuttakanikāyo ed. Siam. vol. III p. 73-75 (PTS 83f.): »Soweit, ihr Mönche, Wesen bestehn, soweit die Spitze des Daseins reicht: das sind die Ersten, das sind die Höchsten in der Welt, und zwar die Heiligen.«
840 Das Tor gilt als Eingang zur Ewigkeit, amatam, eigentlich Unsterblichkeit, wo es nämlich kein Geborenwerden, Altern und Sterben mehr gibt. Ebenso in unserer 14. u. 18. Rede, S. 209 u. 331, in der 26., 52. u. 85. der Mittleren Sammlung S. 191, 387 u. 651, auch im Saṃyuttakanikāyo, siehe Anm. 974, vorletzter Absatz am Ende: »an das Tor der Unsterblichkeit getreten.« Daher ist zu verstehn, warum Gotamo den Vollender einen »Riegelheber« genannt hat, ukkhittapaligho iti, Mittlere Sammlung 163. Ledig allen Ballastes vermag er, mit seiner Willenskraft, wirklich den Durchgang zu erzwingen, woran Faust, mit seinen Instrumenten beladen, verzweifeln muß:
Ich stand am Tor, ihr solltet Schlüssel sein;
Zwar euer Bart ist kraus, doch hebt ihr nicht die Riegel.
Auf die vermerkten, wohlbekannten Andeutungen und Hinweise des Meisters nimmt Sāriputto, im Gleichnis oben, mit Bezug wenn er sagt, daß einem jeden nur »eben durch dieses Tor« der Eintritt oder Austritt möglich sei.
841 Mit S etc. dhammassavanāya, sowie nachher uttaruttaraṃ paṇītapaṇītaṃ. – Das ganze vorangehende Stück ist in unserer 16. Rede, S. 238f. wiederholt. Es zeigt die Zuversicht des Anhalts, die in der Anschauung wurzelt und beim erfahrenen Jünger durch keinerlei wetterwendische Gezeiten und Gewalten irgend wieder verstört und verwaschen werden kann, nach der schönen Darstellung am Ende des Siṃsapāvanavaggo [843] des Saṃyuttakanikāyo, mitgeteilt in der Anmerkung zu v. 229 der Bruchstücke der Reden. Auch darf hier wohl einer Unterredung mit dem Sakkerfürsten Godhā gedacht werden, desselben, von dem die Strophen 842-865 der Lieder der Mönche überliefert sind; jener Unterredung, die gleichfalls in den Saṃyuttakanikāyo aufgenommen wurde, ed. Siam. vol. V p. 359 (PTS V 374). Die beiden befreundeten Sakkerfürsten Mahānāmo und Godhā begeben sich, als Gotamo auf der Wanderschaft bei Kapilavatthu verweilt, zum Meister hin. Nachdem nun Mahānāmo, aus der 14. Rede der Mittleren Sammlung uns bereits bekannt, sein Gespräch mit Godhā über die begründete Zuversicht zum Meister, zur Lehre, zur Jüngerschaft und viertens ganz allgemein zu den von Verständigen gepriesenen Eigenschaften dargelegt hat, sagt er dann noch: ›Es könnte etwa, o Herr, bei der Lehre irgendein neuer Begriff entstehn: auf der einen Seite wäre der Erhabene, auf der anderen Seite die Schar der Mönche, der Nonnen, der Anhänger und Anhängerinnen, die Welt mit ihren Göttern, ihren bösen und heiligen Geistern, mit ihrer Schar von Priestern und Büßern, Göttern und Menschen. Wo aber da der Erhabene wäre, da wäre auch ich: so klar geworden möge mich, o Herr, der Erhabene betrachten.‹ Nun fragt der Meister: ›Was hast du, Godhā, Mahānāmo dem Sakker darauf zu erwidern?‹ Und Godhā antwortet: ›Darauf hab' ich, o Herr, Mahānāmo dem Sakker nicht das geringste zu erwidern, außer daß es recht und billig ist.‹ Eine solche Zuversicht, weit entfernt vom bloßen Glauben, ist allerdings dieselbe, wie sie auch aus einem Spruche hervorgeht, den zur gleichen Zeit HERAKLIT einmal verlauten hat lassen:
Einer gilt mir für Dreißigtausend, doch die Unzähligen
Garnichts: das aber schwör' ich beim stygischen Reich.
Am besten kann man wohl jene Zuversicht der beiden Sakkerfürsten, und ebenso die Sāriputtos oben, die angesichts des Meisters so klar geworden ist, nach der Chria des MATTHIAS CLAUDIUS erläutern: »Mich dünkt, wer 'was recht's weiß, muß, muß – säh' ich nur 'nmal einen, ich wollt 'n wohl kennen, malen wollt ich 'n auch wohl, mit dem hellen heitern ruhigen Auge, mit dem stillen großen Bewußtsein usw.«, Wandsbecker Bote I 21. Hierzu paßt nun vortrefflich, als ein erkenntniskritischer Kommentar, HUMES Definition des Glaubens, die er mit Recht ›most accurately defined‹ nennt, Treatise of Human Nature, part III section VII: »Α lively idea related to or associated with a present impression.«
Wie unverbindlich übrigens Gotamo alle bloße Glaubenszuversicht und dergleichen gehalten hat, ist seinen Ansprachen und Darlegungen oft und oft zu entnehmen, jederzeit, z.B. in der 22. und 38. Rede der Mittleren Sammlung, insbesondere bei der letzteren, S. 225. So findet sich auch im Saṃyuttakanikāyo ein sehr bezeichnendes Stück, ed. Siam. vol. IV p. 171-174 (PTS 138-140), in der folgenden kurzen Ansprache an die Jünger. »Es gibt«, sagt da Gotamo, »eine Art und Weise, bei welcher der Mönch auch ohne Glauben, ohne Billigung, ohne Hörensagen, ohne Erwägung der Umstände, ohne geduldig in die Sätze Einsicht zu nehmen die Gewißheit bekunden kann: ›Versiegt ist die Geburt, vollendet das Asketentum, gewirkt das Werk‹, und er ›nicht mehr ist diese Welt‹ versteht. Was ist das aber, ihr Mönche, für eine Art und Weise? Hat da, ihr Mönche, ein Mönch mit dem Auge eine Form gesehn, und er empfindet noch Gier, Haß, Irre, so weiß er ›Ich empfinde noch Gier, Haß, Irre‹; empfindet er nicht mehr Gier, Haß, Irre, so weiß er ›Ich empfinde nicht mehr Gier, Haß, Irre.‹[844] Wenn nun, ihr Mönche, ein Mensch also weiß, sind dann wohl etwa, ihr Mönche, diese Dinge durch Glauben zu erklären, oder durch Billigung, oder durch Hörensagen, oder durch Erwägung der Umstände, oder durch geduldiges Einsichtnehmen in die Sätze?« – »Gewiß nicht, o Herr.« – »Sind sie da nicht, ihr Mönche, als durch Weisheit erkannt zu erklären?« – »So ist es, o Herr.« – »Das aber ist, ihr Mönche, eine Art und Weise, bei welcher der Mönch auch ohne Glauben, ohne Billigung, ohne Hörensagen, ohne Erwägung der Umstände, ohne geduldig in die Sätze Einsicht zu nehmen die Gewißheit zu bekunden vermag: ›Versiegt ist die Geburt, vollendet das Asketentum, gewirkt das Werk‹, und er ›nicht mehr ist diese Welt‹ versteht. Weiter sodann, ihr Mönche: hat ein Mönch mit dem Ohr einen Ton gehört, mit der Nase einen Duft gerochen, mit der Zunge einen Saft geschmeckt, mit dem Leibe eine Tastung getastet, mit dem Gedenken ein Ding erkannt, und er empfindet noch Gier, Haß, Irre, so weiß er ›Ich empfinde noch Gier, Haß, Irre‹; empfindet er nicht mehr Gier, Haß, Irre, so weiß er ›Ich empfinde nicht mehr Gier, Haß, Irre.‹ Wenn nun, ihr Mönche, ein Mönch also weiß, sind dann wohl etwa, ihr Mönche, diese Dinge durch Glauben zu erklären, oder durch Billigung, oder durch Hörensagen, oder durch Erwägung der Umstände, oder durch geduldiges Einsichtnehmen in die Sätze?« – »Gewiß nicht, o Herr.« – »Sind sie da nicht, ihr Mönche, als durch Weisheit erkannt zu erklären?« – »So ist es, o Herr.« – »Das aber ist, ihr Mönche, eine Art und Weise, bei welcher der Mönch auch ohne Glauben, ohne Billigung, ohne Hörensagen, ohne Erwägung der Umstände, ohne geduldig in die Sätze Einsicht zu nehmen die Gewißheit zu bekunden vermag: ›Versiegt ist die Geburt, vollendet das Asketentum, gewirkt das Werk‹, und er ›nicht mehr ist diese Welt‹ versteht.« – Man darf den gotamidischen Jünger mit Recht den ungläubigsten Menschen nennen, da ihm nicht anders wie dem Meister selbst das Bekenntnis zukommt: »Das aber sag' ich und hab' es nicht etwa von irgend einem Asketen oder Priester reden hören: sondern was ich eben selbst erkannt, selbst gesehn, selbst gefunden habe, das nur sage ich«: Mittlere Sammlung 295 u. 973. Dem Orden Gotamos ist also nichts ferner als Geheimniskrämerei, Adeptenweihe, Hagiosität, alles was man kurz mit dem übelberüchtigten Worte Mystik bezeichnet. Wie das Leuchten der Sonne offenbar ist und nicht geheim, so ist auch das Leuchten der Lehre und Ordnung, die der Vollendete anzeigt, offenbar und nicht geheim, erklärt Gotamo, Anguttaranikāyo III No. 132 (PTS 129). Prachtvoll bewährt ist hier das Motto unseres herrlichen Feuerhelden GIORDANO BRUNO:
Procedat nudus, quem non ornant nebulae,
Sol.
Gerade im Gegensatz dazu steht das ängstliche Blinzeln und die Verschwommenheit, der trübe, kümmerliche Anblick, worüber sich BERTHOLD VON REGENSBURG so ehrlich ausspricht: Wenn nun die lichte Sonne den heiligen Christenglauben bezeichnet, so sollt ihr doch nicht fest in die Sonne sehn. Es hat niemand so starke Augen, und will er zu lange und zu fest in die Sonne und in das strahlende Rad der Sonne sehn, so wird er überaus krank an seinen Augen, daß er's nimmer überwindet; oder er wird gar blind, daß ihm stockfinster wird. Auf gleiche Weise soll niemand zu fest in den rechten Christenglauben sehn: denn sonst wird er so krank an dem Glauben, daß er's nimmer überwindet, oder er wird aber gar zu einem Ketzer: ed. PFEIFFER I, p. 265. [845] Noch freier im Geiste geworden sagt dasselbe auf andere Weise der vortreffliche Wahrheitsucher MALEBRANCHE in seinem Hauptwerk, 4. Buch, 6. Kapitel, vorletzter Absatz: »Ce n'est pas une preuve suffisante pour croire une chose, que de l'entendre dire par un homme qui parle avec zele et avec gravité. Car enfin ne peut-on jamais dire des faussetez et des sottises de la même maniere qu'on dit de bonnes choses, principalement si l'on s'en est laissé persuader par simplicité et par foiblesse.« So hatte auch dieser große Mann das »ouï-dire« abgelehnt. Bloßen Glaubenslehren und Glaubenssätzen ist eben durchaus die Definition angemessen, die RAYMUNDUS LULLIUS gegeben hat. Ohne Absicht übt sie die schärfste Kritik, rein formal trifft sie gerade darum den Nagel auf den Kopf: Glaube ist ein Zustand, bei dem einer das für wahr hält, was er nicht einsieht und nicht versteht, Fides est habitus cum quo aliquis credit id esse verum quod non sentit nec intelligit: Ars brevis, cap. XXI. Will man aber doch wohl auch diesem Zustand eine günstige Seite abgewinnen, so kann es billigerweise nach der Melodie des alten Hymnus »Pange lingua« geschehn, dessen 4. Strophe das Fehlende gut ergänzt:
Et si sensus deficit,
Ad firmandum cor sincerum
Sola fides sufficit.
Bei allen unseren Gesprächen nun über das bloße Hörensagen und über den Glaubenspunkt ergibt sich so klar wie oben im Text aus der Unterredung Sāriputtos mit dem Meister, daß die Satzung Gotamos eine ganz unpersönliche ist, rein sachlich gefaßt und vorgetragen: ein echtes Anzeichen, eine sichere Gewähr, wenn auch zunächst absonderlich, gerade für die ungeheuere Geisteskraft und Geisteszucht einer Persönlichkeit, die jede eigene, nach Zeit und Ort bestimmte Beschränkung vollständig überwunden hatte. Einer der merkwürdigsten Belege dafür ist auch der Bericht über Sāriputtos Tod, im Saṃyuttakanikāyo, letzter Band, S. 175-177 der siamesischen Ausgabe (PTS 161-163). Ein junger Mönch kommt zu Ānando und bringt ihm die Nachricht, daß der ehrwürdige Sāriputto nach einer schweren Erkrankung gestorben, erloschen ist: und er überreicht ihm zugleich dessen Mantel und Almosenschale. Da sucht nun Ānando den Erhabenen auf, verbeugt sich ehrerbietig und setzt sich beiseite. Dann erzählt er das Ereignis, weist Mantel und Schale vor und fügt hinzu: »Da ist mir denn, o Herr, der Körper wie süßen Mostes trunken geworden, und ich weiß nicht links und nicht rechts und kann an nichts mehr denken, seitdem ich erfahren habe: der ehrwürdige Sāriputto ist erloschen!« Daraufhin fragt nun der Meister: »Hat denn wohl, Ānando, Sāriputto die Stücke der Tugend dir weggenommen und ist damit erloschen? Oder hat er die Stücke der Einigung, hat er die Stücke der Weisheit, die Stücke der Erlösung, die Stücke der Wissensklarheit von der Erlösung dir weggenommen und ist damit erloschen?« – »Das wohl nicht, o Herr: aber der ehrwürdige Sāriputto war mir ein Lehrer; er hat mich aufgeklärt, ermuntert, ermutigt, erregt und erheitert, unermüdlich war er im Darlegen der Satzung, ein Förderer der rechten Asketen: wie kräftig und mächtig der ehrwürdige Sāriputto die Lehre gefördert hat, dessen gedenken wir.« – »Hab' ich denn das, Ānando, nicht vorher schon verkündet, daß alles, was einem lieb und angenehm ist, verschieden werden, aus werden, anders werden muß? Wie doch nur wär' es, Ānando, möglich, daß was geboren, geworden, zusammengesetzt, dem Verfall unterworfen ist, da doch nicht verfallen sollte: das gibt es nicht. Gleichwie etwa, Ānando, wenn bei einem großen kräftig bestehenden Baume sein größter Zweig abstürbe: ebenso nun auch, Ānando, ist bei der großen kräftig bestehenden[846] Jüngerschaft Sāriputto erloschen. Wie doch nur wär' es, Ānando, möglich, daß was geboren, geworden, zusammengesetzt, dem Verfall unterworfen ist, da doch nicht verfallen sollte: das gibt es nicht. Darum aber, Ānando, wahrt euch selber als Leuchte, selber als Zuflucht, ohne andere Zuflucht, die Lehre als Leuchte, die Lehre als Zuflucht, ohne andere Zuflucht.« Und es folgt nun die wohlbekannte Darstellung der vier Pfeiler der Einsicht, die den Mittelpunkt der Lehre Gotamos bilden, den geraden Weg anzeigen, der zur Läuterung der Wesen, zur Überwältigung des Schmerzes und Jammers, zur Zerstörung des Leidens und der Trübsal, zur Gewinnung des Rechten, zur Verwirklichung der Erlöschung führt: die allen Erwachten eigentümliche Lehre, die doch ohne Eigentum und ohne Persönlichkeit immer gilt. Gotamo hat hier nichts weiter getan als diese Lehre auf die einfachste Formel zu bringen. Damit aber hatte er das geleistet, was KANT als Lob seiner Arbeit betrachtete. Denn als einst ein Tadler ihm vorwarf, es sei kein neues Prinzip der Moralität, sondern nur eine neue Formel aufgestellt worden, wahrte er sich dagegen, daß er etwa einen neuen Grundsatz aller Sittlichkeit einführen und diese gleichsam zuerst erfinden habe wollen, als ob vor ihm die Welt darin unwissend oder in durchgängigem Irrtum gewesen wäre. »Wer aber weiß«, schließt er dann ab, »was dem Mathematiker eine Formel bedeutet, die das, was zu thun sei um eine Aufgabe zu befolgen, ganz genau bestimmt und nicht verfehlen läßt, wird eine Formel, welche dieses in Ansehung aller Pflicht überhaupt thut, nicht für etwas Unbedeutendes und Entbehrliches halten.« Vorrede zur Kritik der praktischen Vernunft, dritte Anmerkung. Wiederum ebenso hatte aber auch Gotamo den gegen ihn erhobenen Vorwurf abgewiesen, Mittlere Sammlung, Anfang der 12. Rede: »›Tadeln will ich‹, meint, Sāriputto, jener Sunakkhatto, der eitle Mann, und lobt gerade damit den Vollendeten. Ein Lob ja ist es, Sāriputto, des Vollendeten, wenn einer sagt: ›Und der Zweck, warum er seine Lehre darlegt, ist einfach der, daß sie dem Grübler zur gänzlichen Leidensversiegung ausreicht.‹« Das nämlich hatte jener Gegner Gotamos tadeln zu müssen geglaubt. – Die krampflose Abweisung der Trauer Ānandos beim Tode Sāriputtos mag Empfindsame befremden: aber nicht anders spricht Philoctet beim Tode des Helden, in SENECAS Hercules Œtaeus v. 1836f.:
Aeterna virtus Herculem fleri vetat:
Fortes vetant maerere, degeneres iubent.
Das Gegenstück ist auch dramatisch gleich aufgebaut, vollkommen gleich erschaut. Wie dort Ānando zutiefst erschüttert Mantel und Schale des erloschenen Sāriputto vorweist, kommt da Alcmena mit der Aschenurne ihres Sohnes im Arme unermeßlich wehklagend heran: beiden wird in ihrem edlen Jammer der überweltliche Trost der Starken zuteil. Der Eindruck, den der Bericht von Sāriputtos Tod und der Bescheid des Meisters bei den Jüngern hinterlassen hat, war so nachhaltend, daß er noch Jahrhunderte lang lebendig geblieben ist: er findet nämlich die beste Bestätigung in dem Umstand, daß das betreffende Stück aus dem Saṃyuttakanikāyo in das Mahāyānam übergegangen und dann über Nepāl, Tibet und China bis ins Mongolische gelangt ist, wo es im Ueligerün Dalai, mit wörtlich getreuer Wiedergabe der Hauptstellen, vorgetragen wird; übersetzt von 1. J. SCHMIDT in dessen Abhandlung »Über die sogenannte dritte Welt der Buddhaisten«, Denkschriften der kaiserl. Akademie von St. Petersburg 1832, 6. Abth., 2. Bd. der histor.-philol. Klasse, S. 20f.
842 Dunkel und licht, oder schwarz und weiß, kaṇhasukkam, was wir gewöhnlich gut und böse heißen. Vergl. die 18. Rede S. 329 nebst Anm. 587, Mittlere Sammlung [847] S. 351. Wie die Überwindung der beiden Gegensätze zu verstehn sei, ist anschaulich durch das Gleichnis vom Floße gezeigt, in der 22. Rede der Mittleren Sammlung, 158f.: die Lehre des Meisters gilt dem Jünger als Floß, das er sich selber aus ihr zusammenfügen muß, um sodann, mit Händen und Füßen arbeitend, vom diesseitigen Ufer voller Gefahren und Schrecken an das jenseitige Ufer heil hinüberzugelangen. Ist er aber dort, im sicheren Hafen, angelangt, so läßt er nun das Floß hinter sich liegen und kümmert sich nicht mehr darum. So behandelt er das Floß nach Gebühr. »Ebenso nun auch, ihr Mönche«, schließt dann Gotamo ab, »habe ich die Lehre als Floß dargestellt, zum Entrinnen tauglich, nicht zum Festhalten.
Die ihr das Gleichnis vom Floße, ihr Mönche, verstehet,
Ihr habt auch das Rechte zu lassen, geschweige das Unrecht.«
Meisterworte wie diese sind später im Mahāyānam zur ausschließlichen Geltung erhoben worden. In den echten Reden Gotamos nur spärlich zu finden, nur selten gegeben, als der Erkenntnis letzte Vollendung – der reinste, klassische Ausdruck hierfür ist die »Vierzigmächtige Rede«, Mittlere Sammlung No. 117 – hat man nordwärts des Ganges dann überhaupt von nichts anderem mehr wissen und raten wollen. Man hat die einzelnen, kurzen Andeutungen und Schlagworte, insbesondere auch die aus den beiden letzten Büchern der Bruchstücke der Reden, in tausendmal tausendfacher Wiederholung immer und immer wieder nur cittavi uddhinayena oder nach dem Schema der reinen Vernunft kritisiert, bloß zur Ergetzung an äußerster Spitzfindigkeit: und man hat auf diese Weise den steilen einsamen Fußpfad, der allein erst zum Ufer führt, auf der sehr bequem gewählten Heerstraße eines müßigen Geredes nach und nach völlig aus dem Auge und Herzen verloren. Wie die Nachkantianer sich zu KANT verhalten, so verhalten sich zu Gotamo die Nachgotamiden und beschäftigen sich in ihren endlosen Prajñāpāramitās oder »Erkenntnisvollkommenheiten« mit nichts anderem als der in der Tat grenzenlosen Verflüchtigung jener einst von den wirklichen Jüngern schlicht überlieferten Meisterworte. Solche Verflüchtigung ist freilich dem Mahāyānam über alle Maßen gelungen, bis herab zur Vajracchedikā, der »Diamantenzersplitterin«, die am Ende des 6. Abschnitts den oben gegebenen Denkspruch Gotamos aus der 22. Rede der Mittleren Sammlung im Hort ihrer eigenen Weisheit noch wörtlich aufbringt, ohne aber irgend den Sinn davon und das Gleichnis dazu gemerkt zu haben. Die ganze Strophe ist ferner auch in der tibetischen Übersetzung der Vajracchedikā noch wohlerhalten, nach 1. J. SCHMIDTS Ausgabe in den Denkschriften der kaiserl. Akademie von St. Petersburg 1837, 6. Abth., 4. Bd. der philologischen Serie, S. 190. Die echten Worte waren also getreu übernommen und weiterüberliefert worden, doch wußten die Mahāyānisten damit nicht aus und nicht ein und konnten sie nur gründlich mißverstehn, bis sie schließlich bloß als berühmtes Zitat von Kommentar zu Kommentar wanderten, so z.B. in der Abhidharmako avyākhyā zu finden, von MAX MÜLLER angeführt, Buddhist Mahâyâna Texts Part II p. 118, Sacred Books of the East vol. XLIX, Oxford 1894. Vergl. noch Anm. 965, 2. Teil. Schlagworte der Art, mögen sie noch so echt sein, aber ohne Zusammenhang, beliebig umgedeutet, sind da gelegentlich nicht anders behandelt worden wie es etwa der katholischen Kirche beliebt hat das klassische, allein gültige Anathēma, das durchaus eindeutig ist, je nach Zweck und Absicht als αναϑημα = Anathéma für Deo dicatum, oder als αναϑεμα = Anáthema für excommunicatio Ecclesiae ganz willkürlich anzuwenden.
Die Ansicht vom Jenseit von schwarz und weiß ist ein Erbstück aus der Zeit der vedischen Vorgänger Gotamos. Als Hauptstelle kommt hier in Betracht das Ende der [848] ersten Unterredung in der sehr alten Kauṣītakyupaniṣat, wo der ātmā oder das Selbst des Menschen als jenseit von gut und böse erkannt wird, durch kein gutes Werk mehrgeworden und auch nicht durch ein ungutes minder, na sādhunā karmaṇā bhūyān no evāsādhunā kanīyān. Weitere Stellen in den Bruchstücken der Reden Anm. 636. ATTAR, in indischer Lehre und Lenkung zur Freiheit gediehn, hat eben diese Stelle der Upanischad, die er sicher gehört hatte, in den Spruch gebracht:
Bist du nur erst in dich selbst gegangen ein,
Weißt von Dasein nichts mehr, nichts von gut und böse sein.
Text und Übersetzung in THOLUCKS »Ssufismus«, Berlin 1821, cap. VI: De libero arbitrio deque discrimine tollendo inter bonum et malum, p. 256/7. Leichter verständlich, mehr volkstümlich gefaßt, ist der Gedanke im Yogasārasaṃgrahas IV v. 1:
Yacca kiṃcit sukhaṃ tacca
duḥkhaṃ sarvam iti smaran,
das ist merkwürdig gleich dem Spruche WALTHERS:
Herzeliebes swaz ich des noch ie gesach,
Dâ was herzeleide bî,
während HARTMANN den Gedanken weiter ausführt und sagt,
Daz sô grôz herzenleit
Von herzeliebe geschiht,
Dâ man sich guotes von versiht.
Vollständig aber gefaßt ist der Faden mit dem immer wechselnden weiß und schwarz oder gut und böse, und dann ohneweiters schlicht volksmäßig abgeknüpft, in der altirischen Ballade Syr Caulìne (PERCYS Reliques I No. 4, 2 v. 1), wo der Barde zur Harfe singt:
Everye white will have its blacke,
And everye sweete its sowre:
This founde the Ladye Christabelle
In an untimely howre.
Kaiser LOTHAR II hatte den Wahlspruch »Ubi mel, ibi fel«. Unseren Texten am nächsten hat Meister ECKHART erklärt: Alles Leid kommt von Liebe und Minne: denn Minne und Liebe ist Leides Anfang und Ausgang, ed. PFEIFFER p. 424. Ein ganz anderer hat in neuerer Zeit, und zwar von der damals eben erst erschlossenen indo-persischen Weisheit wiederum angeregt, den Stoff geistreich behandelt: es ist VOLTAIRE in seiner Kandahārer [Gandhārer] Novelle »Le Blanc et le Noir«; der Grundlage, auf der einige siebzig Jahre später GRILLPARZER ein allegorisches Drama für die schaulustige Menge errichtet hat. Wie jedoch solche Erkenntnis wahrhaft lebendig wird, im zulänglichen Ereignis sich verwirklicht, heiße Qual erzeugt, in furchtbaren Kampf und Sieg sich umsetzt, das ist kaum aus den kühlen Erwägungen, besser aus jenen Erinnerungen zu ersehn, deren gar manche uns in den Liedern der Mönche noch erhalten ist, wie z.B. in v. 459-465, oder in dem kurzen autobiographischen Rückblick des Jüngers Candano, v. 299-302:
Mit Gold umgürtet, reich umreift,
Inmitten ihrer Mägde Schar,
[849] Zu Hüften haltend unser Kind,
So kam zu mir die Gattin mein.
Und als die Mutter näher kam
Mit meinem Kinde, kannt' ich sie,
In seidnen Schleiern, goldnem Schmuck,
Wie schlau der Tod die Schlinge legt:
Und gründlich ward ich aufgemischt,
Ergriffen innig im Gemüt,
Das Elend sah ich offenbar,
Den Unrat ragen rings umher.
Und alle Fesseln fielen ab –
O sieh wie stark die Lehre wirkt –
Das Wissen ging mir dreifach auf,
Das Meisterwort, es war erfüllt.
843 Yathā yathā bhante bhagavā dhammaṃ desesi mit S.
844 Besser, feiner überliefert mit S uttari abhiññeyyaṃ natthi, stets.
845 Der richtige Text ist mit S und M sotañ ca saddā cādi wie stets, z.B. auch Saṃyuttakanikāyo vol. IV p. 15 passim. Vergl. Bruchstücke der Reden Anm. 992, 2. Absatz.
846 mātukucchimhā S; hi kho, bezw. pi kho nachher zu tilgen, wie M zeigt. S beginnt mit idha pana bhante ekacco asampajāno mātukucchim okkamati.
847 Vergl. die 11. Rede S. 150, das Gespräch mit Kevaṭṭo. Die ādesanavidhā oder das cetopariyāyañāṇam ist eine Herzens- und Gedankenkunde, die der heilige Jünger erworben hat: ihm ist Sinn und Gemüt eines jeden Menschen durchsichtig geworden. Es ist dasselbe wie die cordium scrutatio, die sich auch bei unseren westlichen Heiligen oft und oft gezeigt hat: eben darum wurden solche Männer »Herzkündiger« genannt. Nachweise aus jüngeren Zeiten sind in den Bruchstücken der Reden, Anm. zu v. 474 gegeben. Aber schon vom großen ANTONIOS, dem Vater der abendländischen Eremiten, hat der Augen- und Ohrenzeuge ATHANASIOS berichtet, daß er die Gabe hatte, den Geist jedes Menschen zu unterscheiden, daß er die Regungen, Absichten, Gedanken eines jeden sogleich erkannte, Vita S. αντονII, ed. 1611 p. 113; also ganz ähnlich wie es oben bei uns im Text lautet: »Daran denkst du, dies bedenkst du, das ist dein Gedanke« usw. Da wie dort hat der Mensch, in unermüdlicher Arbeit, eine gesteigerte Hellsichtigkeit entwickeln gelernt.
848 Der tiefere Gehalt dieser Betrachtung wird von Sāriputto in der 28. Rede der Mittleren Sammlung, S. 208-211, erörtert, wobei sich ergibt, daß ein ›Ich‹ oder ›Mein‹ oder ›Bin‹ dem Körper nicht zugesprochen werden kann, vielmehr ›Nichts ist sein‹ in Wirklichkeit gilt. So nüchtern hat auch die ruti schon unser körperliches Hienieden angeschaut, nach dem im Ṣaḍviṃ abrāhmaṇam I 3, 2 erhaltenen alten Merkwort Trayo'rvāñco: retasaḥ mūtrapurīṣaḥ, Drei niederwärts: Same, Harn, Kot. Weitere Belege aus den Upanischaden, die unserem Texte sehr nahekommen, in der Anm. 692. Eine ähnliche Ansicht oder Erfüllung der Gesichte, wie Sāriputto sagt, hat ANTONIUS von Padua gezeigt, nach seiner gewohnten drastischen Weise vorgetragen, in der Rede Dominica XI post Trinitatem: Corpus a corruendo dictum est, vel quasi cordis pus, id est putredo, vel quod corruptum pereat, vel quod, coram positum. Pauper corpus meum, quod nudum, caecum, plorans ingreditur in hoc exilium et nudum et caecum, et miserum egreditur ab hoc exilio, et utinam non ad aeternum exitium, necessitati [850] famis et frigoris subjectum, infirmitatibus afflictum, spurcitiis et immuniditis plenum: unde ergo pauper, infelix, tibi superbia? Unde tibi gloria? Si vis superbire, superbias de cloaca stercoris, quam tecum defers: ed. DE LA HAYE (1739) fol. 261 b. Man spürt den gleichen Gehalt, allerdings in christlich kotzengrober Hülle dargeboten, dabei aber gut indisch kommentiert. Um dieselbe Zeit spricht in der wahrscheinlich ältesten Danza de la Muerte der Tod zu den Abgelebten, RIVADENEYRA LVII 379:
E por los palaçios daré por medida
Sepulcros escuros de dentro fedientes,
E por los manjares gusanos royentes
Que coman de dentro su carne podrida.
Elegant ist es von CALDERON, La vida es sueño III 6 Ende, zur Gemme geschliffen, den Totentanz spiegelnd:
Cada edificio es un sepulcro altivo,
Cada soldado un esqueleto vivo.
Ein jedes Bauwerk ragt als Gruft empor der Sippe,
Ein jeder Krieger als lebendiges Gerippe. –
Im folgenden Gesicht hat der Jünger sodann eine weitere Vertiefung seiner Gedanken erreicht, er ist durch die Betrachtung von Haut, Fleisch und Blut bis auf die Knochen gedrungen, an das Grundgerüst von des Menschen äußerem Bestande: eine leibliche Untersuchung, die schließlich in die, oben im Text als bekannt vorausgesetzte, klassische Leichenbetrachtung übergeht, 22. Rede S. 385. Mittlere Sammlung 99, 892: »als hätte der Mönch einen Leib auf der Leichenstätte liegen sehn«, zieht er den Schluß auf sich selbst usw. Hierbei ist nun die Modalität des Ausdrucks in hohem Grade bemerkenswert: es ist der Konjunktiv gebraucht, »als hätte er gesehn.« Daraus ergibt sich, daß es sich um eine rein geistige Betrachtung, um eine Gedankenübung handelt, und nicht etwa um eine zur Regel erstarrte Injunktion, der Mönch solle sich Leiber und Knochen ansehn. Daß er dergleichen schon gesehn hat, wird als selbstverständlich angenommen. Es gilt aber nun diese allen gemeinsame Erfahrung als Ausgangspunkt, als Stütze anzuwenden, bei der immer weiterdringenden Denkarbeit: daher also nur: »als hätte er gesehn.« Sozusagen wie ein Gruß an Karner und Gruft, im Geiste besucht. Der Mönch sieht es vor sich, so etwa wie der Padre Fray PEDRO GRACIAN, am Ende der 32. Discurso der Agudeza, die gekrönte Grabespracht von Granada anspricht als gran nada, als ein großes nichts, das sinnigste Homoioteleuton komponiert:
Y aunque coronada tumba,
os sea Granada, yo
digo, que es todo gran nada
Rey, Monarca, Emperador.
Der Spanier steht da wie der zuhöchst gekommene Inder über dem Graus des gran nada, daher ja auch GOYA den Toten sich vorstellen läßt mit der Visitkarte nada; wo hingegen der Besuch SCHUBARTS in der Fürstengruft dabei noch schaudernd verweilt und die Betrachtung recht mit Abscheu durchsättigt: »Da liegen sie, die stolzen Fürstentrümmer, ehmals die Götzen ihrer Welt! Da liegen sie, vom fürchterlichen Schimmer des blassen Tags erhellt ... da liegen Schädel mit verloschnen Blicken, die ehmals hoch herabgedroht ... die liegen nun in dieser Schauergrotte, mit Staub und Würmern zugedeckt« [851] usw.: alles aber, wie bei uns oben, in sich selber geschaut, ohne dazu erst einer äußeren Anregung und Erschütterung zu bedürfen. – Wie fern man heutzutage, beiläufig bemerkt, vom Verständnisse solcher feineren Erfahrung, die unsere Texte geben, abgekommen ist, zeigt sich possierlich an dem Mönch auf Zeilon, der in einer Felshöhle, vor einem Häuflein Totengebein und Schädeln in Betrachtung versunken, sich photographieren läßt: ein Bild, das von der Universitätsprofessorin RHYS DAVIDS ihren Psalms of the Early Buddhists, Part II, London 1913, zu S. 124 beigeheftet wurde und das die gelehrte Doktrinärin für ein Belegstück zu den gar nicht burlesken Theragāthā 151-152 hält; aber da ist von etwas anderem die Rede, wenn schon der Kommentator den einen, allerdings auch angedeuteten Sinn und Nebensinn mit dem Hauptinhalt in lauter plumpe Knochen verschüttet hat. Die Gedanken des Jüngers bei der Leichenbetrachtung kann man vielleicht am besten im Anblick des toten Faust entwickeln, sich nahe bringen, völlig verständlich machen, mit dem so ungemein schlichten Ergebnis:
Der mir so kräftig widerstand,
Die Zeit wird Herr, der Greis hier liegt im Sand.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Da ist's vorbei! Was ist daran zu lesen?
Es ist so gut, als wär' es nicht gewesen,
Und treibt sich doch im Kreis, als wenn es wäre.
Ich liebte mir dafür das Ewig-Leere.
Die geistig gepflegte Leichenbetrachtung ist nun aber zugleich, als eine gründliche Erkenntnis des Unschönen, asubham, im Orden Gotamos eines der auszeichnenden Merkmale, das immer eifriger Beachtung empfohlen wird. Als sich der Meister einmal wieder, wie er das von Zeit zu Zeit zu tun liebte, auf ein paar Wochen in gänzliche Einsamkeit zurückzieht, hält er vorher noch eine Ansprache an die Jünger, zeigt ihnen auf mannigfache Weise eben jene Unschönheit an, empfiehlt die Übung in solcher Gedankenzucht. – Wie nun der Herr nach einigen Wochen aus der Einsamkeit wiederkehrt, findet er nur mehr wenige Mönche vor und fragt Ānando, wie es komme, daß die Schar der Jünger so spärlich geworden. Ānando gibt alsbald die Aufklärung und berichtet, daß die Jünger sich die Worte des Meisters über die Unschönheit zu Herzen genommen und gar eifrig solche Gedankenzucht gepflegt hatten. Da wurden sie denn über diesen Körper entsetzt, es kam sie Grauen und Abscheu an; und ihrer viele sind freiwillig aus dem Leben geschieden, haben zur Waffe gegriffen, sich umgebracht; erst zehn Mönche täglich, dann zwanzig, dreißig Mönche sind an einem Tage abgeschieden. Da möge jetzt der Erhabene so gut sein und auf andere Weise die Satzung darlegen, damit diese Jüngerschaft wissend geworden ausharre. Auf diesen Bescheid hin läßt Gotamo die übriggebliebenen Jünger durch Ānando zu sich berufen. Nachdem sie versammelt sind, spricht nun der Meister nicht etwa irgendeine Mißbilligung über das Geschehene aus, sondern sagt nur: auch die Pflege und Ausbildung der bedachtsam geübten Ein-und Ausatmung wirkt einigend, beruhigend, ist da ein edler, erquickender, glücklicher Zustand, wo man schlechte, unheilsame Dinge, die einen je und je ankommen, sehr wohl schwinden lassen, auflösen kann. Saṃyuttakanikāyo, ed. Siam. vol. V p. 312-314 (PTS 320-322). Weiteres noch in der Anm. 719.
849 Die Ausführung findet sich in der Mittleren Sammlung 511-513. Vergl. auch Anm. 1018. Den Körperzeugen, kāyasakkhī, erklärt Ānando, nach dem Worte des Meisters, dahin, daß es ein Mönch ist, der die acht Wohlzustände, phāsuvihārā, erworben [852] hat: die vier Schauungen und die vier unbegrenzten Bereiche der Raumsphäre usw.; je mehr und mehr er nun da Bereich um Bereich versteht, desto mehr und mehr hat er es leibhaftig erfahren und gefunden. »Insofern aber, ihr Brüder, hat der Erhabene von einem Körperzeugen gesprochen, je nach dem Standpunkt. Weiter sodann, ihr Brüder, hat der Mönch nach völliger Überwindung der Grenzscheide möglicher Wahrnehmung die Auflösung der Wahrnehmbarkeit erreicht, und des weise Sehenden Wahn versiegt; je mehr und mehr er nun den Bereich da versteht, desto mehr und mehr hat er es leibhaftig erfahren und gefunden. Insofern aber, ihr Brüder, hat der Erhabene von einem Körperzeugen gesprochen, nach keinerlei Standpunkt.« Anguttaranikāyo, Navakanipāto No. 43, ed. Siam. p. 113f.
850 Hierzu die 46. Rede der Mittleren Sammlung.
851 Mit S na ca vebhūtiyaṃ pesuṇiyaṃ, na ca sārambhajaṃ jayāpekkho: mantā mantā ca vācaṃ bhāsati etc. Zu vebhūti cf. Bruchstücke der Reden v. 158, 664.
852 anāgataṃ p'aham addhānaṃ jānāmi mit S und M.
853 Mit S zu lesen: Atītaṃ cāham addhānaṃ jānāmi, saṃvaṭṭi pi loko vivaṭṭi pi (ti); anāgataṃ cāham addhānaṃ jānāmi, saṃvaṭṭissati pi loko vivaṭṭissati pi (ti). Die Ansicht, daß das Selbst und die Welt ewig bestehe, also die Lehre von der Ewigkeit der Weltseele usw., ist bekanntlich der unerschöpfliche Stoff der Upanischaden. Ein System daraus scheint Pakudho Kaccāyano gemacht zu haben, einer der berühmten Weltweisen zur Zeit Gotamos, S. 41f., wobei denn die Gedanken der alten vedischen Seher schon vergröbert wurden. Auf solcher Grundlage ist von Kapilas und seinen Nachfolgern das Sāṃkhyam ausgearbeitet worden, COLEBROOKE, Miscellaneous Essays, London 1837, 1 229-260. Auch die Jainās sind in diesem kindlichen Dualismus, einem Erbstück der philosophischen Spielplätze und ihrer Ringkämpfe, befangen geblieben, haben es ganz zur gleichen derben diametralen Differenz wie DES CARTES gebracht, nach welcher der Geist der Materie gegenübersteht, beide ewig sind, als Seele und Welt. Allerdings ist die Welt bei ihnen unerschaffen, ohne Lenker, besteht aus eigener Kraft, selbstherrlich je und je nach Schuld und Verdienst geregelt, in ewigem Wandel; die Seele aber ist reines Erkennen, der Erlöste gelangt an das Weltende, loganto, über die Welt hinaus an die Stätte des höchsten Himmels, und er dauert dort in der ursprünglich lauteren Geistigkeit ewig fort, Aupapātikasūtram, ed. LEUMANN, Leipzig 1883, § 167, BÜHLER, »Über die indische Secte der Jaina«, Wien 1887, S. 8-10, mit den Quellen 37 Anm. 8. Bei Gotamo gilt so etwas natürlich nur als müßige Ansicht, als mit eine von den Lehren, die nur in Geschwätz auslaufen können. Denn trotz aller Schönrednerei handelt es sich auch dort schließlich doch immer bloß wieder um die fünf Stücke des Anhangens, woran der Mensch nicht genug haben kann, mag er seine Gedanken auch noch so erhaben einkleiden und verkleiden, mag er sie auch so tief zu deuten verstehn wie Yājñavalkyas oder PARMENIDES. Über jene fünf Stücke kommt er nie hinaus. In ihnen ist daher auch die Ansicht von der Weltseele beschlossen und mit ihnen erledigt. »Wenn was ist«, fragt Gotamo, Saṃyuttakanikāyo ed. Siam. vol. III p. 180 (PTS 202), »woran gehangen, worin bestanden, kommt eine solche Ansicht auf: ›Keine Winde wehen, keine Flüsse strömen, keine Schwangeren gebären, kein Mond und keine Sonne gehn auf und gehn unter, an grundfest gegründeter Stätte‹?« Und die Antwort gibt der Meister selbst: »Wenn Form ist, an Form gehangen, in Form bestanden, in Gefühl, in Wahrnehmung, in Unterscheidungen, in Bewußtsein bestanden, kommt diese Ansicht auf: ›Keine Winde wehen, keine Flüsse strömen, keine Schwangern gebären, kein Mond und keine Sonne gehn auf und gehn unter, an grundfest gegründeter Stätte‹.« Da nun alles was gesehn, gehört, gedacht, erkannt, [853] erreicht, erforscht, im Geiste untersucht wird, vergänglich, leidig, wandelbar ist, zweifelt der erfahrene Jünger nicht mehr an dem leeren Gerede auch über die Weltseele oder die grundfest gegründete Stätte, wo keine Schwangeren gebären usw.; oder wie JESUS gesagt hat: wo es kein freien und gefreit werden mehr geben soll. Denn wäre der Jünger, bis dahin vorgedrungen, schon damit zufrieden, so hätte er zwar viel erreicht, aber doch noch die zarte Sphäre der Mignon gestreift, wo es heißt:
Und jene himmlischen Gestalten,
Sie fragen nicht nach Mann und Weib.
Gotamos glatte Ablehnung des Vernünftelns über was immer für ein Ding an sich, das Ansichseiende oder Ansichnichtseiende usw., zeigt unzweifelhaft an, daß die von mancher Seite gern vorgebrachten transszendenten oder übergreiflichen Stellen aus dem letzten Abschnitt des Udānam, deren Bedenklichkeit auch DAHLKE gemerkt hat, Buddhismus als Religion und Moral, Leipzig 1914, S. 171-173, nur spätere Zutat sein können, lokativ als ādhāro 'dhikaraṇam. Wir dürfen sie abweisen in der Art der āpatti oder Schlußfolgerung der Vai eṣikās, deren Logik den Satz aufstellt: pīno Devadatto divā na bhunkte, »der feiste Theodor speist nicht zu Mittag«, folglich muß er zu Nacht speisen; d.h. also, auf die übersinnlich vernünftelnden Theosophen angewandt: ihren Schwulst haben sie sich heimlich angepflegt.
854 Vergl. Anm. 714. – Mit S zu lesen: Santi bhante sattā yesaṃ ca na sakkā etc. Bei dem gesteigerten ānuttariyam ist hier, wie sonst zuweilen, veyyākaraṇam die arthāpatti oder das latente Subjekt, gegenüber der gebräuchlichen arthavyakti oder vollständigen Ausdrucksweise. Vergl. Anguttaranikāyo VI No. 30.
855 Mit S sa-upadhikā etc. – Vergl. Mittlere Sammlung 877-880, später, am Ende des Abschnitts oben, ib. 1078. Zum ganzen: Lieder der Mönche Anm. 375; auch unsere Anm. 1059, Teil 2, Sāriputtos Grundlegung zur magischen Machtentfaltung, der iddhi. – Eine andere Reihe von unübertrefflichen Dingen stellt Gotamo selbst auf, Anguttaranikāyo VI, Ende des Anuttariavaggo: unübertreffliches Anschauen, unübertreffliches Anhören, unübertrefflichen Gewinn, unübertreffliche Übung, unübertrefflichen Dienst, unübertreffliche Andacht. Da geht einer hin um herrliche Elefanten, herrliche Rosse, herrliche Kostbarkeiten anzuschauen oder allerhand anderes, auch wohl einen berühmten Mann, der seicht und verschroben ist: »so ein Anschauen, ihr Mönche, gibt es, ich sage nicht, daß es so etwas nicht gibt. Aber ein solches Anschauen, ihr Mönche, ist gewöhnlich, gemein, alltäglich, unheilig, unheilsam, es führt nicht zur Abkehr, nicht zur Wendung, nicht zur Auflösung, nicht zur Aufhebung, nicht zur Durchschauung, nicht zur Erwachung, nicht zur Erlöschung. Wenn man aber, ihr Mönche, den Vollendeten oder einen Jünger des Vollendeten anschauen geht, mit begründeter Zuversicht, begründeter Liebe, sicheren Schrittes, heiter geworden: so ist das, ihr Mönche, ein Anschauen, das nicht übertroffen werden kann, das zur Läuterung der Wesen, zur Überwältigung des Schmerzes und Jammers, zur Zerstörung des Leidens und der Trübsal, zur Gewinnung des Rechten, zur Verwirklichung der Erlöschung führt; das ist es, wenn einer den Vollendeten oder einen Jünger des Vollendeten anschauen geht, mit begründeter Zuversicht, begründeter Liebe, sicheren Schrittes, heiter geworden. Das heißt unübertreffliches Anschauen.« Weiter wird dann vom Anhören gesprochen, man geht Musik hören oder allerhand anderes usw.: »so ein Anhören, ihr Mönche, gibt es, ich sage nicht, daß es so etwas nicht gibt. Aber ein solches Anhören, ihr Mönche, ist gewöhnlich« usw. Und ferner: es gewinnt einer Weib und Kind, Reichtum, vielerlei Hab und Gut. Es betreibt einer die Kunst, Elefanten [854] zu bändigen, Rosse zu bändigen, Wagen zu lenken, es wird einer Bogenschütze, Fechter, oder er übt irgendeine andere Kunst aus. Es dient einer einem Fürsten, einem Priester, einem Bürger oder irgendeinem anderen. Es gedenkt einer eine Familie zu gründen, Schätze zu erwerben, allerlei Vorteile zu erringen, er gedenkt auch wohl eines Asketen oder Priesters, der falsch lehrt und falsch lebt: »so eine Andacht, ihr Mönche, gibt es, ich sage nicht, daß es so etwas nicht gibt. Aber eine solche Andacht, ihr Mönche, ist gewöhnlich, gemein, alltäglich, unheilig, unheilsam, sie führt nicht zur Abkehr, nicht zur Wendung, nicht zur Auflösung, nicht zur Aufhebung, nicht zur Durchschauung, nicht zur Erwachung, nicht zur Erlöschung. Wenn man aber, ihr Mönche, zum Vollendeten oder einem Jünger des Vollendeten Andacht hegt, mit begründeter Zuversicht, begründeter Liebe, sicheren Schrittes, heiter geworden: so ist das, ihr Mönche, eine Andacht, die nicht übertroffen werden kann, die zur Läuterung des Wesens, zur Überwältigung des Schmerzes und Jammers, zur Zerstörung des Leidens und der Trübsal, zur Gewinnung des Rechten, zur Verwirklichung der Erlöschung führt; das ist es, wenn einer zum Vollendeten oder einem Jünger des Vollendeten Andacht hegt, mit begründeter Zuversicht, begründeter Liebe, sicheren Schrittes, heiter geworden. Das heißt man, ihr Mönche, unübertreffliche Andacht. Das sind, ihr Mönche, sechs Arten von Unübertrefflichkeit.« Im X. Bande des Anguttaranikāyo ist unter No. 22 noch folgender Ausspruch erhalten: »Was für Dinge, Ānando, Stufe um Stufe den Weg zur Freiheit erkennen und verwirklichen helfen: freimütig, Ānando, bekenne ich da zu diesen und diesen weiter und weiter die Satzung aufzuweisen, so daß der weiter und weiter Vorschreitende was ist als ›es ist‹ verstehn kann, was nicht ist als ›es ist nicht‹ verstehn kann, das Gewöhnliche als gewöhnlich, das Erlesene als erlesen, das Übertreffliche als übertrefflich, das Unübertreffliche als unübertrefflich verstehn kann. Und was da nun weiter und weiter verstehbar oder erschaubar oder erwirkbar sein mag, immer weiter und weiter verstehn oder erschauen oder erwirken zu können: das ist wohl möglich. Das ist ein Verständnis, Ānando, das von keinem anderen übertroffen wird, und zwar das dabei und dabei wirklich Verstehnlernen. Noch ein anderes Verständnis aber, Ānando, das darüber hinausreichte oder erlesener wäre, das, sag' ich, gibt es nicht.«
856 catunnañ ca bhagavā jhānānam ābhicetasikānaṃ mit S. Vergl. Mittlere Sammlung, 6., 70., 139. Rede: S. 36, 514f., 1017. – Hernach ist zu lesen: Sace maṃ bhante evaṃ puccheyyuṃ, cf. Majjhimanikāyo vol. I p. 320, passim. Die Beantwortung von Fragen durch einfaches Ja oder Nein ist zu Beginn einer Unterredung allgemein die Regel gewesen: vergl. z.B.S. 136-138, Mittlere Sammlung 777 und oft. Es ist dies nicht etwa als ein Mangel an Höflichkeit aufzufassen, vielmehr ist der indische Fragesteller gewohnt seine Fragen derart überdacht zu haben und einzurichten, daß sie zunächst die denkbar kürzeste Beantwortung gestatten; eine Sitte, die also schon damals unserer praktisch wohlgeschulten Prozeßordnung verbatim entsprochen hat, nach welcher bekanntlich vorgeschrieben ist: »Die Fragen sind so zu stellen, daß sie mit Ja oder Nein sich beantworten lassen.« Zweck ist da wie dort Klarheit und rasche Erledigung.
857 In der Mittleren Sammlung 115. Rede ausgesprochen S. 873. Mit den vorangehenden Worten Sāriputtos ist die typische Symploke unserer Texte, die von Gotamo oft angewandte kunstreich verflochtene Figur des sāmavāyikavādo zu vergleichen, Anguttaranikāyo, Tikanipāto No. 137 (PTS 134), ed. Siam. p. 373f.: »Ob da, ihr Mönche, Vollendete auftreten, ob da Vollendete nicht auftreten: ständig ist doch diese Art, durch die Dinge beständigt, durch die Dinge bestimmt: alle Unterscheidung ist vergänglich; das ist es, was der Vollendete begreift und durchdringt, begriffen und [855] durchdrungen hat, und es dann anzeigt, aufweist, darlegt, darstellt, enthüllt, entwickelt, offenbar macht: alle Unterscheidung ist vergänglich. Ob da, ihr Mönche, Vollendete auftreten, ob da Vollendete nicht auftreten: ständig ist doch diese Art, durch die Dinge beständigt, durch die Dinge bestimmt: alle Unterscheidung ist leidig; das ist es, was der Vollendete begreift und durchdringt, begriffen und durchdrungen hat, und es dann anzeigt, aufweist, darlegt, darstellt, enthüllt, entwickelt, offenbar macht: alle Unterscheidung ist leidig. Ob da, ihr Mönche, Vollendete auftreten, ob da Vollendete nicht auftreten: ständig ist doch diese Art, durch die Dinge beständigt, durch die Dinge bestimmt: alle Unterscheidung ist nichtig; das ist es, was der Vollendete begreift und durchdringt, begriffen und durchdrungen hat, und es dann anzeigt, aufweist, darlegt, darstellt, enthüllt, entwickelt, offenbar macht: alle Unterscheidung ist nichtig.« Und im Saṃyuttakanikāyo ed. Siam. vol. II p. 4 (PTS 25): »Durch Geburt, ihr Mönche, ist Alter und Tod bedingt. Ob da, ihr Mönche, Vollendete auftreten, ob da Vollendete nicht auftreten: ständig ist doch diese Art, durch die Dinge beständigt, durch die Dinge be stimmt: im Verhältnis bestehn; das ist es, was der Vollendete begreift und durchdringt, begriffen und durchdrungen hat, und es dann anzeigt, aufweist, darlegt, darstellt, enthüllt, entwickelt, offenbar macht und ›ihr seht es‹, davon sagt. Durch Werden, ihr Mönche, ist Geburt bedingt«, und nun weiter bis »durch Unwissen, ihr Mönche, sind Unterscheidungen bedingt. Das nun, ihr Mönche, was da Wirklichkeit ist, nicht Unwirklichkeit, unveränderlich sein, im Verhältnis bestehn: das wird, ihr Mönche, die bedingte Entstehung genannt.« Derselbe Gedankengang ist auch in der 63. Rede der Mittleren Sammlung zu erkennen, 466, wo der Meister zu Mālunkyāputto sagt: Ob die Ansicht ›Endlich ist die Welt‹ besteht, oder die Ansicht ›Unendlich ist die Welt‹, ob die Ansicht ›Leben und Leib ist ein und dasselbe‹ besteht, oder die Ansicht ›Anders ist das Leben und anders der Leib‹, ob die Ansicht über die Art des Vollendeten so oder so besteht oder nicht besteht: »sicher besteht Geburt, besteht Alter und Tod, besteht Wehe, Jammer, Leiden, Gram und Verzweiflung, deren Zerstörung ich schon bei Lebzeiten kennen lehre.« Insofern ist, was die Kunde der Meister vergangener Zeiten und künftiger Zeiten betrifft, ganz gleich mit der Kunde, die hier mitzuteilen einem Erwachten zukommt. Es ist das ABC des Buddhismus, besser: die Formel, die aus dem Bannkreis entführt; der Faden, richtig aufgegriffen, aus dem Wirrwarr der Welt, wo es kein Entrinnen gibt, wenn sich Daidalos, der spaltende Künstler, nicht erbarmt, nach dem Gleichnis in der Aeneis V 27-30:
Hie labor ille domus et inextricabilis error;
Magnum reginae sed enim miseratus amorem
Daedalus ipse dolos tecti ambagesque resolvit
Caeca regens filo vestigia.
Einer von denen, die es selbständig auch schon herausgefunden und die Formel doch wenigstens richtig zu buchstabieren verstanden haben, ist STERNE gewesen, mit seiner zehnfachen Reihe: »What a jovial and a merry world would this be, may it please your worships, but for that inextricable labyrinth of debts, cares, woes, want, grief, discontent, melancholy, large jointures, impositions, and lies!«, Tristram Shandy CLXXV.
858 Vergl. die zahlreichen verwandten Stellen, in der Mittleren Sammlung 55., 71., 90., 103., 126. Rede; auch zu Beginn unserer 8. Rede.
859 Mit S etc. aññatitthiyā paribbājakā. Die »andersfährtigen Pilger« sind Asketen anderer Orden, die eine andere als die von Gotamo gezeigte Furt durch das Meer der [856] Wandelwelt zur Ewigkeit hinüber suchen oder gefunden zu haben vermeinen. Es ist das ihre Sache und ihr Recht, sie werden darum weder gelobt noch getadelt, nur gekennzeichnet. Das gegenseitige Verhältnis wird näher betrachtet am Ende des vorletzten Absatzes der 1009. Anmerkung.
860 Udāyī, an den sich hier Sāriputto gleichsam epodisch abschließend gewandt hat, war einer der hervorragenderen Jünger. Er erscheint noch in der Mittleren Sammlung 429f., 482-490, 998 und in den Liedern der Mönche ist ein herrlicher Strophengesang unter seinem Namen überliefert, v. 689-704. Er selbst stellt den Gang seiner geistigen Entwicklung sehr schön dar, im Saṃyuttakanikāyo erhalten, Mahāvāravaggo Ende des Udāyivaggo, vol. V p. 109-110 der siamesischen Ausgabe. (Die Ausgabe der Pāli TextSociety ist auch bei dieser Sammlung leider so flüchtig hergestellt, daß sie oft im Stiche läßt und daher nur wegen der Varianten und vergleichsweise zu benützen ist: so schließt z.B. der Bericht vol. V p. 90, mit dem Schreibfehler pajānissāmī ti ab, während die Handschriften und die ed. Siam. natürlich das richtige pajānissasī ti haben usw.) Udāyīs eigenes kurzes Bekenntnis ist für ihn und jene großen Gestalten und Erinnerungen so bezeichnend, daß es hier vollständig folgen mag. »Zu einer Zeit weilte der Erhabene im Lande der Sumbher, bei Setakam, wie eine Burg im Sumbherlande heißt. Da ist denn der ehrwürdige Udāyī zum Erhabenen herangekommen, hat den Erhabenen ehrerbietig begrüßt und beiseite Platz genommen. Beiseite sitzend wandte sich nun der ehrwürdige Udāyī also an den Erhabenen: ›Erstaunlich, o Herr, außerordentlich ist es, o Herr, wie gar sehr es mich eben, o Herr, gefördert hat, daß ich beim Erhabenen Liebe und Ergebenheit gewonnen, demütig und mürbe werden gelernt habe! Denn früher, o Herr, als ich im häuslichen Stande lebte, hab' ich mir nicht viel aus der Lehre gemacht, nicht viel aus der Jüngerschaft gemacht. Als ich aber, o Herr, zu merken anfing, daß ich beim Erhabenen Liebe und Ergebenheit empfand, demütig und mürbe zu werden begann, bin ich aus dem Hause in die Hauslosigkeit gezogen. Da hat mir denn der Erhabene die Lehre dargelegt: »So ist die Form, so entsteht sie, so löst sie sich auf; so ist das Gefühl, so entsteht es, so löst es sich auf; so ist die Wahrnehmung, so entsteht sie, so löst sie sich auf; so sind die Unterscheidungen, so entstehn sie, so lösen sie sich auf; so ist das Bewußtsein, so entsteht es, so löst es sich auf.« Und ich bin dann, o Herr, in eine leere Klause gegangen und habe diese fünf Stücke des Anhangens nach oben und nach unten herumgedreht und habe »Das ist das Leiden« der Wahrheit gemäß verstanden, »Das ist die Leidensentwicklung« der Wahrheit gemäß verstanden, »Das ist die Leidensauflösung« der Wahrheit gemäß verstanden, »Das ist der zur Leidensauflösung führende Pfad« der Wahrheit gemäß verstanden. Die Lehre hab' ich, o Herr, begriffen, die Fährte hab' ich betreten, die mich bei Pflege und Übung und immer weiterem Vordringen dahinbringen wird, daß ich »Versiegt ist die Geburt, vollendet das Asketentum, gewirkt das Werk, nicht mehr ist diese Welt« verstehn werde. Der Einsicht Erweckung, o Herr, des Tiefsinns, der Kraft, der Heiterkeit, der Lindheit, der Innigkeit, des Gleichmuts Erweckung hab' ich gefunden; die werden mich bei Pflege und Übung und immer weiterem Vordringen dahinbringen, daß ich »Versiegt ist die Geburt, vollendet das Asketentum, gewirkt das Werk, nicht mehr ist diese Welt« verstehn werde. Das ist, o Herr, die Fährte, die ich gefunden habe: die wird mich bei Pflege und Übung und immer weiterem Vordringen dahinbringen, daß ich »Versiegt ist die Geburt, vollendet das Asketentum, gewirkt das Werk, nicht mehr ist diese Welt« verstehn werde.‹[857] – ›Recht so, recht so, Udāyī. Da hast du wohl, Udāyī, jene Fährte gefunden, die dich bei Pflege und Übung und immer weiterem Vordringen dahinbringen wird, daß du »Versiegt ist die Geburt, vollendet das Asketentum, gewirkt das Werk, nicht mehr ist diese Welt« verstehn wirst.‹« –
Mit der gerechten Würdigung und Wertschätzung, die oben am Ende der Rede Udāyī und Sāriputto verlauten lassen, vergleiche man die entsprechende Stelle in der 4. und 12. Rede der Mittleren Sammlung, S. 25 und 93, über das »wahnlose Wesen«, als das sich Gotamo selbst bezeichnet. In ebenso schlichter Weise hat, merkwürdig genug und wie eben nur ein Dichter und Seher ahnen kann, DANTE dieses Lob gesungen, Paradiso XIX 70-75:
Un uom nasce alla riva
Dell' Indo, e quivi non è chi ragioni
Di Cristo, nè chi legga, nè chi scriva;
E tutti i suoi voleri ed atti buoni
Sono, quanto ragione umana vede,
Senza peccato in vita o in sermoni.
Es ist zwar nur dogmatisch als Beispiel angewandt: aber echt erschaut. Mein alter Freund, der Senator DE LORENZO in Neapel, dem ich die Strophe zur Begutachtung vorgelegt habe, kommt der Erklärung vielleicht noch näher, da er meint, daß DANTE als Meister des gesamten Wissens seiner Zeit auch die Denkschriften MARCO POLOS schon gekannt haben wird, wo ja der erste ausführliche und ausgezeichnete Bericht über Gotamo zu finden ist, siehe Mittlere Sammlung, Anm. 219 und Marzocco vom 20. April 1913: daß also in jener Strophe der indische Heilige mit vollem Bewußtsein der Sache beschrieben sei; um so mehr als DANTE zur Verherrlichung des Asketentums auch Par. XI 49-54 von der Sonne spricht, die einst am Ganges geboren ward, im Vergleich zu einer Sonne der Welt, wie er San FRANCESCO nennt: wobei er nun überdies noch das bedeutsame, wie nach indischem Muster geformte Wortspiel anbringt, man dürfe diesen nicht nach Ascesi (Askese=Aufstieg) Assisi benennen, was zu wenig wäre, sondern nach dem Orient, wenn man recht sagen will:
Però chi d'esso loco fa parole
Non dica Ascesi, chè direbbe corto,
Ma Oriente, se proprio dir vuole.
Da ist also im kühnen Umriß des Dichters schon vorgezeigt was ein halbes Jahrtausend später erst der Philosoph, wissenschaftlich gerüstet, als den angebornen indischen Geist San FRANCESCOS ausgeführt hat, Welt als Wille und Vorstellung II Kap. 48 Mitte. Dem Scharfsinn und der hohen Besonnenheit DANTES ist demnach hier ein besonderer Lorbeer zu weihen, zumal wenn man bedenkt, wie schnell so feine Kunde wieder gänzlich vergessen war, und z.B. späterhin CAMPANELLA, der auch de Cingho, das ist (Sakya)siṇho, spricht, nicht mehr zu sagen wußte als: Cinghus finxit se filium Solis; et signa mirabilia fecit Tartaris. Transire visus est Mare Caspium sicco pede. Atheismus triumphatus, cap. XIII 5 i.f. Da war denn die Wertschätzung wieder zurückgesunken und beim platten Volksmirakel angelangt, wie es immer und überall am meisten beliebt ist; weil man doch dem Nachdenken Nachfaseln vorzieht. Aber jenes »wahnlose Wesen« ist richtig mit SCHILLER zu nennen der Genius mit des Siegels Gewalt, das alle Geister ihm beugt: einfach geht er und still durch die eroberte Welt. An ihm ist erfüllt was GOETHE vorgesehn hat: daß mit seinem Namen Jahrhunderte [858] könnten durchgestempelt werden. Ihn kann man wirklich so heißen wie es im Doktordiplom JEAN PAULS steht: Virum qualem non candidiorem terra tulit.
861 Ekaṃ samayaṃ bhagavā Sakyesu viharati, Vedhaññā nāma Sakyā mit S zu lesen. Vidhaññā, etwa »Ödenstein«, also wohl eine hochgelegene Felsenburg, ist an der südöstlichen Grenze von Nepāl zu suchen, in deren Umkreis auch die bekannten Festungen Nagarakam und Metāḷumpam gelegen waren, die gleichfalls dem südlich verzweigten Stamme der Sakyer zugehörten. Der sakkische Herrensitz und Hauptort des ganzen Gebietes war oben im Norden Kapilavatthu, Gotamos Heimat, etwa zwei Tagemärsche weiter hinauf. Der nördliche Stamm scheint für sich die landestümliche Lautform Sakker vorgezogen zu haben. Näheres hierüber in der Mittleren Sammlung Anm. 429, letzter Absatz.
862 Vadho yev'eko maññe nigaṇṭhesu Nāthaputtiyesu vattati zu lesen, nach S an derselben Stelle der 104. Rede in der Mittleren Sammlung, ed. Siam. vol. III p. 47; auch CHALMERS hat diese richtige Fassung, nach S, M etc., aufgenommen, Majjhimanikāyo vol. II p. 244. Das üble Benehmen der Jünger und Anhänger Nāthaputtos gleich nach seinem Tode reiht ihn selbst jenen »drei Arten von Meistern« an, »die Tadel in der Welt verdienen«, einen gerechten und unleugbaren Tadel, wie Gotamo in der 12. Rede S. 162-164, mit ausführlicher Begründung darlegt: eine Ansicht, die sich mit der des heiligen BERNHARD vollkommen deckt: »Ad magistrum respicere dicitur, quicquid a discipulis delinquitur«, Opera ed. Par. 1621 fol. 2149 cap. 133, De magistro.
863 Vergl. Mittlere Sammlung Anm. 334. Mit diesem, dort weiter nachgewiesenen, von ARRIAN nach MEGASTHENES als eigentümlich indisch bestens bestätigten Gleichnis aus der Architektur, von der geborstenen Kuppel, die keine Zuflucht gewährt, ein Bild der Unsicherheit für praktische Zwecke, ist zugleich auch der unerfreuliche, abstoßende, Unruhe schaffende Eindruck der äußeren Erscheinung sehr glücklich gekennzeichnet: Nāthaputtos Lehre ist zwar ein mächtiges Bauwerk, aber eine halbe Ruine, sie gewährt keinen rechten Schutz, und der Giebel fehlt. Es sieht also ungefähr aus, um uns die Sache an bekannteren großen Beispielen näher zu veranschaulichen, wie sich mit ihrer ungekrönten plumpen Masse Notre Dame zeigt, im Gegensatz etwa zu Sankt Stephan, der allem wuchtig Klotzigen frei entwachsen dasteht als der Sieger. Eingehend behandelt wird Nāthaputto, seine Lehre und sein Orden in der 2. Rede, S. 42, in der Mittleren Sammlung, S. 105-106, 405-420, 425-427, Anm. 79, S. 534 nebst Anm. 114, S. 586, 639, 777-784 u. Anm. 471; cf. auch Bruchstücke der Reden Anm. 779. Der Hauptsatz seiner Lehre wird von einem Jünger Gotamo gegenüber so ausgesprochen: »Man kann eben nicht, Bruder Gotamo, Wohl um Wohl gewinnen: um Wehe läßt sich Wohl gewinnen«, Mittlere Sammlung 106. Und diese Ansicht »Wohl um Wehe« zeigt sich ohne Umschweife schon zu Beginn des Eintritts in den Orden bei der symbolisch gedachten und zugleich grausam wirklichen Observanz, daß sich der Jünger Haupt- und Barthaar nicht etwa wie bei den Buddhisten abscheren, sondern je einzeln ausrupfen läßt, und ebenso an allen anderen behaarten Körperstellen (Aupapātikasūtram ed. LEUMANN p. 40 dhuyakesamaṃsulome, cf. p. 68 § 72 parūḍhanahakesakakkharomāo): eine Regel, der auch die Nonnen des Ordens, heute wie einst, unverbrüchlich nachkommen. Ein Beispiel für zahllose aus der Zeit Gotamos ist Bhaddā, in den Liedern der Nonnen v. 107; aus der Gegenwart spricht folgendes, nach dem Augenzeugnis in OMANS Sammelwerk über die heutigen »Mystics, ascetics and saints of India«, London 1903, von dem neulich verstorbenen SPEYER in seiner indischen Theosophie, Leipzig 1914, S. 218f. mitgeteilt: »Bei den Jains war es auch, daß OMAN das auffälligste Beispiel der Weltentsagung aus wahrer [859] Überzeugung antraf. Es war eine junge kürzlich verheiratete Frau von erst sechzehn Jahren, aus gutem Stande. Aus rein religiösem Bedürfnis hatte sie ihren Mann gebeten, ob er fortan für sie nicht mehr sein wolle als ein Bruder. Ihr Mann willigte ein, und mit ihrer Zustimmung suchte er sich eine zweite Frau. Als diese ins Haus kam, entsagte die erste feierlich dem eitlen Weltleben, verkaufte ihre Juwelen, die einen Wert von 2000 Rupien darstellten, verwendete den Erlös dazu, um bei einem Abschiedsfeste Brahmanen zu bewirten und zu beschenken, und wurde Nonne. Sie ließ sich, wie es die Ordensregel fordert, ihr prächtiges schwarzes Haar und die Augenbrauen auszupfen, vertauschte ihre kostbaren Kleider mit den groben, einfachen weißen Gewändern des Ordens und zog fort, um, wie ihre Schwestern, mit den gewöhnlichen Attributen der Jaina-Asketen ausgerüstet, nämlich ein Tuch vor dem Mund und in der Hand einen Besen aus Baumwollfäden, mit welchem sie die kleinen Insekten, die sie auf ihrem Wege finden, sanft zur Seite schieben, das Leben einer heiligen Bettlerin zu beginnen.« Die jinistischen Büßer sind es, die darum in unseren Texten schlechthin »die Haar- und Bartausraufer« genannt werden, so in der 8. Rede S. 118, und oft. Und eben das auch gehört zu jener traurigen, groben, unedlen Askese, die Gotamo abgelehnt hat, als nur einer abstoßenden Lehre und Ordnung gemäß, die Unbehagen, Mißfallen und Widerwillen erregt, die kein vollkommen Erwachter kundgetan hat: während seine Botschaft und Heilsordnung am Anfang begütigt, in der Mitte begütigt, am Ende begütigt, sinn-und wortgetreu bleibt, das vollkommen geläuterte, geklärte Asketentum darlegt, S. 45, Mittlere Sammlung 930 und durchgängig. Über Nāthaputto als den jinistischen Meister läßt sich kurz sagen, daß seine Lehre und Ordnung nicht wie die Gotamos eine zeitlos gültige genannt werden kann, sondern nur eine ländlich-sittlich beschränkte, nämlich extrem indische, insofern sie das Büßertum auf einen stumpfen Giebel treibt: daher denn endlich völlig nackt zu gehn und Tod durch Verhungern dem echten Bekenner zur Pflicht wird, nebst hundert und hundert anderen peinlich ausgeklügelten Verordnungen. Ein ungeheuerer Ernst der Weltbetrachtung, im Gefühl wurzelnd, daß einzig restlose Bußarbeit wirklich vom Dasein befreien könne, ist aber diesen Freien Brüdern und Jainās, wie sie sich nach Nāthaputto dem jino, Sieger, nennen, durch und durch eigen. Die kolossalen Siegerstatuen des Gommaṭa-Ṛṣabha-Nāthaputto bei ravaṇabeḷgoḷa, Kārkaḷa und Veṇūr, auf einer Bergspitze, in der Ebene und am Rande von Wasserspiegeln, auf dem Gebiete von Maisūr und von Madras, in ihrer lebensentrückten unnahbaren Härte sehr verschieden von den heiteren stillfreundlichen buddhistischen Standbildern, wie Titanen über krabbelnder Zwergenwelt anzuschauen, bis über siebzehn Meter emporragend, aus dem granitenen Felsen gemeißelt, krönen ihre turmwüchsige Art mit einem uns anderweit unbekannten Ausdruck von Schwersinn, legen künstlerisch ein ungemein beredtes, höchst eigenartiges Zeugnis ab, sie erinnern in ihrer unheimlich vergeisterten Starrheit, der die geistige Vollendung als letzte lächelnde Oberhoheit fehlt, eben wiederum merkwürdig an die massigen Türme von Notre Dame. Man mag hinterher über solche zwar unvollkommene Meisterwerke denken wie man will: steht man ihnen gegenüber, so findet man doch GOETHES Anblick, Annalen 1803, auch hier wundersam bezeugt: »die Totalwirkung bleibt immer das Dämonische, dem wir huldigen.« Der Orden ist heute noch in ganz Indien, besonders zahlreich in den westlichen Mittelprovinzen, bestanden und hat Nachfolger sowohl der strengsten Observanz als auch Anhänger von milderer und mehr gelehrter Richtung. Für die letzteren gilt mit als Grundlage der Ordensgemeinschaft die völlige Enthaltung von jedweder tierischen Nahrung. Vergl. noch Anm. 523, 554, 651, 719, 741. Die Bildsäulen und ihre [860] Inschriften hat HULTZSCH in der Epigraphia Indica, VII 108-115, in vortrefflicher Wiedergabe veröffentlicht und besprochen. Über den außerordentlichen Eindruck auch späterer jinistischer Standbilder, die ich am Gwaliorberge aufgesucht habe, Gestalten bis zwanzig Meter Höhe, frei aus dem Urgestein der Felsenwände getreten, ist in der Mittleren Sammlung, Anm. 325, letzter Absatz berichtet; noch andere echt erschaute, aus Mathurā, weiter nördlich hinauf an der Yamunā, sind Ende der 1011. Anm. nachgewiesen: es sind die ältesten bisher aufgefundenen, aus dem zweiten vorchristlichen Jahrhundert inschriftlich sichergestellt. Erwähnt sei schließlich noch die schöne Grottenskulptur der Jainās in Gujarāt, vom Felsenhaupt Girnār auf der westlichen Halbinsel bis zu den Klüften am Berg Ābū in Rājputāna: hoch über einer herrlichen Landschaft haben da vermögende Anhänger der Jainās in der Ära der Caulukyer Fürsten um 1000-1250 ein Labyrinth von Säulengängen und -höfen, helldunklen Kuppelräumen, Heiligenaltaren und -büsten, zumeist aus weißem Marmor, von erlesenen Künstlern ausführen lassen, mit einer sonst nirgend erreichten Gesamtwirkung.
864 Sāmagāmo ist wahrscheinlich heute noch als Sāmadevī erhalten, ein kleiner verfallener Weiler im Südwesten von Niglīvā in Nepāl, die Ruinen unter sumpfiger Ablagerung begraben: siehe den Beleg in der Mittleren Sammlung, Anm. 333. Es ergeht einem dort wie der Gräfin Orsina im umgewandelten Dosalo: »Der Ort ist es: aber, aber!« – Über den Namen Ānando und seine Beziehung zur altvedischen Zeit handelt die 428. Anm., wo ebendieser Name auf einer Inschrift vorkommt: er deutet auf den Seher Ānandajas, der im ersten Abschnitt des Vaṃ abrāhmaṇam überliefert ist.
865 Niganṭho bhante etc. mit S etc. zu lesen.
866 Mit S aviññāpitatthāpissa, d.i. aviññāpitā ettha api assa; dann na ca nesaṃ und sabbasangāhapadagataṃ; zu sappāṭihīrakataṃ, gut zum erfassen, cf. Anm. 407 die genauen Nachweise.
867 viññāpitatthāvassa S, lies: viññāpitatthavassa, d.i. viññāpitā ettha v'assa.
868 tad ass' eva bahujanahitāya mit S, wie am Anfang und am Ende.
869 Ebenso der Stempel zu Beginn der 139. Rede in der Mittleren Sammlung, S. 1017f. weder zureden noch abreden, nur aufweisen. Denn die Satzung Gotamos ist in der sattamī gegeben, im Potential, und nicht in der pañcamī, dem Imperativ. Sie zwingt und befiehlt nicht, sie zeigt und erklärt. Sie hat wie der Arzt einen Heilplan entworfen und gibt eine Indicatio morbi. Und zwar ist nichts anderes gemeint als das Aufweisen der Wahrheit vom Leiden, die mit dem Dasein eins ist. Dies aber kann und wird hier so bündig wie möglich geschehn, nur etwa mit den Worten: »Ist freilich die Fessel des Daseins abgestreift, ist das Dasein abgestreift worden.« Denn sonst wären ja unermeßliche Beschreibungen, unermeßliche Bestimmungen, unermeßliche Erläuterungen ebendieser Wahrheit vorzutragen: aparimāṇā vaṇṇā aparimāṇā vyañjanā aparimāṇā saṃkāsanā, Saṃyuttakanikāyo V 430. Dessen bedarf es nicht. Merkt man aber gar, daß der Gegenredner ein blagueur ist, opiniâtre, acariâtre wird, daß er das Gespräch in ein müßiges und sinnloses Schwätzen verzieht, »von einem ins andere kommt, vom Gegenstande abschweift, Zorn, Haß und Verdrossenheit an den Tag legt«, wie es z.B. in der 36. Rede der Mittleren Sammlung (279) und öfters recht anschaulich dargestellt ist: dann hat man sich so zu verhalten wie es bis heute noch dem Inder als ein akzentloser Takt eignet, insbesondere den zudringlichen Ausländern und Reisenden aus aller Herren Ländern gegenüber. Ganz hübsch ist das auch aus dem Bericht zu ersehn, den BARTHOLOMÄUS ZIEGENBALG uns gegeben hat. Als nämlich dieser eifrige Missionar im Herbst 1707 mit einem Brāhmanen in Trankebar zusammengetroffen [861] war und ihm alsbald eine lange Predigt gehalten hatte, opiniâtre, acariâtre ab acaritate, über die Verkehrtheit, Verderblichkeit, Verächtlichkeit der ölgötzischen Anschauungen gegenüber der ewigen und einzigen Heilswahrheit des Christentums und über die entsetzliche Sünde, blind an dem heidnischen Wahn sich festzukleiben, nicht an den allentsühnenden Opfertod des Gekreuzigten zu glauben usw.: da dankte, nach Schluß der Rede, jener Zuhörer höflich und sagte nur, er würde ein andermal wiederkommen. Dergleichen Hypostasen kannte er nämlich schon besser, sogar aus dem Gītagovindas, wo Kṛṣṇas, I 10, jagadapagatapāpaṃ, amitabhavatāpaṃ: die Welt entsühnt hat ihrer Schuld, ausgelöscht die Daseinsglut. So hatte damals auch der Brāhmane von Trankebar sich dem Lausitzer Flibustier entzogen, ohne zugeredet, ohne abgeredet zu haben, ohne sich überhaupt noch weiter mit der ach so bequem gekreuzigten Vertreterweisheit und den Halluzinationen und Faxen eines verschrobenen Kopfes zu befassen. Mit dem Gegenbesuch aber dürfte er es ebenso gehalten haben wie einst der lydische Philosoph CHRYSANTHIOS, der sogar auf die Einladung des wirklich vortrefflichen Kaisers JULIAN ruhig zu Hause geblieben war; und wie jener Lydier wird er nur um so ernstlicher für sich allein weitergeforscht und gestrebt haben, indem er die liebe leidige Welt in ihrem vieltausendjährigen Narrenleben in Gottesnamen fortwandeln ließ. Und er wird noch dabei so ungefähr gedacht haben: »Das leidige Marterholz, das Widerwärtigste unter der Sonne, sollte kein vernünftiger Mensch auszugraben und aufzupflanzen bemüht sein«, wie GOETHE, im Sommer seines letzten Lebensjahres, ZELTERN gegenüber endgültig bekennt, als Abschluß seiner Ansicht: »Wir halten es für eine verdammungswürdige Frechheit, jenes Martergerüst und den daran leidenden Heiligen dem Anblick der Sonne auszusetzen, die ihr Angesicht verbarg, als eine ruchlose Welt ihr dies Schauspiel aufdrang, mit diesen tiefen Geheimnissen, in welchen die göttliche Tiefe des Leidens verborgen liegt, zu spielen, zu tändeln, zu verzieren und nicht eher zu ruhen, bis das Würdigste gemein und abgeschmackt erscheint«, Wilhelm Meisters Wanderjahre II 2. Noch abgeklärter aber tritt der Geist dieser indo-europäischen Selbstbestimmung aus einer Anekdote LICHTENBERGS hervor, allem Marterzwang und Widerstreit abhold: SHAFTESBURY, erzählt er, sprach einmal mit einem Freunde über Religion. Verschiedenheit der Meinungen, sagte er u.a., fände sich nur unter Menschen von mittelmäßigen Fähigkeiten und Kenntnissen, Leute von Geist hätten durchaus nur Eine Religion. Und was ist das für eine, fragte jemand. Das sagen Leute von Geist nicht, war die Antwort. Aber nicht ablehnend, tief im Einklang mit dem Löwenruf Gotamos am Ende unserer 25. Rede »Willkommen sei mir ein verständiger Mann, ich führ' ihn ein, ich lege die Satzung dar«, oder wie es oben im Texte heißt »Weder zureden noch abreden, nur aufweisen«, hat der immer herrliche Sankt BERNHARD gesagt, auf den Wiederbegründer des alten asketischen Heilwegs zurückweisend: »Ut sentio ego, regula sancti BENEDICTI omni homini proponitur, imponitur nulli«, De praecepto et dispensatione liber, cap. II, ed. Par. 1621 fol. 922. Der indische und insbesondere der gotamidische Geist einer wohlverstandenen edelsten Freiheit und freiwilligen Kraft war hier von einem Jahrtausend zum anderen sieghaft durchgedrungen: und er ist noch über ein ferneres Jahrtausend der weithin strömende Bronnen,
Bei der reinen reichen Quelle,
Die nun dorther sich ergießet,
Überflüssig, ewig helle,
Rings durch alle Welten fließet.
[862] Bis endlich in späteren Tagen und zumeist in jetziger Zeit aus dem Weltenborn der einstigen Geistesquelle ein vorzüglicher Likör destilliert wurde: dem gegenüber der alte benediktinische Geist so schweigsam fernestehn bleibt wie der des Aias in der Unterwelt gegenüber dem schlauen Odysseus, XI 544. – Mit S richtig sveva sādhukaṃ saññāpetabbo tassa ca atthassa tesañ ca vyañjanānaṃ nisantiyā.
870 utuparissayavinodanaṃ mit S etc. Eine gleiche Darlegung der Ordensregel in der 2. Rede der Mittleren Sammlung, S. 14, über welche in der 77. Rede, 566-568, die feinere Betrachtung erst völlig aufklärt, bei der Besprechung des Satzes »Zufrieden ist der Asket Gotamo mit was immer für einem Gewände« usw.: was zwar als recht gut aber als kein Merkmal der Vertrauenswürdigkeit und der Nachfolge gilt, die auf ganz andere Dinge gegründet ist. Der dort von seiten der Fernstehenden als vermeintliches Lob ausgesprochene Satz ist, aus demselben Gefühl hervorgegangen, bei JUVENAL wiederzufinden, III 170:
Contentusque illic veneto duroque cucullo.
Für den echten Jünger gilt es aber gleich was für Wams er trägt, was für Atzung er ißt, ob grob oder fein, ob da oder dort: »wie Vollmond heiter haftlos durch die Straße strahlt, kein Hangen zieht ihn hin zu Herdes Häuslichkeit«, Lieder der Mönche v. 1119; wie die Hand, in den Raum ausgestreckt, an nichts hangen bleibt, von nichts erfaßt, von nichts gefesselt wird, so wird auch das Gemüt des Mönchs, wenn er auf seinem Gange das Almosen erhält oder nicht erhält, von keinerlei Dingen mehr beeinflußt, von nichts erfaßt, von nichts gefesselt, Saṃyuttakanikāyo ed. Siam. vol. II p. 178f. (PTS 198). Daher sagt einmal der Meister zu Kassapo, dem vorzüglichsten der Mönche in rauher Zucht: »Alt bist du jetzt geworden, Kassapo, beschwerlich sind dir da diese härenen Fetzengewande, die abgetragenen: so magst du denn, Kassapo, nunmehr häusliche Kleider anlegen und dich zur Mahlzeit auch einladen lassen, und du sollst mir nahe weilen.« Kassapo aber antwortet, er sei schon seit langem ein Waldeinsiedler und preise das Waldeinsiedlertum, seit langem nehme er nur Almosenbrocken an, trage nur die drei Gewänder aus geflickten Lappen, als ein Bedürfnisloser, Zufriedener, Zurückgezogener, der Geselligkeit flieht und unermüdlich ausharrt; der da solch eine Regel beim Erwachten sich erwählt hat und anderen empfiehlt, weil sie zum eigenen Wohlbefinden bei Lebzeiten führt und zugleich auch den Jüngern zur rechten Nachfolge voranleuchtet: darum will er, aus Rücksicht auf sich sowohl wie aus Erbarmen mit den Ordensgenossen, dabei bleiben. Der Meister nun billigt auch diesen Standpunkt und sagt: »Recht so, recht so, Kassapo: vielen zum Wohle bist du ja, Kassapo, so beflissen, vielen zum Heile, aus Erbarmen zur Welt, zum Nutzen, Wohle und Heile für Götter und Menschen. Darum magst du denn, Kassapo, nur eben die härenen Fetzengewande behalten, die abgetragenen, und nimm die Almosenbrocken an, und weile nur im Walde.« Mit S, 1. c. 182f. (PTS 202f.) araññeva zu lesen, zu Beginn jiṇṇo 'si dāni tvaṃ. Ein weiteres Gespräch mit Kassapo, ib. 199 (221), zeigt übrigens, daß Gotamo selbst, als der richtige nur von Almosen gefristete Pilger, mit einem abgetragenen Gewande, zusammengeflickt aus härenen Lappen, bekleidet war. Das Gewand war, der Ordensregel gemäß, gleichmäßig fahlbraun gefärbt und wurde von Zeit zu Zeit immer saubergewaschen, von jedem für sich. Nordwestlich vom großen Kuppelmal in Sārnāth, dem Dhamek bei Benāres, lag ein viereckiger Felsblock, etwa zwei Meter lang, ein Meter breit, auf welchem auch der Meister seine Gewänder, nachdem er sie in einem nahen Teiche gewaschen hatte, zum Trocknen [863] auszubreiten pflegte. Dieses Steinflies war dann im Laufe der Zeit berühmt geworden: HIUEN-TSIANG hat es ein Jahrtausend später auf seiner Pilgerfahrt aufgesucht und beschrieben, bei JULIEN II 360, und CUNNINGHAM hat die denkwürdige Platte vor achtzig Jahren wieder entdeckt und ausgegraben. Bald nachher war sie verschwunden, zugleich mit mehr als vierzig edlen alten Statuen und vielen anderen kostbaren Skulpturen, die CUNNINGHAM im weiteren Umkreis dieser Stätten glücklich aufgeschürft hatte: altes Steinzeug, das man nach seiner Abreise praktisch verwendet hat, nämlich zur Ausfüllung eines schadhaft gewordenen Brückenpfeilers an der vorbeifließenden Barna, »car ted away by the late Mr. DAVIDSON and thrown into the Barna River under the bridge to check the cutting away of the bed between the arches«: Archaeological Survey of India, Simla 1871, vol. I p. 123f. Vergl. Hamlet V I, 236-239.
871 yam aññatitthiyā paribbājakā evaṃ vadeyyuṃ mit S.
872 Ime panāvuso mit S etc. – Erfolge und Förderungen der Art sind noch im Chakkanipāto des Anguttaranikāyo gezeigt, nach drei verschiedenen Gesichtspunkten je als sechsfache Reihe vorgeführt in Nr. 102 bis 104. Die Anordnung beginnt da so: »Sechs sind es, ihr Mönche, der Förderungen, deren Anblick einem Mönche schon genügt um bei allen Unterscheidungen sich in nichts einzulassen und die Wahrnehmung der Vergänglichkeit zu bestätigen: und welche sechs? ›Alle Unterscheidungen müssen mir als unbeständig erscheinen; an der ganzen Welt kann mein Sinn keine Freude finden; von der ganzen Welt wird sich der Sinn mir ablösen; zur Erlöschung neigen wird sich mein Sehnen; die Fesseln fallen von mir ab; das höchste Asketentum wird mir zukommen.‹ Das sind, ihr Mönche, sechs Förderungen, deren Anblick einem Mönche schon genügt um bei allen Unterscheidungen sich in nichts einzulassen und die Wahrnehmung der Vergänglichkeit zu bestätigen.« Weitere Förderung ist dann, daß ihm jede Unterscheidung wie ein Mörder mit gezücktem Schwerte vorkommen wird; er wird in der Erlöschung den Frieden erkennen, seine frühere Gewöhnung zerfällt; das Werk wird er vollbringen, dem Meister liebreich gedient haben; er wird zu allem in der Welt ohne Beziehung bleiben, »unmittelbar« werden, atammayo (wie Mittlere Sammlung 1008); die Anwandlungen von »Ich« und »Mein« wird er entwurzeln, eine mit gewöhnlichen Begriffen unvereinbare Wissenschaft erwerben (wie Mittlere Sammlung 354-356); den Anlaß wird er eingesehn haben, und daß die Dinge veranlaßt hervorgehn. Das sind noch die zwei anderen Reihen der Förderungen, wobei sich der Mönch in nichts einläßt und die Wahrnehmung des Leidens und der Nichtigkeit bestätigt.
873 Hierzu Mittlere Sammlung 167f., 194f., 956; auch Bruchstücke der Reden v. 502. Wiederholt wird der Spruch in den Liedern der Mönche v. 67, 170, 202, 216, 339, der Nonnen v. 22, 160.
874 Vergl. Mittlere Sammlung 1020f.. Nach S zu lesen kālavādī bhūtavādī saccavādī atthavādī dhammavādī vinayavādī. – Auf diesen und den folgenden Absatz ist erst vollkommen anwendbar was GRACIAN in seiner Schrift über den Helden sagt, El Heroe, Primor III: Son los dichos de Alexandro esplendores de sus hechos. Fue prompto Cesar en el pensar como en le hazer: »Es sind die Worte Alexanders die Verklärer seiner Taten. Er war der fertige Herrscher im Denken wie im Handeln.« Kurz Hamlet, V 2, 234: the readiness is all. Auch Lear, V 2, 12: Ripeness is all.
875 Dergleichen Spekulation über Sein und Nichtsein oder weder Sein noch Nichtsein usw. taucht bekanntlich schon in der Atharva- und Ṛksaṃhitā auf, und zumal im berühmten Nāsadāsīnno-Hymnus der letzteren, X 129, wird das Thema mit hoher dichterischer Kraft entwickelt, als bhāvavṛttam, wie das Werden entstanden ist:
[864] Kein Nichtsein war, kein Dasein war am Anfang,
Kein Wolkensaum, und jenseit war kein Himmel:
Was kreiste her? wohin? woran gehalten?
Was für ein Fließen war die dichte Tiefe? usw.
Später sind dann die Upanischaden vorzüglich mit der Betrachtung und Erörterung dieser Dinge beschäftigt. »Es ist nicht so und nicht so, das Selbst«, sagt Yājñavalkyas zu König Janakas: »unerfaßbar wird es ja nicht erfaßt, unbrechbar bricht es ja nicht, ohne Hangen und Halt hangt es und wankt es ja nicht«, Bṛhadāraṇyakā IV 2 Ende. In der Māṇḍūkyakārikā IV v. 83 scheint Gauḍapādas, der Vorgänger aṃkaras, insbesondere auf die Schlagworte vom Bestehn oder Nichtbestehn oder weder Bestehn noch Nichtbestehn, wie unser Text sie oben gibt, sich mit asti nāsti, nāsti nāsti bezogen zu haben; und ihm folgend hat ein vor zwanzig Jahren hochberühmter und -betagter sehr geistvoller Brāhmane, der Nackte Büßer Bhāskarānandajī Sarasvatī, die ganze Stelle mit ihren Alternativen als abhāvaṃ vīpsayā, sarvathā ūnyarūpam glossiert, d.h. Nichtsein je und je, allzumal ohne Gestalt: p. 371 seines Kommentars zu acht Upanischaden, den dieser gänzlich besitzlose, kahlgeschorene, fast durchsichtig magere praktische Vedāntist auf Veranlassung seiner Anhänger 1894 in Benāres drucken und, wie jedem freundlichen oder vielleicht nur wissensdurstigen Besucher seines stillen Büßerhains auch mir, nach einem mittäglichen Zwiegespräch in der Augustsonnenglut, mit seinem Namenszug gütig überreichen ließ. Noch eine andere Hauptstelle für zahlreiche gleichlautende ist aus der Tripurātāpinyupaniṣat in der Mittleren Sammlung Anm. 210 angemerkt. Einen kurzgefaßten Denkspruch dazu gibt die Bhagavadgītā XIII 12 als
Anādimat paraṃ brahma,
na sat tan nāsad ucyate:
Nicht Anfang hat das höchste Heil,
Nicht Sein noch Nichtsein gilt von ihm.
Wenn man derartige Stellen mit dem bei uns oben im Text erhaltenen Ausdruck der Gedanken vergleicht, wird es mehr als wahrscheinlich, daß wir hier ein von alters her überliefertes Philosophem zu erkennen haben. Der immer noch rüstige indische Forscher BHANDARKAR hat kürzlich aus nahe hier zuständigen sowie manchen anderen, insbesondere epigraphisch gesicherten, sehr gewichtigen Gründen sogar für die Bhagavadgītā, die doch eine künstlerisch bearbeitete Dichtung ist, den Beginn des vierten Jahrhunderts vor Chr. als Zeit der Abfassung festgesetzt: so daß auch auf diese Weise der bedeutend ursprünglichere Ausdruck unserer buddhistischen Urkunden bei der Ablehnung solcher Spekulation als um reichlich zwei Jahrhunderte zurückliegend bestätigt wird. Siehe R.G. BHANDARKARS Vaiṣṇavism, aivism etc., Straßburg 1913, in BÜHLERS Grundriß der indo-ārischen Philologie, III. Band, 6. Heft, S. 13. Im Saṃyuttakanikāyo sind die Äußerungen Gotamos über diesen Gegenstand in einem eigenen Buche gesammelt, im letzten des vierten Bandes, dem Avyākatasaṃyuttam. Da fragt am Ende dieser »Sammlung der abgelehnten Auskünfte« der Pilger Vacchagotto den ehrwürdigen Sabhiyo Kaccāno über den Zustand des Vollendeten nach dem Tode, und die Antwort lautet: »Was da, Bruder Vaccho, die Grundlage, was da die Bedingung ist einer Mitteilung, er sei formhaft oder unformhaft, er sei bewußt oder unbewußt, er sei weder bewußt noch unbewußt, und solch eine Grundlage, solch eine Bedingung würde sich ganz und gar überall vollkommen restlos auflösen: wie wäre da mitteilend über ihn eine Mitteilung zu machen?« Hier entspricht, beiläufig bemerkt, unser saññī iti vā asaññī iti vā der Form nach genau dem na iti na iti ātmā[865] des Yājñavalkyas, wie oben übersetzt: und wir können so gegenseitig erst die beiden Stellen richtig verstehn und wiedergeben. HILLEBRANDTS Auslegung, Zeitschr. d. deutsch. morgenländ. Ges. 69, 105f., daß na na »nicht als ›nein, nein‹ oder ›nicht, nicht‹ zu erklären ist, sondern = νἡ = om steht«, ist nicht ohne Geist, jedoch unzugehörig. Wirklich aber gehört zu diesem Falle wie auch der ehrwürdige Mahākoṭṭhito gefragt hat (Saṃyuttakanikāyo IV, p. 466, PTS 387), warum denn wohl der Erhabene alle solche Untersuchungen abgelehnt habe, und der ehrwürdige Sāriputto gibt ihm diesen Bescheid: »Wer sich da, Bruder, bei der Form nicht der Begierde entäußert hat, nicht des Verlangens, nicht der Sehnsucht, nicht des Gelüstens, nicht des Fieberns, nicht des Dürstens entäußert hat, der kommt wohl auf die Frage, ob der Vollendete jenseits des Todes besteht oder nicht besteht, oder besteht und nicht besteht, oder weder besteht noch auch nicht besteht. Wer sich da, Bruder, beim Gefühl, bei der Wahrnehmung, bei den Unterscheidungen, beim Bewußtsein nicht der Begierde entäußert hat, nicht des Verlangens, nicht der Sehnsucht, nicht des Gelüstens, nicht des Fieberns, nicht des Dürstens entäußert hat, der kommt wohl auf solch eine Frage. Wer sich aber da, Bruder, bei der Form, beim Gefühl, bei der Wahrnehmung, bei den Unterscheidungen, beim Bewußtsein der Begierde entäußert hat, des Verlangens, der Sehnsucht, des Gelüstens, des Fieberns, des Dürstens entäußert hat, der kommt nicht mehr auf die Frage, ob der Vollendete jenseit des Todes besteht oder nicht besteht, oder besteht und nicht besteht, oder weder besteht noch auch nicht besteht. So ist es, Bruder, begründet, so bedingt, daß der Erhabene eine Auskunft darüber nicht gegeben hat.« Als dann am Ende dieser nach allen möglichen Seiten und Begriffen immer verneinend abgewandelten Gespräche der ehrwürdige Sāriputto die letzte Prüfung anstellt: »Ist aber etwa, Bruder, noch ein anderer Standpunkt zu finden, warum der Erhabene eine Auskunft darüber nicht gegeben hat?«, antwortet ihm der ehrwürdige Mahākoṭṭhito abschließend: »Was bleibt dir nun, Bruder Sāriputto, noch zu wünschen übrig? Für einen Mönch, Bruder Sāriputto, der durch Versiegen des Durstes erlöst ist, gibt es nicht mehr einen Kreis der Mitteilung.« Er gehört in die siebente und letzte Kategorie der Logiker oder Nyāyavai eṣi kās, in die des abhāvas oder Nichtseins, das ohne Anfang und Ende ist: nach Kaṇādas im Tarkasaṃgrahas I usw. Untersuchungen ähnlicher Art haben die Griechen gepflegt, namentlich PLATON im Parmenides, cf. Mittlere Sammlung, Anm. 338, die Hauptstelle aus diesem wunderbaren Dialog. Später ist insbesondere KOLOTES der Epikureer auf Grund der platonisch-parmenideischen Erkenntnisprinzipien eben diese Gedankenbahn weitergezogen: da sieht er den Menschen nicht als seiend an, und das Seiende nicht als den Menschen, το μη ειναι τον ανϑρωπον, και το ειναι μη ον τον ανϑρωπον, nach PLUTARCH, Adv. Colot. cap. XV. Es sind spekulative Fragen und Antworten in suspenso, denen bei Indern wie Griechen und überall das vergilische Wort zukommt: hinc fida silentia sacris. Will man nun trotzdem von ihm, der über Frage und Antwort hinweggelangt ist, noch etwas aussagen, so mag allenfalls die Kennzeichnung geschehn, die LA BRUYÈRE nach einem darin Erfahrenen im siebenten seiner Dialogues sur le Quiétisme p. 281 gibt: »il est réduit au néant, et ne se connoit plus: il vit et ne vit plus: il opere et n'opere plus: il est et n'est plus.« Auch kann man hier das Gespräch anknüpfen aus Richard II, wo der König sich über Gaunt erkundigt und fragt: What says he now?, worauf Northumberland antwortet:
Nay, nothing; all is said:
His tongue is now a stringless Instrument;
Words, life, and all, old Lancaster hath spent.
[866] Aber im erhabenen Stil ist bei uns diese Erkenntnis angedeutet in einer der Kantaten BACHS vom 12. Sonntag nach Trinitatis, mit der überaus schönen ergreifenden Ansprache der Altstimme:
Betracht' ich dich, du treuer Gottessohn,
So flieht Vernunft und auch Verstand davon.
876 Mit S yathā te vyākātabbā, yathā ca te na vyākātabbā; kiṃ vo ahan te etc. Alle die nun im zusammenfassenden Bericht vorgetragenen verschiedenen Ansichten nach dem oberen und nach dem unteren Ende zu werden von Gotamo durch ein witziges Gleichnis ad absurdum geführt, als vernunftwidrig, sinnlos, hinfällig erwiesen. Es ist zweimal in der Mittleren (S. 588, 594) und zweimal in unserer Sammlung erhalten, S. 137, 171. Da wird von einem Manne gesprochen, der Sehnsucht nach jenem Weibe hat, das im ganzen Lande die Schönste sein soll. Und man fragte ihn: »Lieber Mann, die Schönste des Landes, nach der du verlangst und dich sehnst, kennst du diese, ob es eine Fürstin oder eine Priestertochter, ein Bürgermädchen oder eine Dienerin ist?«; und er gäbe »Nein« zur Antwort. Und man fragte ihn: »Lieber Mann, die Schönste des Landes, nach der du verlangst und dich sehnst, kennst du diese, weißt du wie sie heißt, wo sie herstammt oder hingehört, ob sie von großer oder von kleiner oder von mittlerer Gestalt ist, ob ihre Hautfarbe schwarz oder braun oder gelb ist, in welchem Dorf oder welcher Burg oder welcher Stadt sie zu Hause ist?«; und er gäbe »Nein« zur Antwort. Und man fragte ihn: »Lieber Mann, die du nicht kennst und nicht siehst, nach der verlangst du, sehnst dich nach ihr?«; und er gäbe »Ja« zur Antwort: hätte nun nicht bei solcher Bewandtnis dieser Mann unbegreifliche Antwort gegeben? Ebenso nun aber ist es auch mit jenen Asketen und Priestern, die da über Seele und Welt und deren Beziehungen zueinander sich unterhalten und Aufschlüsse geben, über lauter Dinge, von denen sie nicht die mindeste Kenntnis haben, und deren vermeintliche Wirklichkeit nur ihre eigene, je nach dem Standpunkt verschiedene Neigung und Sehnsucht zur Grundlage hat. Es ist also hier, nebenbei bemerkt, schon von Gotamo dasselbe kaustische Gleichnis angewandt, das bei uns von WIZENMANN aufgestellt wurde, »einem sehr feinen und hellen Kopfe«, wie KANT sagt, der damit »die Befugniß, aus einem Bedürfnisse auf die objective Realität des Gegenstandes desselben zu schließen, bestreitet, und seinen Gegenstand durch das Beispiel eines Verliebten erläutert, der, indem er sich in eine Idee von Schönheit, welche bloß sein Hirngespinst ist, vernarrt hätte, schließen wollte, daß ein solches Object wirklich wo existire.« Kritik der praktischen Vernunft, erster Teil, vorletztes Kapitel »Vom Fürwahrhalten aus einem Bedürfnisse der reinen Vernunft«, zweite Anmerkung. Der Kern dieser Anschauung ist rein abgezogen in dem durchaus richtigen Satze des PROTAGORAS: »Aller Dinge Maß ist der Mensch: der seienden wie sie sind, und der nicht seienden wie sie nicht sind«, so nach PLATONS Theaitetos p. 152-161 und, als hochberühmt, auch von ARISTOTELES und anderen oft wiederholt; er war in volkstümlicher Fassung schon allbekannt seitdem der Chor in der Antigone gesungen, daß nichts mächtigeres lebt als der Mensch. Nb Anm. 379.
877 Asayaṃkāro ca aparaṃkāro ca: adhiccasamuppanno attā ca loko ca mit S. Zur Sache die Darstellung in der I. Rede S. 23; oben Anm. 764. Es gibt im Pāli zwei ganz verschiedene Wörter, die nach den Lautgesetzen dieser Sprache beide zu adhicca geworden sind. Das eine ist das Gerundium oder Partizipium perf. pass. adhītya, adhi + itya, sich einer Sache erinnern, eingedenk sein, sie verstanden haben; wie z.B. Manus III 2 vedān adhītya usw. Zu diesem gehört adhiccasamuppanno, aus dem Denken entsprossen, [867] wie das die I. Rede zeigt. Da wird von einem Asketen gesprochen, der eine geistige Einigung errungen hat, wo er sich an ein angeblich vorweltliches Bewußtwerden erinnert: und daher kommt er dann zu der Ansicht »Aus dem Denken entsprossen ist Seele und Welt.« Die Ansicht wird schon in der sehr alten Saṃnyāsopaniṣat II 4 vorgebracht: »Aus dem Geist entstanden ist der Raum, manasākā aḥ, aus dem Raume der Wind, aus dem Winde das Feuer, aus dem Feuer das Wasser, aus dem Wasser die Erde«; schärfer noch ausgeprägt in der Fassung caitanyād ākā am, »aus dem Denken der Raum« usw., Vedāntasāras 73, und 74: ātmana ākā aḥ saṃbhūta ityādi ruteḥ, »aus der Seele (Selbst, ātmā) ist der Raum entstanden usw. heißt es nach der ruti«, nämlich Taittirīyopaniṣat II I, also einer gleichfalls urvedischen Überlieferung. Damit ist das Dogma jenes Asketen »Aus dem Denken entsprossen ist Seele und Welt« als orthodox brāhmanisch sichergestellt, und wir haben nach der in den Upanischaden immer gern wechselnden Ausdrucksweise in adhītya, manas, caitanyam auch nichts anderes als Synonyme für den einen und selben Begriff »Denken« zu erkennen, wie er eben einmal verbal und ein andermal substantivisch und wieder adjektivisch angewandt wird. Nun gibt es aber noch das andere gleiche Wort, das Adverb adhiccam, a + dhitya, oder vielleicht auch, wie CHILDERS meint, Pāli Dictionary, s.v., von a + dhṛtya: also jedenfalls von dhi oder dhar dhāraṇe mit der Negation. Dieses Wort bedeutet »nicht immer, nicht beständig«, d.i. »nur selten«: so Mittlere Sammlung, S. 479 bei adhiccāpattiko, einer, der sich nur selten vergangen hat, oder auch Saṃyuttakanikāyo III I adhiccadassāvī, einer, der nur selten gesehn hat, V 457 adhiccam idaṃ yaṃ manussattaṃ labhati, nur selten ist es, daß man die Menschheit erlangt. Den einheimischen Erklärern der Texte war das Verhältnis der beiden Wörter durch den lautgesetzlich bedingten Gleichklang verwischt und unverständlich geworden: mit ihren beschränkten philologischen Kenntnissen waren sie außerstande, die durchaus verschiedene Entwicklung und Bedeutung auch nur zu merken. Sie waren daher wie gewöhnlich bald fertig mit der Erklärung und sagten, adhiccasamuppanno sei Gegensatz zu paṭiccasamuppanno: dies die bedingte Entstehung, jenes die unbedingte Entstehung, eine Entstehung aus Zufall. Auch CHILDERS ist dieser falschen Überlieferung gefolgt, nach GOGERLYS Vorgang in dessen Evidences etc., Kolombo 1862, S. 54: »They taught adhiccasamuppannam attānañ ca lokañ ca paññāpenti, that the world and themselves exist without causation.« Wie kindlich und harmlos ein derartiges Gerede war, das hätten sie allerdings, bei einiger Umsicht, schon daraus erschließen können, daß ja ihre Texte für die Ansicht von einer Entstehung aus bloßem Zufall, wie sie von manchen Asketen und Priestern überliefert wurde, ein anderes Wort angeben, einen eigenen bestimmten Begriff dafür haben, nämlich sangatibhāvo, die Fügung des Zufalls, Mittlere Sammlung 788. Doch die Aufmerksamkeit eines Buddhaghoso und der Seinen hat bei schwierigeren Dingen nie ausgereicht; und der greulich verdutzte R. OTTO FRANKE trägt nun deren Floskeln im Korbe BERCHTOLD KHAUDER WALCHS von anno dazumal zu Markte, »Dīghanikāya«, Göttingen 1913, S. 33: »die Samaṇa's und Brahmanen, die die Theorie von der Kausalitätslosigkeit vertreten.« – Im Einklang mit unserem Text oben heißt es im Anguttaranikāyo VI No. 95, daß ein mit der Ansicht des Meisters vertrauter Mensch Wohl und Weh als weder von selbst entstanden noch aus einem anderen entstanden und auch nicht als aus dem Denken entsprungen annehmen kann: und warum nicht? »Weil ja, ihr Mönche, so ein ansichtvertrauter Mensch den Anlaß scharf gesehn hat, und daß die Dinge veranlaßt hervorgehn.« Vollständig ausgeführt ist diese Lehre von der bedingten Entstehung, die Gotamo als erster erkannt und zu Ende gedacht hat, in unserer 14. und 15. Rede; auch Mittlere Sammlung S. 872. usw., Bruchstücke der [868] Reden v. 502. Die feinsten Köpfe unter den Erkenntnistheoretikern unserer Zeit haben sich nach und nach zu demselben Ergebnis herangebildet. Auch sie wollen endlich »ganze Arbeit« tun, den Ursachenbegriff als Erklärungsprinzip aufgeben, ihn nur mehr dem gewöhnlichen Sprachgebrauch des Alltags überlassen, »bis er in fernen Tagen vielleicht einmal der Vergessenheit verfällt«; sie haben gelernt, daß »keine isolierten Faktoren existieren, sondern daß die Dinge kontinuierlich unter einander zusammenhängen«: VERWORN, Kausale und konditionale Weltanschauung, Jena 1912, S. 15-17. Freilich heißt es auch hier mit HIPPOKRATES: ἡ δε κρισις χαλεπη, iudicium difficile, die Entscheidung ist schwer; sicher aber werden wir heute nicht mehr, wie METASTASIO dem Erzbischof von Wien 1755 vorgeschlagen hat, unter das Bild der Philosophie in der Aula der Universität die Inschrift setzen CAVSARVM INVESTIGATIO, sondern vielleicht etwa NEXVVM DISCRIMINATIO. In Indien nun aber war die gotamidische und zugleich modernste Erkenntnislehre (nichts geht vor oder nach, alles steht und fällt miteinander), so heimisch geworden, daß sie schon im alltäglichen Umgang nicht mehr befremdend empfunden wurde: so z.B. wenn der kluge Hanumān überlegt: »Nicht nur eines ist wirksam als Ursache auch des geringsten Geschehnisses hier«, Na hy ekaḥ sādhako hetuḥ svalpasyāpīha karmaṇaḥ, im Sundarakāṇḍam des Rāmāyaṇam, Bombayer Ausgabe 1907 Kap. 41 v. 6 a; ja daß sogar der Lyriker auf Verständnis rechnen konnte, als er das hübsche Gedichtchen in solchem Hinblick aussprach, Daṇḍīs Kāvyādar as II 106:
Du hast mit Lotus dich geschmückt,
Und Amor hat den Pfeil gezückt,
Und ich hab' an den Tod gedacht:
Dreieinig war's zugleich vollbracht.
Daß hier der Dichter, noch etwa tausend Jahre nach Gotamo, wirklich auf die allbekannte buddhistische Lehre Bezug genommen hat, geht klar hervor ebenda III 174; und so auch aus dem verwandten Spruch im Pañcatantram, ed. HERTEL I 208, BÖHTLINGK 22005. Die Logik der Nyāyavai eṣikās, die bei den Buddhisten in die Schule gegangen sind, nennt so eine Ausdrucksweise atide as, eine »Andeutung, daß mehr dahinterliegt«, als wir uns nämlich träumen lassen; sie ist von allgemeiner und von besonderer Art, ein sāmānyātide as und ein vi eṣātide as, erklärt als anyadharmasyānyatra āropaṇam, ein anderes Ding anderswo anfassen.
878 So wird nun der Kreislauf der Wandelwelt, der saṃsāro, angedeutet, das immer wechselnde Werden und Vergehn der Lebenskräfte, von Wohl zu Weh und Weh zu Wohl, die ununterbrochene Reihe von Geburt, Alter und Tod und wieder Geburt, Alter und Tod und so fort: als Weltgesetz der Wiederkehr ausführlich dargestellt in der 14. Rede S. 204f. und oft. Daher kann Gotamo jenen Asketen und Priestern die Behauptung von einer ewigen Seele und Welt usw. nicht zugestehn: und warum nicht? »Wandelbar nur ist ja hier das Bewußtsein bei den mancherlei Wesen, die es gibt.« Man kann von keinem ewigen Substrat oder einer Seele reden, kann nur darauf hinweisen, wie nach dem Wirken des Wesens Wiedersein zustandekommt: »Was einer wirkt läßt ihn wiedersein; wiedergeworden empfangen ihn Empfindungen. Darum aber sag' ich: Erben der Werke sind die Wesen«, Mittlere Sammlung 423. Immer wieder werden sie im Kreislauf umhergetrieben und gehetzt von ihrem unversiegten Durste, »dem Wiederdasein säenden, gnügensgierverbundenen, bald da bald dort sich ergetzenden«, 22. Rede S. 392. Aber unverbrüchliche Satzung ist es, Gesetz wie dem Erwachen des Epimenides vorangestellt:
[869] Den Frieden kann das Wollen nicht bereiten:
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Der Weltkreis ruht von Ungeheuern trächtig,
Und der Geburten zahlenlose Plage
Droht jeden Tag als mit dem jüngsten Tage.
Das ist die Wandelwelt und ihre unermeßliche Vielheit auf- und abkreisender Erscheinungen, je nach der immer selbstgeschaffenen und wieder wechselnden Eigenart, in der bedingten Entstehung gegründet. Die Frage ›wer dürstet, wer hangt an‹ usw., die einmal ein Jünger an den Meister richtet, Saṃyuttakanikāyo ed. Siam. vol. II p. 13 (PTS 13 falsch tuṇhīyati für taṇhīyati mit S etc.), eine solche Fragestellung, lehrt Gotamo, ist nicht die rechte. »›Man dürstet‹, so sage ich nicht. Wenn ich sagen würde ›man dürstet‹, dann wäre die Frage berechtigt: ›Wer ist es denn, der dürstet?‹« Und Gotamo erklärt nun ausdrücklich, so nicht zu reden, sondern zu sagen: »durch Gefühl bedingt ist Durst, durch Durst bedingt Anhangen« usw., und damit ist der Paralogismus der Personalität erledigt. KANT hat diese richtige Einsicht von HUME übernommen und umständlich bis zur feinsten Unterschiedlichkeit nachgewiesen, und LICHTENBERG hat dann das Verhältnis, in einer seiner Bemerkungen, kurz und gut so bestimmt: »Wir kennen nur allein die Existenz unserer Empfindungen, Vorstellungen und Gedanken. Es denkt, sollte man sagen, so wie man sagt: es blitzt. Zu sagen cogito, ist schon zu viel, sobald man es durch Ich denke übersetzt. Das Ich anzunehmen, zu postuliren, ist praktisches Bedürfniß.« Darum hatte er vorher schon gesagt: »Eine der seltsamsten Wortverbindungen, deren die menschliche Sprache fähig ist, ist wol die: Wenn man nicht geboren wird, so ist man von allen Leiden frei.« Wir haben also hier eine Übereinstimmung der scharfsinnigsten Denker mit den letzten Ergebnissen der Schule MACHS: daß nur ein »es« ist, das jeden Augenblick entsteht und vergeht, überall wieder: »daz vil lebeliche leit« nennt es großartig GOTTFRIED, Tristan v. 1731, und BYRON in der Euthanasia »life and living woe.« ›Es ist‹ und ›Es ist nicht‹: das sind die zwei Enden, die Gegenpole, um die sich alles dreht, wo bald der eine bald der andere zu gelten scheint, je nach dem Standpunkt im Kreislauf ohne Anfang und Ende. Und das ist der saṃsāro oder die Wandelwelt, die auch LUKREZ im immer erneuten Schwunge gemeinsam wechselnder Wiederkehr gesehn hat, II 75:
Sic rerum summa novatur
Semper, et inter se mortales mutua vivunt.
Verdeutscht und vertieft durch den Dichter, der nichts von dem allen gehört und es einzig in sich erfahren hat:
So dreht die Welt sich immer fort
Und bleibt doch stets an einem Ort.
Der Egoismus ist die Achse –
diese Erkenntnis, eine Offenbarung aller Weltkunde, geht nämlich dem Rappelkopf auf, in RAIMUNDS Alpenkönig III 20. Aber als Achse mitten durch die beiden Weltangeln hindurch, an denen das immer neugebildete mixtum compositum ›Mensch‹ zumeist hängen bleibt im fließenden Hin- und Herzucken, zeigt die Satzung des Vollendeten den Ausgang an, Saṃyuttakanikāyo ed. Siam. vol. II p. 16f. = III 121 (PTS 17, [870] 135: tassa für tañcāyam varia lectio S): »Anhänglich anhangen, sich anschmiegen ist die feste Fessel dieser Welt gemeinhin. Aber so ein anhänglich Anhangen, geistiges Anlehnen, anschmiegendes Angewöhnen betreibt man nicht, man hangt nicht an, lehnt sich nicht an, als ob man ein Selbst hätte. Leiden nur entsteht und entwickelt sich, Leiden vergeht und löst sich auf: das ist einem unfraglich, unbezweifelbar geworden; ohne sich auf andere berufen zu müssen hat man eben dabei Gewißheit erlangt. Insofern kommt die rechte Erkenntnis zustande.« – Wie diese Ansicht zur Zeit Gotamos schon mehr und mehr eine allgemein volkstümliche Geltung erlangt hatte, zeigt sich sehr anschaulich bald nach Beginn unserer zweiten Rede, S. 43f. Irgendein Mensch, dem es weder zu gut noch zu schlecht geht, wie er gerade als Bürger oder Bauer lebt, sieht den König in all seiner Herrscherpracht vorüberziehn, und es kommt ihm dabei der Gedanke: »Ach wie erstaunlich, wie doch so wunderbar ist der Verdienste Wandel, der Verdienste Vergeltung! Dieser König von Magadhā ist nur ein Mensch, und auch ich bin ein Mensch. Aber dieser König von Magadhā wird mit dem Gebrauch und Genuß der fünf Begehrungen bedient fast wie ein Gott: ich dagegen bin sein Knecht und Diener, der vor ihm aufsteht und nach ihm sich hinlegt, auf seine Befehle horcht, immer entgegenkommt, freundlich redet, jede Miene erspäht. So will denn auch ich wie er Verdienste erwerben.« Und er faßt den Entschluß heilsam zu wirken, Verdienste zu sammeln, zu künftigem besseren Dasein, wie eben auch der König, jetzt so mächtig, nur durch vormals gepflegten verdienstlichen Wandel, als Erbe seiner Werke, nun die Vergeltung sichtbar verkörpert. Eine solche Gedankenrichtung, in Indien, wie bekannt, längst volkstümlich geworden, ist aber auch bei uns ab und zu, bei tiefer beanlagten Menschen, aufzuspüren. Einen kostbaren Beleg hiefür enthält der Brief von ROBERT BURNS an Mrs. DUNLOP, vom 4. März 1789, wo er schreibt: »When I must skulk into a corner, less the rattling equipage of some gaping blockhead should mangle me in the mire, I am tempted to exclaim – ›What merits has he had, or what demerit have I had, in some state of preexistence, that he is ushered into this state of being with the sceptre of rule, and the key of riches, in his puny fist, and I am kicked into the world, the sport of folly or the victim of pride?‹« Nach Form und Inhalt ein nordwestliches Gegenstück zu jenem indischen Bauer vor dem König von Magadhā, und Mitbezeugnis der Wandelbarkeit des Bewußtseins bei den mancherlei Wesen, die es gibt. Vollkommen gleicher Art ist auch das Wort jenes Philosophen, von dem GRACIAN berichtet, der auf die Frage, was unser Leben sei, geantwortet hat: una buelta al rededor del corro, ein Wandel rings um den Kreis, Agudeza y Arte de Ingenio, Discurso XLI vorletzter Absatz. GRACIAN nennt keinen Namen, der Ausspruch weist aber auf den Pythagoreer OKELLOS hin, den Lukanier, der in seinem Werk »Über die Natur des Alls«, das zweite Kapitel so abschließt; s. Anm. 996 Mitte. Reichlicher wiedergegeben, fast im indischen Inbegriff dieser Lehre, ist es in einem Orphischen Bruchstück, das uns CLEMENS ALEXANDRINUS im fünften Buche der Stromata erhalten hat, Kölner Ausgabe 1688 fol. 568 (cf. LOBECK, Aglaoph. II 836):
Ουδεν εχει μιαν αισαν επι χϑονος, αλλα κυκλειται
παντα περιξ; στηναι δε καϑ' ἐν μερος ου ϑεμις εστιν,
αλλ' εχει, ὡς ηρξαντο, δρομου μερος ισον εκαστος.
Nichts hat ein einziges Loos nur auf Erden, sondern es dreht sich
Alles herum: Verweilen an einem Ort weigert die Satzung,
Recht aber trifft nach dem Antritt den Ort, der ihm zukreist, ein jeder.
[871] Über das Alter und die Verbreitung dieser Lehre hat vor SCHOPENHAUER (Hauptwerk II 576f.) niemand so treffend geurteilt wie THOMAS BURNET, der hochgelehrte Freund König KARLS II von England. Er nennt sie eine Doctrina pervetusta et universalis: »Haec, inquam, doctrina, quasi coelo demissa, απατωρ, αμητωρ, αγενεαλογητος, totum terrarum orbem pervagata est«, Archaeologiae philosophicae lib. I cap. 14 p. 447. War doch ihre Verbreitung eine Mitfreude PINDARS, der sie begeistert vor allem Volke vorgetragen hat, zu Beginn der 4. Antistrophe der 2. Olympionike. DE CHAUFEPIÉ hat im Supplementfolio II zu BAYLES Dictionaire historique et critique, Amsterdam 1750, s.v. H p. 7, noch andere, sehr lehrreiche Vergleiche herangezogen. Man kann ihnen epodisch die Apologie des Phönix anreihen, der nach dem Zeugnis VOLTAIRES zur Prinzessin von Babylon also gesprochen hat: »La résurrection, madame, lui dit le phénix, est la chose du monde la plus simple. Il n'est pas plus surprenant de naître deux fois qu'une. Tout est résurrection dans ce monde; les chenilles ressuscitent en papillons; un noyan mis en terre ressuscite en arbre; tous les animaux ensevelis dans la terre ressuscitent en herbes, en plantes, et nourrissent d'autres animaux dont ils sont bientôt une partie de la substance; toutes les particules qui composaient les corps sont changées en différens êtres.«
879 S richtig kiṃ vo ahan te tathā vyākarissāmi. – Derlei Ansichten etwa noch weiterzuerklären wäre, nach Gotamos Begriffen, ein eitles Bemühn. Das ist Sache der lokāyatās oder sogenannten Weltweisen. Siehe Anm. 233. Denn wer sich mit Scheinauskünften so willkürlich beschäftigen mag, aus aufgeblasener Gedankenspielerei eine Weltkunde zu entwickeln vermeint, gleicht ja doch nur jener bekannten Fliege auf der Deichsel des dahinsausenden Wagens, die sich freut, wieviel Staub sie aufwirbeln kann. Oder auswärts gedreht: du willst das Raunen und Flüstern der Natur, den Gesang der Zikade begreifen und hast sie am Flügel angepackt, τεττιγα του πτερου συνειληφας, wie ARCHILOCHOS fein sagte. Dabei kommt es wohl zu einer Entomologie aber zu keiner Entonologie. Schön auch versinnlicht in dem Bilde, das Hyperion, der Eremit von Griechenland, gibt, II 2 gegen Ende, wo er die Nacht und Öde des Lebens betrachtet, die ganze dürftige Sterblichkeit. Freilich, sagt er, ist das Leben arm und einsam. Wir wohnen hier unten, wie der Diamant im Schacht. Wir fragen umsonst, wie wir herab gekommen, um wieder den Weg hinauf zu finden. HÖLDERLIN hat da gleichsam nach der Tiefe beeinblickt was PLATON im Bildnis der Höhle nach oben entwirft, Rep. p. 514ff.: wir sehn, von Kindheit an da unten gefesselt in einer Finsternis, durch die von rückwärts ein Lichtstrahl empordringt, an der Felsenwand gegenüber nur den Schatten, den eigenen wie den der anderen Wesen und Dinge, vorbeiziehn: und die Folge dieser wandelnden Schattenbilder des Lebens dünkt uns die rechte Erkenntnis. Von ebendiesem berühmten Gleichnisse hat aber SHAKESPEARE vielleicht mittelbar Kunde gehabt, da er es gegen Ende des Macbeth wundervoll knapp in den Stempel prägt: Life 's but a walking shadow. Möglich auch, daß da der Brite vom Griechen ganz unabhängig ist und es frei in sich gefunden hat; gleichwie z.B. der ahnende Schimmer, der als Frage und Beschwichtigung im Abgesang der Neunten Symphonie beim letzten Millionensturz über allen Himmelskreisen verschwebt, der dreifache Widerhall der fünf Takte beim Entschwinden des überirdischen Gastes am Ende des Don Juan ist: wer aber mag etwa hier, bei allerseltsamster und reinster Übereinstimmung, an Entlehnen oder Anlehnen denken? Jenes höchste Tongeheimnis war doch wohl dem einen wie dem anderen Meister genau im gleichen Klange offenbar geworden.
Bei der sogenannten Entzifferung der Welt nun heißt es immerdar:
[872] Geheimnisvoll am lichten Tag
Läßt sich Natur des Schleiers nicht berauben,
Und was sie deinem Geist nicht offenbaren mag,
Das zwingst du ihr nicht ab mit Hebeln und mit Schrauben.
Was also hätte ein Mann wie Gotamo jenen Asketen und Priestern dort »noch weiter erklären« sollen? Es war ihnen der Weg zu zeigen gewesen, der aus dem Dickicht der Ansichten in die Freiheit führt. Dieser Hinweis auf die gerade Spur kann aber jedem genügen, wenn er sich nur ernstlich besinnen und sammeln will. So gewiesen ändert er dann seine Schritte, übt ihre Lenkung, wird fähig eine Kraft zu entwickeln, deren er sich vorher gar nicht bewußt war. Er kann nun den Weg wohl unterscheiden, wählen und richten. So hat er dem Augenblick, der ihm gewährt war, das Rechte abgewonnen, hat ihm Dauer verliehn, hat nur allein als Mensch das Unmögliche zu verwirklichen gelernt. Das steht nicht nur geschrieben im Gesang vom Göttlichen, das ist göttlich bewährt im Leben SEUSES, Kapitel 35: »Einem solchen inbrünstigen Menschen werden alle unmöglichen Dinge möglich zu vollbringen.« Es ist das Wunder der Belehrung, das sich bei eigener Mitarbeit ereignen kann, und anders nicht. Darum sagt KANT: »Ich kann niemand besser machen als durch den Rest des Guten, das in ihm ist; ich kann niemand klüger machen als durch den Rest der Klugheit, die in ihm ist«, Sämtl. Werke, ed. ROSENKR. XI I 235. Das auch ist es, im Grunde genommen, Verständigen verständlich, was VOLTAIRE gemeint hat, am Ende des Briefes an seinen vertrauten D'ALEMBERT vom 15. Dezember 1763, und wiederholt: »Soyez toujours tendrement unis dans la communion des gens de bien; lisons bien la sainte Ecriture, et écr(asons) l'inf(âme)«: womit er nur auf die kürzeste Formel gebracht, was sechs Jahrhunderte vorher ein AMALRICH VON BENA und DAVID VON DINANT schon empfohlen hatten. Wie von verschiedenfarbigen Kühen die Milch auf nur eine Farbe hinauskommt, so sieht man das Wissen von verschiedenartigen Kennern eben auch nur auf eines hinauskommen, sagt die ruti, v. 19 der Amṛtabindu-sowie der Brahmabindūpaniṣat.
880 Der Fuß des idealen Menschen wird hier als muschelwölbig am Rist gekennzeichnet, ussankhapādo hoti. Damit scheint mir dieses Merkmal besser veranschaulicht als durch den in der Smṛti gern gebrauchten Vergleich »wie der Rücken einer Schildkröte emporgewölbt sind die Füße«, kūrmapṛṣṭhonnatau pādau, wie Mahābhāratam III 5, 12. Unser Text gibt wahrscheinlich eine ältere Ansicht wieder: denn späterhin findet man nur mehr das Bild aus der allgemein indischen Physiognomik angeführt, auch in dem sonst so reichen und vielseitigen Citralakṣaṇam, das uns in der sehr genauen tibetischen Übersetzung erhalten ist. Dieses alte Handbuch des indischen Malers hat an der entsprechenden Stelle nur die Bemerkung: die Füße sind »hoch wie der Rücken einer Schildkröte«: nach LAUFERS Ausgabe, tibetisch und deutsch, Leipzig 1913, S. 161. Die anderen oben angegebenen Merkmale eines großen Mannes sind nach ihren verschiedenen Beziehungen hin untersucht in der Mittleren Sammlung Anm. 242-249, und oben Anm. 301-303. Der seltene Fall, daß ein Herrscher, der damit begabt ist, namentlich angeführt wird, findet sich im 17. Divyāvadānam p. 210: es ist der Erd- und Himmeleroberer Māndhātā. Später hat noch im Bhāgavatapurāṇam V 15, 5 König Gayas als rājarṣis die Würde eines mahāpuruṣas erlangt, und nach dem 69. Kapitel der Bṛhatsaṃhitā kam der Titel auch einer Anzahl anderer Herrscher zu. In der Paramahaṃsopaniṣat, I Mitte, ist er eine Bezeichnung für den vollkommenen Asketen, und aṃkarānandas als Erklärer bemerkt dazu: paripūrṇaḥ puruṣo mahāpuruṣaḥ, »der ausgereifte Mann ist der große Mann«.
[873] 881 Mit S etc. immer upapajjati.
882 Vergl. Bruchstücke der Reden v. 188. Mit S, M etc. richtig samantam ācari.
883 Das lustige Wohlsein im lichten Kreis ist S. 16 dargestellt. – Es ist natürlich vasundharaṃ zu lesen, S basundharaṃ.
884 Auch mit S etc. pabbajitassa vā pana.
885 Mit S, M etc. parābhibhū, sattubhi nappamaddano; dann manussabhūten' idha natthi kenaci akkhambhiyo.
886 Vergl. Bruchstücke der Reden No. 37, v. 690; auch den Typus in der 14. Rede der Längeren Sammlung.
887 Zu sattussado cf. Mittlere Sammlung Anm. 246; das sattussadā honti ist Glosse.
888 Der Wonnehain, oder Wonnige Wald der Götter, Nandavanam, Nandanaṃ vanam, ist in der Welt der Dreiunddreißig gelegen: Mittlere Sammlung S. 540. Er wird auch Garten der weißen Lotusblüte genannt, Ekapuṇḍarīkam uyyānam, ib. 281. Die Götter der Dreiunddreißig und ihr Oberherr Sakko pflegen dort zusammenzukommen um einer fünfhundertstimmigen Himmelsmusik als höchstem Genusse zu lauschen. Dieser Umstand ist auch der Smṛti wohlbekannt: im Mahābhāratam heißt der Ort divyaṃ vanaṃ divyagītavināditam, himmlischer Hain, wo himmlische Sangesweisen ertönen, akrasya dayitāṃ purīm, Sakkos geliebte Stätte, z.B. im Indralokāgamanam II 7. Ins himmlische Reich jener Klänge hinzugelangen, die von aller Erdenschwere befreien, soll, wie man meint, eine namenlose Freude sein. Sommerwonne des Herzens, sagt SEUSE, bei dergleichen Sphärenkonzerten gern zu Gast. – Über die Dreiunddreißig Götter und ihre Potenzen sind in Anm. 581 und in den Bruchstücken der Reden Anm. 679, 2. Absatz reiche Aufschlüsse zu finden. Hier sei nur kurz bemerkt, daß die »Dreiunddreißig« bereits in der Ṛksaṃhitā als Summe der weltlichen Götter genannt werden, IX 92, 4: vi ve devās: traya ekāda āsaḥ, »alle Götter: die Dreimalelf«. Diese Zahl ist aber auch uns, von Indien und Persien her, als die höchste himmlische Summe überkommen: bei KALLIPPOS sind es die 33 planetarischen Sphärenträger, bei den Gnostikern die 33 Geisteräonen; in der Philosophischen Kugel JAKOB BÖHMES ist 33 Gott schlechthin, vielleicht infolge sibyllinischer Vermittlung. Denn wir wissen, daß nach der Schlacht am Trasimenischen See, zur Sühnung der Niederlage, aus den Sibyllinischen Büchern ein Ver sacrum votiert wurde, bei dem der Aufwand für die großen circensischen Spiele zu Ehren der Götter derart erhöht war, daß die Summe geheimnisvoll im Zeichen der 33 stand: Eiusdem rei causa ludi magni voti aeris trecentis triginta tribus millibus, trecentis triginta tribus, triente: LIVIUS XXII 10. Aber die Zahl war auch als der Inbegriff aller irdischen Fülle angesehn worden, da es, sicher nach alter Überlieferung, in der Kûdrûn v. 1507 heißt:
Daz tuon ich harte gerne, sprach Ortûn daz kint.
Mit drî und drîzic meiden ernerte si si sint.
Auch folgender Umstand weist auf die irdische Fülle der 33 hin. Als MICHELANGELO einmal Birnen einer besonders erlesenen Sorte aus Florenz nach Rom zugesandt bekam, schrieb er dem Spender: »Ich habe den Korb mit den Birnen erhalten, es waren sechsundachtzig; schicke davon dreiunddreißig dem Papst, sie deuchten ihm schön und er hatte sie recht gern«, Brief vom 2. Mai 1548 an LIONARDO DI BUONARROTO. Zugleich mag hier freilich die christlich-gnostische 33 das Irdische überirdisch mit symbolisieren. Romanische Dichter, Troubadoure, Novellisten usw. haben die Schönheit der Helena und dann der idealen Frau überhaupt in ein versifiziertes Schema von 33 Bestimmungen gebracht, nach BRANTOME, Dames Galantes II 330. Sie werden[874] einzeln erörtert, z.B. in der Sylva nuptialis des NEVIZANUS, und noch im 17. Jahrhundert von BALTASAR DE VICTORIA, obzwar nicht mehr diplomatisch genau, nur summarisch, wie man dergleichen gelegentlich auch in Indien zu tun pflegte, nach der Zehnerreihe gezählt als »las treynta cosas que se requieren para que una muger sea perfectissima en su hermosura«, cf. BAYLE, Dictionaire historique et critique, ed. Amsterdam 1740 II s.v. Helene fol. 701 B. Dieser romanischen und romantischen Ritterfährte ist offenbar WIELAND gefolgt, da er im Oberon VI 39 zutreffend spricht:
Von allen drey und dreißig Stücken,
Womit ein schönes Weib, sagt man, versehen ist.
Weiter sodann: Schweizer, in SCHILLERS Räubern, redet latomisch-zigeunerisch von den angezündeten 33 Ecken der Stadt, und ABRAHAM A SANCTA CLARA von den 33 tausend Menschen, die anno 1489 zu Brüssel an der Pest gestorben, Omnes morimur II i.f.; dreimal nacheinander aber um zu 99 zu gelangen zählt der glänzendste Kenner west-östlicher Sitte und Eigenart bei uns im 18. Jahrhundert, VOLTAIRE, in seiner »histoire orientale« die »trente-trois petits bossus des plus vilains qu'il put trouver, trente-trois pages des plus beaux, et trente-trois bonzes des plus éloquens et des plus robustes«, Zadig, chap. 15; und im letzten Jahrhundert scheint noch BYRON der alten Überlieferung mitzugedenken, als er am 22. Januar 1821 in sein Tagebuch einträgt:
Through life's dull road, so dim and dirty,
I have dragg'd to three and thirty.
What have these years left to me?
Nothing – except thirty-three.
All dies kann nicht willkürlich gewählt zusammentreffen: es weist vielmehr auf einen fern zurückliegenden gemeinsamen Zahlenbegriff 33 hin.
889 khajjabhojanarasalābhitāya S richtig.
890 Ist da nicht auch an den Lebensgang und das Lebenswerk des Generals der Heilsarmee, WILLIAM BOOTH, als an eine verwandte Erscheinung zu erinnern? War nicht auch dieser große faustische Geist von dem Gedanken und der Leidenschaft ergriffen und durchdrungen, der Erde krasses Los mindern zu müssen? Vielen Millionen neue Lebensräume zu eröffnen, »nicht sicher zwar, doch tätig-frei zu wohnen.« Auch er, recht gut vertraut mit SCHILLERS Zeuswort »Glücklich soll niemand sein«, hatte doch nicht auf der Phrase vom allgemeinen Los behaglich ausruhn mögen, hatte vielmehr bis zu seinem Tode im höchsten Greisenalter unermüdlich geschaffen, ganz wie es oben in unserer Strophe so schön ausgesprochen ist, wobei er Tag um Tag jene Erkenntnis immer reiner zu entwickeln verstand, an die einst der indische Herrscher erinnert wurde, Mahābhāratam XII 3893:
Auch andern schwinden Freunde weg,
Und Geld und Güter sind dahin:
Sieh', König, als der Menschen Los
Die Not an, die du selbst erfährst.
Über solches gemeinsame Wirken wäre denn die Inschrift zu setzen, mit der BYRON die Faulbettphrase vom »Common Lot« unvergeßbar widerlegt hat:
[875] Then do not say the common lot
Of all lies deep in Lethe's wave;
Some few who ne'er will be forgot
Shall burst the bondage of the grave.
Vielleicht kann man hiervon auch sagen, es sei praktisch bewährtes Christentum: wenn man nämlich so köstliche Früchte einer Lehre zueignen darf, die doch im übrigen nur als der eine große Fluch der Menschheit mit NIETZSCHE recht zu kennzeichnen ist; bei der das vergleichende Urteil VOLTAIRES vollkommen zutrifft: »les peuples chrétiens n'ont jamais observé leur religion, et les anciennes castes indiennes ont toujours pratiqué la leur«; die, was die Zumutungen an das Denkvermögen anlangt, einen »Gipfel von Blödsinn und Tollheit« erreicht hat, nach FRIEDRICHS des Großen Ausdruck in einem Briefe von 1776 – »le comble de la folie et de la démence« – der auch die wüstesten Ausschweifungen von Zulus und Eskimos unter sich läßt, und über den SCHOPEN HAUER, gegen Ende seines Lebens, das bitter ehrliche »Gespräch von Anno 33« gesetzt hat: »A. Wissen Sie schon das Neueste? B. Nein, was ist passiert? A. Die Welt ist erlöst! B. Was Sie sagen! A. Ja, der liebe Gott hat Menschengestalt angenommen und sich in Jerusalem hinrichten lassen: dadurch ist nun die Welt erlöst und der Teufel geprellt. B. Ei, das ist ja ganz scharmant.« Neue Paralipomena § 447. So tief herab reißt das dogmatisch verzerrte Christentum; während es doch anderseits auch wieder gar manche herrliche Herzenskämpfer und Überwinder gezeitigt, zu jenen Erlebnissen emporgeleitet hat, die der Künstler als das unermeßliche Weh der Welt wie eine Offenbarung kennen lehrt: in hoher Wahrheit versinnlicht z.B. im erstarrten tränenlosen Antlitz der holzgeschnitzten Maria an der Seite des Gekreuzigten über dem Lettner im Dom zu Halberstadt; oder als Jammerbild des Lebens im Ecce homo CORREGGIOS in London, und dagegen als Ausdruck unbeugsamer Kraft, heiterer Siegeszuversicht des Menschen auf desselben Meisters Dorngekrönten in Wien.
891 Die Ausführung in der 5. Rede S. 94f., bei der Darbringung eines großen Opfers ohne Reuegedanken; unser assajji entspricht dem avippaṭisāro dort.
892 Ubbham uppatitalomavā sa so mit S, und dann am besten tacotthaṭā.
893 Zu sukhudrayaṃ cf. Anm. 622.
894 Mit S hāsapañño, wie an der gleichen Stelle zu Beginn der III. Rede der Mittleren Sammlung.
895 Daß hier atthakathā so viel ist als bhāsitassa attho, zeigt v. 374 der Lieder der Mönche, wo auch der atthantaro dargestellt ist wie oben.
896 apabbajjam, icchaṃ zu lesen; die Handschriften haben natürlich apabbajjamicchaṃ, desgleichen in der vorangehenden Strophe dibbamupapajji, wo S dibba mupapajji abteilt, nur aus graphischer Bequemlichkeit. – Diesem Abschnitt, der die Überwindung von Ärger, Zorn, Haß und Verdrossenheit behandelt, kann zum feineren psychologischen Verständnisse die Diatribe aus dem Anguttaranikāyo, Sattakanipāto Nr. 64 (PTS Nr. 60) gegenübergestellt werden. »Sieben Dinge gibt es, ihr Mönche«, sagt da Gotamo, »bei Feinden beliebt, bei Feinden geübt, die dem Zornigen zukommen, dem Weibe gleichwie dem Manne: und was für sieben Dinge? Da mag, ihr Mönche, ein Feind dem Feinde solches wünschen: ›Ach daß er doch häßlich wäre!‹ Und warum das? Weil sich, ihr Mönche, der Feind über des Feindes Schönheit nicht freut. Zornig ist er da, ihr Mönche, der Mensch, von Zorn überwältigt, vom Zorne verzehrt; und ist er auch wohlgebadet, wohlgesalbt, mit gepflegtem Haar und Barte, in weiße Gewänder gehüllt, so bleibt er dennoch häßlich, als ein Zornverzehrter. Das ist, ihr Mönche, das erste Ding, bei Feinden beliebt, bei Feinden geübt, das dem Zornigen zukommt,[876] dem Weibe gleichwie dem Manne. Weiter sodann, ihr Mönche, mag ein Feind dem Feinde solches wünschen: ›Ach daß es ihm doch übel erginge!‹ Und warum das? Weil sich, ihr Mönche, der Feind über des Feindes Wohlergehn nicht freut. Zornig ist er da, ihr Mönche, der Mensch, von Zorn überwältigt, vom Zorne verzehrt; und hat er sich auch auf ein Ruhebett gelagert, das mit Decken bespreitet ist, mit Batist überzogen, mit Schleiern überspannt, mit Antilopenfellen als bester Unterlage, oben mit Federkissen, an beiden Enden rot aufgepolstert, so fühlt er sich dennoch nicht wohl, als ein Zornverzehrter. Das ist, ihr Mönche, das zweite Ding, bei Feinden beliebt, bei Feinden geübt, das dem Zornigen zukommt, dem Weibe gleichwie dem Manne. Weiter sodann, ihr Mönche, mag ein Feind dem Feinde solches wünschen: ›Ach daß er doch nicht genug hätte!‹ Und warum das? Weil sich, ihr Mönche, der Feind über des Feindes Genughaben nicht freut. Zornig ist er da, ihr Mönche, der Mensch, von Zorn überwältigt, vom Zorne verzehrt; und hat er auch Schlechtes erlangt, so vermeint er ›Gutes hab' ich erlangt‹, und hat er auch Gutes erlangt, so vermeint er ›Schlechtes hab' ich er langt‹: weil er nun diese Dinge zu gegenseitigem Schaden erworben hat, gereichen sie ihm langehin zu Unheil und Leiden, als einem Zornverzehrten. Das ist, ihr Mönche, das dritte Ding, bei Feinden beliebt, bei Feinden geübt, das dem Zornigen zukommt, dem Weibe gleichwie dem Manne. Weiter sodann, ihr Mönche, mag ein Feind dem Feinde solches wünschen: ›Ach daß er doch kein Vermögen hätte!‹ Und warum das? Weil sich, ihr Mönche, der Feind über des Feindes Vermögen nicht freut. Zornig ist er da, ihr Mönche, der Mensch, von Zorn überwältigt, vom Zorne verzehrt; und wenn er auch ein Vermögen besitzt, das er durch Emsigkeit und Anstrengung zusammengebracht, mit der Arbeit seiner Hände aufgehäuft hat, das von seinem Schweiße beträufelt, auf richtige Weise, rechtlich erworben ist, so wird es etwa von Königen der königlichen Schatzkammer zugeführt, bei dem Zornverzehrten. Das ist, ihr Mönche, das vierte Ding, bei Feinden beliebt, bei Feinden geübt, das dem Zornigen zukommt, dem Weibe gleichwie dem Manne. Weiter sodann, ihr Mönche, mag ein Feind dem Feinde solches wünschen: ›Ach daß er doch unbekannt bliebe!‹ Und warum das? Weil sich, ihr Mönche, der Feind über des Feindes Ruhm nicht freut. Zornig ist er da, ihr Mönche, der Mensch, von Zorn überwältigt, vom Zorne verzehrt; und wenn er auch Ruhm erlangt hat, durch unermüdliche Mühe, so stürzt er doch noch herab, als ein Zornverzehrter. Das ist, ihr Mönche, das fünfte Ding, bei Feinden beliebt, bei Feinden geübt, das dem Zornigen zukommt, dem Weibe gleich wie dem Manne. Weiter sodann, ihr Mönche, mag ein Feind dem Feinde solches wünschen: ›Ach daß er doch keine Freunde hätte!‹ Und warum das? Weil sich, ihr Mönche, der Feind über des Feindes Befreundung nicht freut. Zornig ist er da, ihr Mönche, der Mensch, von Zorn überwältigt, vom Zorne verzehrt; und wenn er auch Freunde und Genossen, Verwandte und Sippen hat, so weichen schon diese von fern ihm aus, als einem Zornverzehrten. Das ist, ihr Mönche, das sechste Ding, bei Feinden beliebt, bei Feinden geübt, das dem Zornigen zukommt, dem Weibe gleichwie dem Manne. Weiter sodann, ihr Mönche, mag ein Feind dem Feinde solches wünschen: ›Ach daß er doch bei der Auflösung des Körpers, nach dem Tode, abwärts, auf üble Fährte, zur Tiefe hinab, zur Einkehr in höllische Welt geriete!‹ Und warum das? Weil sich, ihr Mönche, der Feind über des Feindes gute Hinkunft nicht freut. Zornig ist er da, ihr Mönche, der Mensch, von Zorn überwältigt, vom Zorne verzehrt; er wandelt übel in Werken, übel in Worten, übel in Gedanken: und ist er in Werken, Worten und Gedanken übel gewandelt, so gelangt er bei der Auflösung des Körpers, nach dem Tode, auf den Abweg, auf üble Fährte, zur Tiefe [877] hinab, zur Einkehr in höllische Welt, als ein Zornverzehrter. Das ist, ihr Mönche, das siebente Ding, bei Feinden beliebt, bei Feinden geübt, das dem Zornigen zukommt, dem Weibe gleichwie dem Manne. Das sind, ihr Mönche, sieben Dinge, bei Feinden beliebt, bei Feinden geübt, die dem Zornigen zukommen, dem Weibe gleichwie dem Manne.« Wie aber dem Zorne beizukommen sei, das wird in einer recht eigenartigen Parabel im Saṃyuttakanikāyo verdeutlicht, gegen Ende des ersten Bandes. Es war einmal ein gewisser Dämon, häßlich, von kleiner Gestalt: der hatte auf dem Throne Sakkos, des Götterherrn, Platz genommen. Da sind denn die Götter der Dreiunddreißig ärgerlich, unwillig, ungehalten geworden: »Unglaublich ist es, unerhört ist es! Dieser häßliche, winzige Geist hat auf dem Throne Sakkos des Götterherrn Platz genommen!« Je mehr und mehr aber die Götter der Dreiunddreißig ärgerlich, unwillig, ungehalten wurden, desto mehr und mehr nahm jener Geist an Schönheit zu, wurde immer ansehnlicher und anmutiger. Da suchten nun die Götter der Dreiunddreißig Sakko den Götterherrn auf, erzählten ihm den Vorgang und sagten: »Das scheint ja, o Würdiger, ein zornfressender Geist zu sein.« Sakko der Götterherr aber ist zu jenem zornfressenden Geiste herangetreten, hat die eine Schulter entblößt, das rechte Knie zu Boden gebeugt, die Hände gegen ihn gefaltet und dreimal sich mit Namen genannt: »Sakko bin ich, o Würdiger, der Götterherr, Sakko bin ich, o Würdiger, der Götterherr, Sakko bin ich, o Würdiger, der Götterherr.« Wie da nun Sakko der Götterherr seinen Namen so nannte, wurde jener Geist immer häßlicher, immer kleiner: immer häßlicher, immer kleiner geworden war er dann plötzlich verschwunden. Alsbald hat nun Sakko der Götterherr auf seinem Throne Platz genommen; und den Göttern der Dreiunddreißig freundlich zuwinkend hat er dazumal diesen Gesang verlauten lassen:
»Es ist der Sinn mir unvertrübt,
Von keinem Wirbel aufgewühlt;
Ein langes Zürnen kenn' ich nicht,
Der Zorn hat keine Macht an mir.
Ist einer zornig, bin ich sanft,
Vom Rechten fehlgehn sei mir fern;
Ich halte selbst mich wohlgefaßt,
Verstehe was mir Heil erwirkt.«
Jener Unhold wächst also durch den Zorn anderer, der seine Nahrung ist, und er schwindet bei Milde, da diese ihm nicht bekommt. Eine verwandte Legende vom Dämon Vepaciti, aus dem vierten Bande des Saṃyuttakanikāyo, ist zu v. 588 der Bruchstücke der Reden mitgeteilt. Vergl. noch das feinsinnige Gegenstück von Asito Devalo, Mittlere Sammlung 715; auch Lieder der Mönche v. 441-446. – All diese Ausführungen und Geschichten, die die Überwindung von Ärger, Zorn, Haß und Verdrossenheit behandeln, sind immer eine Permutation der Antigone: Nicht mitzuhassen, mitzulieben bin ich da. Auch sind sie reichlich, wie man sieht, von einer heiteren diogeneischen Abendröte vergoldet, die weit über die pechschwarze timonische Nacht hinausstrahlt. Denn wenn TIMON der Menschenhasser war und am liebsten die ganze Welt vernichten wollte – und was man haßt, nimmt man sich zu Herzen – hatte sich DIOGENES von der gänzlichen Nichtigkeit der Gefühlsaufwallungen so überzeugt, daß ihn, wie Sakko den Götterherrn, keinerlei Wut und Verstörung je wieder ankommen und erschüttern konnte: wir waren ihm zu unbedeutend geworden, so zum Guten wie zum Schlechten, MONTAIGNE, Essais I No. 50. So Ärger und Zorn, Haß[878] und Verdrossenheit überwunden, ausgeglichen zu haben, kommt auch gar herrlich zur Anschauung bei dem selbsterlebten und durchlebten Gleichnisse, das uns SEUSE sechsmal, am besten im 12. Stück des Großen Briefbuchs erzählt. Es geschah eines Tags, da saß er in der Zelle und sah einen Hund, der lief mitten im Kreuzgang umher und tanzte mit einem Fußtuch herum und warf es bald auf und warf es bald nieder. SEUSE aber gedachte dabei: »Recht also bin ich in der Brüder Munde wie das Fußtuch«; und er sagte sich: »Nun nimm eben wahr: das Fußtuch läßt sich behandeln vom Hunde wie er will, er werfe es hoch oder nieder oder trete darauf«, und er gedachte: »So sollst auch du tun, ob man dich hoch halte oder niedrig oder dich bespucke, du sollst es ganz gleich aufnehmen wie das Tuch.« Dies Gleichnis aber ist kein anderes als jenes, das Gotamo den Jüngern mit dem katzenfellgleichen Gemüte versinnlicht hat, das durch keinerlei gute oder böse Rede von den Leuten je wieder zur lebendigen Katze umgewandelt werden kann: Mittlere Sammlung 151f.
898 tattha tattha visesatthakaro pure ahosi mit S; vorher auch mit S samekkhamāno, mahājanasaṃgāhakaṃ.
899 Mit M etc. paripuṇṇakosakoṭṭhāgāro zu lesen, wie an der gleichen Stelle in der 5. Rede unserer Sammlung, S. 92, ed. Siam. I 171; auch in der Ausgabe der Pāli Text Society vol. I p. 134 richtig.
900 sīlena sutena cāgenādi S etc. Zu Beginn des Absatzes ist natürlich Kint' ime saddhāya abzuteilen. Der Auftakt des Satzes ist gegeben und durchgehalten mit dem bahujanassa atthakāmo ahosi, »(weil er) vielem Volke zu helfen suchte«: das wird dann, wie regelmäßig, in einer mächtigen Fuge weiterentwickelt. So kommt der Auftakt mit dem letzten am Ende des Satzes zur vollen Geltung. Nicht in so bewundernswürdiger Rhythmik gegliedert, wohl aber in gleicher Dynamik ist uns Deutschen dafür der Spruch erklungen:
Der brave Mann
Hilft wo er kann.
901 Siehe Mittlere Sammlung Anm. 247. – Besser samavāharasaharaṇiyo mit S.
902 Ebenso Mittlere Sammlung S. 655.
903 Wie S richtig angibt, ist samojasā zu lesen; als Variante im Text steht pāmuñjasā; am Ende rasaggisaggitam, vorher korrekt pecca modati.
904 Mit S zu lesen na ca visaṭaṃ na ca visāvi na ca pana vidheyyapekkhitā, uju tathā pasaṭam ujumano hutvā ujupekkhitā ahosi, piyacakkhunā bahujanam udakkhitā ahosi. Zu visaṭam cf. avikkhittam avisaṭam »nicht zerstreut, nicht zerfahren«, im Stempel zu Beginn der 138. Rede der Mittleren Sammlung.
905 Gern gesehn oder »Gerngesehn«, Piyadassano oder Piyadassi, ist ein Ausdruck, den Asoko später als Namen für sich erwählt hat, und den er, ausschließlich, auf allen seinen Edikten, wenn er sich nennt, anwendet: offenbar weil ihm solche Stellen wie eben unsere obige wohlbekannt waren, ja seinem ganzen herrlichen Wirken die Richtung gegeben hatten. Anblick und Art eines solchen Kaiserkönigs ist in der Mittleren Sammlung S. 964f. lebhaft veranschaulicht. Ein Vorbild ist bereits in der Smṛti zu finden, wie dort näher angegeben wird, nebst Hinweisen auf die verwandten Gestalten bei Griechen, Römern und auch im Rolandslied; zu welchen man noch das Lob jenes großen Welteroberers aus den Nibelungen beifügen mag, von dem es am Ende der 29. Âventiure heißt:
Ein wirt bî sînen gesten schôner nie gesaz.
[879] Diese liebevolle Anmut bei höchster Machtfülle, die da den Herrscher vor allen auszeichnen soll und ihn, nach dem indischen Ausdruck, zu einem »Gerngesehn« macht, ist in neuer Zeit ungemein treu von RICHARD WAGNER wiederempfunden worden, wenn er den Heerrufer im Lohengrin den Mannen sagen läßt:
Doch will der Held nich Herzog sein genannt, –
Ihr sollt ihn heißen: Schützer von Brabant!
Der Anschluß an jene erhabenen Herrscher der Vorzeit ist hier, natürlich ohne irgendeine bewußte Absicht, auf das glücklichste getroffen, und noch insbesondere dem vedischen Gebrauche gemäß, nach welchem bhūpaḥ, Schützer der Erde, Titel und Synonym für König ist: denn der soll eben aller Wesen Schützer, Behüter sein wie ein Vater, pater, pitā, von pā, pāti, schützen, beschirmen. Vergl. Mittlere Sammlung Anm. 394.
906 Mit S wieder richtig ujumano, udakkhitā etc.
907 bahuppādanimittakovidā zu lesen, wie schon vorher S. 526, ed. Siam. p. 171 v. 2c, uppādanimittakovidā anzeigt.
908 bahujanapiyāyako mit S. – Das Ziel andere zu beglücken, die Menschen zu fördern, dem Volke zu dienen, auch wenn es gilt an sich selbst die schrecklichsten Opfer und Qualen zu bestehn: das ist der eigentliche, unerschöpfliche Gehalt des Jātakam, der Sagenkunde von den früheren Lebensläufen als den Vorstufen der Entwicklung zur Meisterschaft. Namentlich ist es der abschließende Teil der Sammlung mit der Legende vom Prinzen Vessantaro, der in immer leuchtenderen Zügen jenes hohe Ideal versinnlicht. Eine solche Weltanschauung hat dann weit über Indien hinaus alle Völker Asiens mächtig ergriffen und damit nach und nach bei unzählbaren millionen Barbaren eine zwar längst bekannte aber, angesichts der rück- und vorläufigen Erfahrungen am Christentum, nie genug zu bewundernde Umwandlung bewirkt. Diese Wirkung hat ungefähr zu Beginn unserer Zeitrechnung eingesetzt, als in Hochasien das Mahāyānam sich mehr und mehr zu entfalten begann: jener volksmäßige Buddhismus, den gewisse katholische Theologen so gern als vom jungen Christentum beflügelt erkennen möchten. Das aber ist ebenso anmaßend, als es eine geschichtliche Unmöglichkeit ist. In bezug hierauf sagt GARBE in seinem kürzlich erschienenen umfassenden Werk »Indien und das Christentum«, Tübingen 1914, S. 178: »In Wahrheit ist das Mahāyāna ohne jede Beeinflussung von seiten des Christentums entstanden und hat aus eigener Kraft in gewaltigem Siegeszug die ostasiatische Welt bezwungen, und zwar ohne dabei einen Tropfen Blut zu vergießen, lediglich durch die Macht der Überzeugung und des Vorbilds. Was für eine bis auf den heutigen Tag nachhaltige Wirkung das Mahāyāna auf die höhere Geisteskultur Chinas ausgeübt hat erfahren wir von dem großen Sinologen J.J.M. DE GROOT, der lange Jahre in China unter den buddhistischen Mönchen gelebt hat und die Buddhisten für die einzigen Chinesen erklärt, die Herzensbildung besitzen, und für die einzigen, mit denen man über geistige Dinge reden könne.« Der Sieg des Buddhismus ohne einen Tropfen Blutvergießens, den GARBE so ehrlich rühmt, hat zu CHILDERS' Zeiten einmal den zeilonesischen Mönch MIGETTUWATTE zu einem recht bezeichnenden Ausspruch [880] gegen den Reverend DAVID DE SILVA veranlaßt, bei einer Disputation mit diesem christlichen Missionar in Pantura vor einer großen Volksversammlung beider Parteien. Nachdem er im Verlaufe jener Unterredung die bedenklichen Wirkungen und Anzeichen, die bald nach der Geburt des christlichen Erlösers sich schon ereignet haben sollten, den mit kirchlicher Approbation geglaubten Massenmord nämlich tausender von Kindern, als schaudervoll und niederschmetternd für liebreiches Empfinden erwähnt hatte, erklärte er sich gern bereit der buddhistischen Lehre abzusagen, wenn die Anhänger des Reverends nachweisen könnten, daß infolge der Geburt des Buddho auch nur eine Ameise ums Leben gekommen sei: S. 33f. des Sonderdrucks aus den Berichten der »Ceylon Times« in Kolombo von Ende August 1873. Diesen ersten der Grundsätze buddhistischer wie auch brāhmanischer Bekenner, Schonung alles Lebendigen, hatte ja schon CAMÕES, in indischer Sitte besser erfahren als die nachgebornen portugiesischen Bastarde und je nach Gelegenheit dienernden DE SILVA usw., begeistert gepriesen und in das Merkwort gefaßt »Năo matam cousa viva«, Sie töten nichts Lebendiges, Lusiadas VII 40. Als eine durchschnittliche Stichprobe wie aber die mahāyānische Richtung und Lebensanschauung, hierin ganz gleich der südlichen Überlieferung, auch in die entlegensten Gebiete gedrungen ist, z.B. bei den wilden Wüstensöhnen von Tibet Eingang gefunden hat, volkstümlich wurde, folge hier eine Stelle aus dem Beginn des Dsanglun in der Übersetzung von I.J. SCHMIDT, St. Petersburg 1843, 2. Bd., S. 7-10. Da sprechen die Götter der brahmischen Kreise also vor dem Erhabenen: »Ferner war der Siegreich-Vollendete in einer früheren Zeit hier auf Dschwambudwip ein großer König, mit Namen Dschiling-Girali, welcher über sämmtliche kleine Fürsten herrschte, vier und achtzigtausend große Städte, zwanzigtausend Gemahlinnen und eben so viel Hofstaat besaß. Außer seinem Thronerben hatte er fünfhundert Söhne und zehntausend hohe Kronsbeamte. – Dieser König betrachtete mit einem Herzen voll Barmherzigkeit alle seine Unterthanen gleich einem (einzigen) Sohne. Zu der Zeit beorderte dieser große König aus Liebe und Hochachtung zur heiligen Lehre einen Beamten und ließ folgenden Befehl verkündigen: ›Wer es auch sey, wenn er Inhaber der Sutras oder der heiligen Lehre (überhaupt) ist und sie mir mittheilt, so werde ich ihm, was er auch wünschen möge, seinem Verlangen gemäß geben.‹ – Hierauf erschien ein Brahmane, Namens Leudutscha, an der Pforte und sprach: ›Ich bin Inhaber der heiligen Lehre und werde sie demjenigen mittheilen, der sie zu hören wünscht.‹ Auf diese Nachricht ging der König selbst voll Freude und Vergnügen hinaus dem Brahmanen entgegen, verbeugte sich mit dem Haupte zu dessen Füßen, bewillkommte ihn mit freundlichen Worten und führte ihn in das Innere des Palastes, woselbst er ihn auf dem Teppich Platz nehmen ließ und, die Handflächen zusammenlegend, zu ihm sprach: ›Großer Lehrer, geruhe mir die heilige Lehre vorzutragen!‹ Der Brahmane erwiederte: ›Da ich sie erst erlernt habe, nachdem ich seit einer langen Zeit in allen Körpern die verschiedensten Qualen erlitten hatte, so ist, o großer König, es allein nicht genügend, daß du sie zu hören wünschest.‹ Der König legte die Handflächen zusammen und sprach: ›Fordere, was du auch wünschen möchtest! Alles werde ich dir, o Lehrer, ohne Rückhalt darreichen.‹ Der Brahmane sprach: ›Wenn du tausend eiserne Nägel in deinen Körper schlägst, werde ich dir die Lehre mittheilen.‹ Der König antwortete: ›Das werde ich thun! von heute an nach sieben Tagen werde ich diese Sache zur Ausführung bringen.‹ Zu der Zeit ließ der König vier Boten Elephanten besteigen, fähig, Strecken von vier und achtzigtausend Stimmenweiten zu durchwandern, und Allen auf Dschambudwip Folgendes verkündigen: ›Der große König Dschiling-Girali wird von nun an in sieben Tagen [881] tausend eiserne Nägel in seinen Körper einschlagen.‹ Als die Kronsbeamten und die vielen Wesen diese Bekanntmachung hörten, kamen sie Alle in die Nähe des Königs, welchem sie Folgendes vortrugen: ›Wir in den vier Gegenden wohnenden Wesen erfreuen uns allein durch des Königs Verdienste und dessen Gnade an unsern verschiedenen Orten des Wohlseyns, Glückes und Überflusses. Großer König, wir flehen zu dir, um unsertwillen geruhe die tausend eisernen Nägel in deinen Körper nicht einzuschlagen!‹ Zu derselben Zeit baten auch die Gemahlinnen, die Hofbedienten, der Thronerbe nebst den Prinzen und die sämmtlichen Kronsbeamten flehentlich: ›Großer König, gedenke unser mit erbarmungsvollem Herzen! es ist nicht ziemend, um eines einzigen Menschen willen dir den Tod zu geben und alle deine Unterthanen bei Seite zu werfen.‹ Der König antwortete ihnen: ›Seit langer Zeit habe ich im Kreislaufe der Geburten meinen Körper unzählige Male verschwenderisch preisgegeben; die Anhäufung meiner weißen Gebeine aus den Perioden, wo derselbe durch Wollust, Zorn und Thorheit vernichtet worden, würde einen Berg bilden höher als der Ssumeru; das durch Abhauen meines Kopfes vergossene Blut würde mehr als (die Wassermasse von) fünf großen Strömen seyn; die Masse meiner vergossenen Thränen würde die der vier Meere übertreffen. Da nun, obgleich ich solchergestalt in jeglicher Weise mein Leben und meinen Körper verschleudert habe, dieß nicht ein einziges Mal um der Religionslehre willen geschah, will ich nun die tausend Nägel einschlagen und mich dadurch zur Buddhawürde vorbereiten. Da ich, späterhin offenbarlich Buddha geworden seyend, durch das Schwert der Weisheit von Euch Allen das Krankheitsübel der Sünde abzuhauen gedenke, warum wollt ihr mir den Weg zur ersehnten Vollkommenheit verhauen?‹ Auf diese Rede (des Königs) hatte die ganze versammelte Umgebung nichts zu entgegnen. Sodann sprach der König zum Brahmanen: ›Großer Lehrer, sey meiner mit Barmherzigkeit eingedenk und zeige mir vorher die Religionslehre; darnach schlage die tausend eiserne Nägel ein! denn wenn mein Lebensende kommen sollte, möchte ich des Anhörens der Lehre verlustig gehen.‹ Dieser Aufforderung gemäß sprach der Brahmane folgende lokas:
›Alles Entstandene ist ohne Fortdauer;
Alle Geburten sind mit Leiden verbunden;
Alle Gegenstände des Seyns sind nichtig,
Daher ohne Ich und Mein;
Auch das Ich und Mein ist nicht vorhanden!‹
Nachdem der Brahmane diese lokas gesprochen hatte, schlug er in den Körper (des Königs) die tausend eiserne Nägel ein. Als zu der Zeit der Thronerbe, die Kronsbeamten und die ganze versammelte Umgebung solches sahen, warfen sie sich, gleich wie ein großer Berg zusammenstürzt, zu Boden, weinten und wälzten sich völlig besinnungslos auf der Erde. Zu derselben Zeit erbebten Himmel und Erde sechsmal, so daß die Götter der Welt der Sinnlichkeit sowohl als diejenigen der Welt der Körperformen von Verwunderung ergriffen, sämmtlich vom Himmel herabstiegen und in die Nähe des Bodhisatwa kamen; und als sie gewahrten, wie er um der Religionslehre willen solche große Qualen an seinem Körper erlitt, weinten sie Alle und ihre Thränen fielen wie Regen herab; sie brachten ihm durch himmlische Blumen ein Opfer dar. Auch kam zu der Zeit Dschadschin, der Fürst der Götter, dahin, wo der König sich befand und sprach zu demselben: ›Großer König, wo sind deine Gedanken bei so eifrig und qualvoll begonnenem Unternehmen? ist es um der Lehre willen? oder, wenn dem nicht so, der Wunsch, der das Rad drehende König (Universalmonarch) zu werden? [882] oder vielleicht, Fürst der Dud (Geister der Sinnlichkeit und Sünde) oder Brahma oder auch der große Machtvollkommene (Mahe wara, iwa) zu werden?‹ Hierauf erwiederte der König: ›Diese meine Handlung ist nicht aus dem Verlangen nach den Freudengenüssen der drei Welten entstanden, sondern, wofern ein Tugendverdienst daran ist, aus dem Verlangen nach der Buddhawür de.‹ – Dschadschin sprach: ›Da, wie ich sehe, der Körper des Königs zittert und große Ungeduld verräth, wie kann man, indem du solches sagst, glauben, daß du keine Reue empfindest?‹ Der König versetzte: ›Wenn meine Worte Wahrheit sind und ich keinen Gedanken an Reue habe, so werde mein Körper wie zuvor und frei von Wunden!‹ Kaum hatte (der König) dieß gesprochen, als sein Körper ganz die frühere Gestalt bekam, worüber Götter und Menschen voll Freude waren.«
Mag nun auch der Vortrag solcher Stellen aus dem tibetischen Kanon, wenigstens in derartiger Fassung, unbeholfen und fremdartig klingen, lange nicht mehr für so feine Ohren wie bei uns oben bestimmt: man kann dabei doch gut begreifen lernen, wie unsere Parole vom Heldentum und der Selbstüberwindung, zum Heil für sich und andere, jene Völker, die von den entsittlichenden und aufpeitschenden Kirchendogmen der christlichen und türkischen Apostel und Mordbrenner noch ganz unberührt waren, aus ihrer wilden wüsten Roheit zu besseren Menschen erziehn konnte, das Herz veredelnd und den Geist kräftigend; bis zu dem Grade, wo tausend ins Fleisch geschlagene Nägel, die täglich dieser traurigen Welt tausendfach geschlagenen Wunden, erst nach ihrer allenthalben grob sichtbaren Form und sodann mehr und mehr innig, tiefer und schmerzlicher verstanden, vom mongolischen Hirten wie von jenem König der Sage freudig lächelnd um des ersehnten Zieles willen ertragen werden. Das eigene leidige, nichtige Leben kann ja, nach solcher Belehrung, nur dann würdig und wertvoll gestaltet werden, wenn der Wille des Menschen bis zu einer Kraft gesteigert wird, wo er auch das, wie es scheint, Unmögliche zu leisten vermag. Das ist jener Weltbegriff des Jātakam, den es mit der römischen virtus und der deutschen Treue teilt, den es nicht müde wird immer und überall darzustellen, in Wort und Bild, in Lehre und Gleichnis und in jeder seiner vielfachen Formen, im Kleinen und im Großen, nach außen und nach innen, im Süden wie Norden, ob es nun in Pāli oder auf tibetisch, chinesisch oder sonstwie zu uns spricht. Der Wille, bis zur letzten Möglichkeit in sich entwickelt um so zur Selbstüberwindung zu kommen, das ist das Thema. Und darum heißt es, als Programm des Menschen, wie es noch der tüchtige Siddhattho siebzehn Jahrhunderte nach Gotamo in seinem Kompendium des Buddhismus aufstellt, im Sārasangaho (Kolombo 1891 p. 3; p. 14 meiner Ausgabe des ersten Kapitels, Leipzig 1890): »Der feste Wille ist die Absicht; bei wem der stark ist, dem gelingt das Streben. Stark aber ist dessen Wille, der auf die Frage: ›Wer kann wohl, wenn man vier Unermeßliche Zeitfolgen und hunderttausend Weltalter hindurch in einer Hölle gemartert war, noch hoffen ein Erwachter zu werden?!‹ –, ›Ich!‹ zu erwidern vermag.« – Dabei ist aber wohl zu beachten, daß das Kriegshandwerk, das gewerbsmäßige Metzeln und Schädeleinschlagen, der Rassenhaß, die Berserkerwut, der zum Beruf erhobene Schlachtruhm, dieses notwendige Übel, nicht etwa für eine edle Sache gilt oder gegolten hat, nicht für den höchsten Manneswert, nicht schlechthin für preiswürdig angesehn und gebilligt wurde, wie beim gewöhnlichen, rohen Volksgeist in Vergangenheit und Gegenwart: sondern nur aufgezeigt als die offenbar gewordene Leidensverkettung, deren großartiges Gemälde Gotamo in der 13. Rede der Mittleren Sammlung entworfen hat, S. 97, wozu noch sein Stempel gehört »Bedürftig ist die Welt, nimmersatt, durstverdungen«, von Raṭṭhapālo dem König Koravyo [883] erklärt 620f. Der beste Krieger, der wahrhaft Tapfere gleicht aber auch im alten Indien Dietrich von Bern, als er gar keine Lust bezeigt mit Ecke dem Riesen sich zu messen, bescheiden ausweicht, ihm ruhig abrät, ihn gütig mahnt, sich lange zurückhält, beharrlich dagegen sträubt, und erst auf Eckes unaufhörliches Drängen und Drohen, immer trotzigere, immer heftigere, immer wütendere Herausforderung endlich notgedrungen in den Kampf einwilligt und, den Tod des Recken beklagend, ihn niederschlägt. Es ist das dieselbe Gesinnung, wie sie, auf ihre Grundlage hin geprüft und von edlem Mitgefühl befunden, aus einem Gespräch frei sich entwickelt, das Gotamo eines Tages mit einem Hauptmann der Soldaten (yodhājīvo gāmaṇī) geführt hat. Der war herangekommen und hatte also gesprochen: »Ich habe gehört, o Herr, daß die Meister und Altmeister der Soldaten einst gesagt haben: ›Wer da als ein Soldat in die Schlacht zieht und kämpft, und er wird geschlagen, hingestreckt, der gelangt bei der Auflösung des Körpers, nach dem Tode, zur Gemeinschaft der Siegreichen Götter empor‹: was sagt nun der Erhabene dazu?« – »Genug, Hauptmann, lass' es gut sein, frage mich das nicht«, erwidert Gotamo. Jener Hauptmann aber läßt sich nicht abweisen und stellt ein zweites und ein drittes Mal die Frage, bis ihm der Meister endlich antwortet: »Wohlan denn, Hauptmann, du gibst mir nicht nach, wenn ich sage: genug, Hauptmann, lass' es gut sein, frage mich das nicht; so will ich dir nun Rede stehn. Wer da, Hauptmann, als ein Soldat in die Schlacht zieht und kämpft, der hat eben schon eine verworrene Gesinnung, ist abseit geraten, abseit geglitten: ›Diese Leute müssen geschlagen werden, müssen umgebracht werden (vajjhantu S), sie sollen zerstört und vertilgt werden, sie dürfen nicht mehr dasein!‹ Während er nun so loszieht und kämpft, wird er geschlagen, hingestreckt; und bei der Auflösung des Körpers, nach dem Tode, wird er der Siegreichen Hölle, wie man sagt, anheimfallen. Wenn er aber etwa die Ansicht hat: ›Wer da als ein Soldat in die Schlacht zieht und kämpft, und er wird geschlagen, hingestreckt, der gelangt bei der Auflösung des Körpers, nach dem Tode, zur Gemeinschaft der Siegreichen Götter empor‹, so ist das seine verkehrte Ansicht. Die verkehrte Ansicht aber, sag' ich da, Hauptmann, läßt den Menschen nach einer von den zwei Fährten hin wandeln: zur Hölle oder zur Tierheit.« Auf diese Worte ist dann der Hauptmann in Klagen und Tränen ausgebrochen: aber nicht darum, weil er solche Antwort erfahren, sondern weil er früher, wie er sagt, »von den Meistern und Altmeistern der Soldaten lange Zeit hindurch getäuscht, genarrt, geködert worden war.« Saṃyuttakanikāyo ed. Siam. IV p. 377-379 (PTS 308f.). Die Abwehr des Schlachtruhms ohne irgendwelche Beschönigung ist also, um auf unseren Ausgangspunkt im Text oben zurückzukommen, durch die reif gewordene Erkenntnis bedingt: eine Folge jenes vormals immer wieder gepflegten Wirkens, wo der Erwachsame »gern vielem Volke Huld erweisen« mochte, bahujanapiyāyako ahosi.
909 upavattati īdisakaṃ S.
911 S brahmassaro ca karavikabhāṇī ca und beidemal richtig ādiyant' assa vacanaṃ.
912 Der tadellose Vortrag mit der leichtbeweglichen freien Zunge ist, brāhmanischer Überlieferung entsprechend, in Anm. 1022 der Bruchstücke der Reden näher erklärt, nach Quellen der ruti und Smṛti. Auch die Texte des Mahāyānam sind hier der alten Spur gefolgt. Sie haben den Ausdruck »Zunge« ganz richtig als »Zungenorgan«, jihvendriyam, erkannt. Daher sagen sie: die Vollendeten seien imstande den gesamten Bereich ihrer Wirksamkeit mit dem Zungenorgan zu überziehen und darin einzuwinden, jihvendriyeṇa saṃcchādayitvā nirveṭhanaṃ kurvanti, z.B. Sukhavatīvyūhasūtram p. 36. Dieser Text dürfte aus dem Beginn unserer Zeitrechnung herstammen und ist[884] dann später nach China und Japan gebracht worden. Die älteste Palmblatthandschrift desselben war im Tempel Horiū-ji bei Kioto niedergelegt, dem weltentlegenen Heiligtum, das vom Prinzen UMAYADO um 600 gestiftet wurde. Sie ist erst vor etwa 40 Jahren wiederaufgefunden und von MAX MÜLLER in den Annales du Musée Guimet, Paris 1881, II 33-37, veröffentlicht worden. Die daraus mitgeteilte Stelle über die Macht des Zungenorgans der Vollendeten bezieht sich zugleich auf verwandte Angaben im Pāli-Kanon, wie Anguttaranikāyo III Nr. 80, wo gesagt wird, daß die Kraft des Wortes eines vollkommen Erwachten sich über tausendmillionen tausend große Weltsysteme samt all ihren Himmeln erstreckt; während nämlich ein großer Brahmā »nur« tausend große Weltsysteme durchdringen kann. Vergl. Anm. 581, letzter Absatz: »dreimal weiter« ist Exponent der Progression bis 10003. Das Mahāyānam nun also hat dort wieder einmal, wie man sieht, die altmythischen Ansichten mitbewahrt. Um so kläglicher ist was Buddhaghoso oder seinesgleichen als Kommentator ein paar Jahrhunderte später als Glosse hinzugetan hat; lehrreich insofern es zeigt, daß er da nicht die mindeste Rücksicht, keinerlei Aufmerksamkeit gehabt hat auf die Äußerungen der von ihm weitererklärten Texte, geschweige auf die vorangehende, oft dazugehörige vedische Kunde: von all dem hatte er überhaupt keine Ahnung, er war ganz auf seine eigene, ach so entsetzlich plumpe Improvisation angewiesen, und so erfindet er denn lustig drauflos, als ein Faselhans. Er sagt, die Zunge des Meisters sei so gewaltig groß gewesen, daß sie, herausgestreckt, beide Ohrmuscheln erreichen und bestreichen konnte, auch beide Nasenflügel, ja sogar den ganzen Umkreis der Stirne bedecken konnte. Dieses Impromptu unseres Scholiasten ist aber noch bescheiden im Vergleich zu dem, was später daraus wurde, wo es, im Laufe der Zeit auf dem Missionswege nach China gelangt, dort in der bekannten Manier der immer weiteren Übertreibung fabelhaft überboten worden ist. Denn die chinesische Übersetzung und Bearbeitung des Sukhavatīvyūhasū tram, das im ganzen fernen Osten höchstberühmte O-mi-to-king, gibt nicht mehr den bildlichen Ausdruck sondern die Versicherung, im sechsmal wiederholten Abgesang, daß in allen Weltgegenden von den Buddhās, deren Anzahl unermeßlich ist wie die Masse der Sandkörner am Gestade des Ganges, ein jeder in seiner Weltregion die rechte Lehre entwickelt und darlegt: dabei aber streckt er eine breite und lange Zunge hervor, die jene tausendmillionen tausend großen Weltsysteme, also tausendmillionen Milchstraßen, vollkommen bedeckt, nach der Übersetzung von YMAIZUMI und YAMATA in den Annales du Musée Guimet, tome II p. 42. Das ist Genügen an grenzenloser Raumdrescherei, nicht zum wenigsten dem Buddhaghoso zu danken, Apollini a non pollendo. R. OTTO FRANKE allerdings meint von dessen oben angeführter Improvisation, dieser handgreiflich späten Bresche im Block der Texte, »Dīghanikāya«, Göttingen 1913, S. 103, Anm. 4: »So lächerlich diese Dinge bei oberflächlicher Betrachtung erscheinen und so viel von der Geschmacklosigkeit der Ausmalung auch persönliches Eigentum des Verfassers sein mag, so tief ist doch der ursprüngliche Sinn und so unbedenklich die Echtheit des Kernes. Es sind augenscheinlich alte Gottheits-Attribute.« Davon kann, nach den gegebenen Belegen, keine Rede sein. Es ist nur die vollständige Hilflosigkeit und Unfähigkeit des von allen Göttern verlassenen Scholiasten erwiesen, der den Ausdruck von der »mächtigen, gewaltigen Zunge« nicht mehr für das Zungenorgan verstand und ihn nicht anders als im siṇhalesischen Teufelsfratzenstil denken konnte. Daher redet er ungefähr so aufschlußreich wie, nach SWIFT, ein Arzt zum anderen spricht, an der Leiche des Lords, den sie mit ihren Diagnosen endlich zutode kuriert haben: Laetus paco fitis time, womit er nur zu verstehn gibt: »Let us pack off; it is time«, am Ende der »Consultation [885] of four physicians upon a Lord that was dying.« Ähnliche Fälle sind ja auch sonst nicht eben selten. Ich möchte hier zunächst ein kleines, recht belehrendes Beispiel, als eine Art Parallele, anführen. Eine Stelle, die auch schon viele Zungen in unnötige Bewegung versetzt hat. Als Hamlet im hitzigen Rapiergefecht mit Laertes einen Augenblick erschöpft innehält, sagt die Königin: »He 's fat, and scant of breath. Here, Hamlet, take my napkin, rub thy brows«, und das heißt natürlich: »Er schwitzt und atmet schwer. Hier, Hamlet, nimm mein Tuch, reib' dir die Stirn.« Dieser, wie man meinen sollte, gar nicht zu verkennende Umstand und Ausdruck ist aber den Erklärern keineswegs klar genug gewesen, und der Wortlaut des Textes hat ihnen durchaus nicht genügt, daher denn die Glosse hinzugefügt wurde: »Der Tradition nach war der erste Darsteller des Hamlet, der große Tragöde RICHARD BURBARGE, selbst fat and scant of breath«; und die uns daraufhin gebotene Übersetzung lautet: »Er ist fett und kurz von Atem« usw. So hatte man Hamlet glücklich zu einem fettsüchtigen Asthmatiker gemacht; nicht minder geschickt als man die gewaltige Zunge Gotamos in ein monströses »Gottheits-Attribut« umzuwandeln beflissen war und als solches anerkennen zu müssen, »erklären« zu müssen glaubte. Ein Beispiel anderer Art ist ein Fall, der durch das scholastico-physiologische Versehn eine allbekannte unsinnige Epenthesis gezeitigt hat. Nach der buddhistischen Legende wird der Ort der Empfängnis, bezw. der Leib der Mutter, die den künftigen Heiland gebiert, kanakavimānam, Goldener Palast, genannt: womit nichts anderes als ein tadelloser Zustand aller Organe gleichnisweise bezeichnet wird; siehe Seite 190 der 14. Rede und die Anmerkung 298 hierzu. Dieses Bild und Gleichnis war nun von der Christologie alsbald übernommen und in ein liebreizendes Unding verwandelt worden, zu einem dogmatischen Popanz von der αει παρϑενομητωρ, der Ewigen Jungfraumutter, zur richtigen puṣpagaṇḍikā oder Radendistel, auch Damendistel und Mannstreu genannt, die zu den stachligen Kletten gehört. Da wird z.B. von HIERONYMUS und den anderen Kirchenvätern vom Leibe der Mater purissima als von einer Domus aurea, einem Vas spirituale, Templum Dominici corporis, Sanctuarium Spiritus sancti, sacri ventris Hospitium ein so Langes und Breites geredet, daß man schließlich versteht, wie dabei sogar dem jungen SCHOPENHAUER (1814) der Kopf verdreht wurde, als er allen Ernstes eine Jungfrauengeburt infolge einer embryonalen Vorbefruchtung, nach Analogie der Parthenogenesis der Läuse, solch ein einziges Mal auch beim Menschen als denkbar sich einzureden suchte; und anderseits kommt es dahin, daß man dem saubergewaschenen gutgekleideten NIETZSCHE die Handschuhe, die er sich bei solcher Maialatrie und Wehmutterbeschäftigung anziehn möchte, eigentlich nicht übelnehmen, gern verzeihen lernt, oder mindestens dem so nachsichtigen Herrn VON HARNACK nur zustimmen kann, wenn er sagt, es sei etwas Schlimmes und Häßliches, daß die christliche Religion im Katholizismus in eine ganz besonders innige Beziehung zur Geschlechtssphäre versetzt ist, daß die Kirche ohne Scham in ihren Mariendogmen das Verborgenste ans Licht zerrt und sich über Dinge öffentlich zu reden erlaubt, über die sonst niemand zu sprechen wagt, usw.: Dogmengeschichte III, 218f. Die ekklesiastischen Geheimniskrämer regen damit, wie immer noch HARNACK in seinem Kreise zu bemerken findet, unsaubere Gedanken auf. Das eigentliche Ergebnis solcher ›kirchlichen [886] Wissenschaft‹ mit ihrer grob sinnlich-übersinnlich zuschnüffelnden Mysterienphysiologie, die HUME am Ende seiner klassischen Naturgeschichte der Religion schlechthin »sick men's dreams« nennt, zeigt die Antistrophe im Pantagruel, 2. Buch, 16. Kap., durch den zwar zotigen aber weidlich erfahrenen Schüttelreim an: Femme folle à la messe, femme molle à la fesse. Hysterie und Fanatismus im Wechselverhältnis, immer gegenseitig bedingt. Wie wär's auch anders möglich? Wahrhaftig, BAYLE hatte nicht zuviel gesagt als er schrieb: »ce devroit être desormais la même chose, que de dire, la Religion Catholique, et de dire, la Religion des Malhonnêtes-Gens«, Commentaire philosophique etc., Rotterdam 1713, vol. I, p. 7. Der kirchliche Wahnwitz ist eben zumeist der »immundissimus spiritus, omne phantasma, omnis incursio satanae, totius obscoenitatis inventor«, dem gegenüber das Rituale Romanum, Tit. X, cap. I, an Flüchen und Verwünschungen sich nie genugtun kann, sich gebärdet wie ein rasend gewordenes altes Weib oder jene Betschwester, von der Eulenspiegel sagt: »Es ist kein begyn so andechtig, wan sie zornig würt, so ist sie erger wan der teüffel.« Darum hatte doch schon der ehrwürdige Zisterzienser Dom GILLEBERTUS, ein Nachfolger Sankt BERNHARDS, sich nicht gescheut den Bonzen, die ›neue Dogmen ausbrüten‹, gründlich heimzuleuchten: Nesciunt cogitationes antiquas habere qui novitates verborum exquirunt, qui nova excludunt dogmata, qui iuvenilia desideria non declinant, qui nihil habent gravitatis, nihil auctoritatis, nihil antiquitatis plenum: non est ibi Amen, ubi est aut disceptatio aut deceptio cogitationum etc., Opera omnia S. BERNARDI, ed. Par. 1621, fol. 1790f. So war denn auch in unserem Fall eine disceptatio aut deceptio cogitationum hervorgegangen aus dem mißverstandenen, harmlosen Gleichnisse vom kanakavimānam, dem Goldenen Palast. Denn daß EPHRAEM, ja schon IGNATIOS und die apostolischen Väter den so arg umgekrempelten Begriff sich aus der buddhistischen Sagenwelt hergeholt hatten, gibt HIERONYMUS, der über vierzig Jahre im Orient mit den Denkern und Gelehrten dort umgegangen war, ganz offen und naiv zu erkennen, indem er, um sein Dogma noch besser zu stützen, behauptet: auch bei den Indern gelte der Buddho als Sohn einer Jungfrau, in der Schrift gegen JOVINIAN (I 42 = Patrologia Latina ed. MIGNE vol. XXIII, p. 273, nach NIESSEN, Die Mariologie des heiligen Hieronymus, Münster 1913, Kap. VII: Das Empfängniswunder). Wirklich aber war den Indern der Gedanke an eine jungfräuliche Geburt nie in den Sinn gekommen, oder doch nur im Widersinn, als ein Oxymoron oder abhavanmatayogam, etwa so wie ein späterer Moralist es meinte, der mit allzu bitterem Spotte gescherzt hatte, Dvātriṃ atputtalikā, ed. JIBANANDA, Kalkutta 1881, p. 5 v. 2:
Daß Sohn der Güsten König wird,
Daß Blumenfülle Wolken ziert,
Mag sein durch Schicksal – nicht kann sein
Das Herz des Weibes jemals rein.
Anders als HIERONYMUS und die Kirchenväter standen die Gnostiker, Markioniten, Markosier, Ebioniten, Enkratiten, Apotaktiten usw. der ehrlichen Betrachtung und Auffassung bedeutend näher, sie waren dem west-östlichen Synodalgedränge und Flausenkram so ferne geblieben wie das Wort und die Zunge des Asketen Gotamo den Dysprophora Buddhaghosos und seiner Kalfakter. Und freilich, was gehn uns diese zuletzt an? Die sind uns ja längst bekannt und bleiben sich überall ziemlich gleich: »die Schaum- und Schwammphilosophen«, wie sie PARACELSUS nennt; die es da immer auf irgendeine Art und Weise glücklich zuwege bringen aus dem Servizio [887] divino einen Servizio di vino zu machen als Eucharistie des Gargantua, »die schwarzen Pfaffen und die braunen«, wie SEUME sie in seinem »Gutachten« abfertigt,
Die ihre tiefen Gaunerein
Dem Volk mit gimpelhaften Launen
Hochheilig in die Ohren raunen,
Sind von dem Ganges bis zum Rhein
Zwar sehr oft noch der armen Menschheit Pein;
Doch mit dem leidigen Gelichter,
Jetzt in Kohorten, jetzt allein,
Bei weitem nicht sogleich auch Bösewichter.
913 S liest:
Gandhabbāsurasakkarakkhasebhi surebhi
na hi bhavati suppadhaṃsiyo tathatto:
yadi bhavati tathāvidho idha
disā ca patidisā ca vidisā cāti.
Hier ist sakkarakkhasā als sapparakkhasā denkbar, ja sehr wahrscheinlich: vergl. apasakkati für apasappati usw., TRENCKNER, Pāli Miscellany p. 60.
914 suciṃ visuddhaṃ suvisuddhasusukkaṃ zu lesen. S hat richtig suvisuddhasusukkaṃ.
915 Besser mahatiṃ 'maṃ mahim anusāsato ca; S etc.: mahat' imaṃ mahim anusāsato ca.
916 Mit S zu lesen:
Atha ce pabbajati bhavati vipāpo,
samaṇo samitarajo vivaṭ[ṭ]acchado,
vigatadarathakilamatho imaṃ pi ca
param api ca passati lokaṃ.
Die Spaltungen, darathā, sind in der Mittleren Sammlung erklärt, 905-908 und 1073; zur Beklemmung, kilamatho, cf. ib. S. 96. – Als Merkspruch könnte man unserem ganzen Stücke, so kurz wie umfassend, das »Nos, non nobis« voransetzen; und eben hier erst recht eigentlich den Vers bestätigt sehn, den LUCANUS in den Pharsalia II 383 dem CATO widmet, der nicht sich, sondern der ganzen Welt geboren sein wollte:
Nec sibi, sed toti genitum se credere mundo.
Unser GOTTFRIED aber hat die Summe richtig so gezogen, Tristan 18601/3:
Ich will mich gerne zwingen
In allen meinen Dingen,
Daß ich mein und sein entwese.
Der leitende Gedanke der Darstellung will zum Verständnisse führen, warum unermeßlich viele Verkörperungen notwendig waren, bis in der letzten Geburt alle Eigenschaften eines Vollendeten reif geworden, erworben waren, ein vollkommen erwachter Meister erscheinen konnte. Dieser Gedanke ist hier nach sittlicher Gesetzmäßigkeit entwickelt, ohne Ausschmückung vorgetragen, als schlichte Tatsache gegeben, gleichsam als Kern und Keim zum nachmaligen Legendenwalde gelegt. Daraus folgt, daß die üppig aufgewucherte Geschichte von den Vorgeburten, das Jātakam, erst in späteren Zeiten erwachsen sein kann. Da nun der Bestand des Jātakam mit seinem fruchtbaren Dickicht von Sagen, Fabeln, Märchen, Schwänken und Schnurren [888] auf den Reliefskulpturen am Kuppelmal von Barāhat für das 3.-2. Jahrhundert nach Gotamo sicher erwiesen ist, wird unser obiges Stück, einer weit früheren Überlieferung entsprechend, um mindestens hundert Jahre zurückweichen, in eine Zeit und in Kreise, denen es noch recht ferne lag die Sagen und Sprüche der ungeheuer reichhaltigen Volksdichtung dem Kanon mit als Belehrung einzuverleiben. Dies mag zu Ausgang des 2. Jahrhunderts geschehn sein, da ja eben schon in Barāhat die Massen von konkreten vorgebürtigen Schilderungen, wie OLDENBERG treffend bemerkt, sich »nicht auf unbestimmt flottierende Erzählungen bezogen, sondern auf fixierte Texte«, Nachrichten der Göttinger Ges. der Wiss. 1912 Heft 2 S. 202. So bedeutend, zuweilen sogar einzig herrlich dieser Legendenschatz gewiß ist, und so witzig man es auch verstanden hat das oft uralte Sagengut in passende Verbindung mit dem Meisterwort zu bringen: im Orden Gotamos war für dergleichen Dinge kein Raum übrig. Denn da heißt es: »Nicht soll der Mönch Erzähler sein«, Bruchstücke der Reden v. 930. Dieser Vorwurf trifft unser Stück noch nicht. Es ist, wie man sagen könnte, das Jātakam an sich, das zugehörige, echte: die Geschichte, die Rechenschaft von der Erwerbung der Merkmale des Meisters. Der ist nun zu einem Buddho, Erwachten, geworden: überstanden ist die ungeheuere Arbeit, hinter ihm, das Werk ist vollbracht. Und der ganze Bericht darüber ist von jener Heiterkeit umstrahlt, die auch dem Denker und Dichter, der alle Erfahrung im Rückblick überschaut, aufgegangen ist, ihm, dem indische Geistestiefe und Anmut wie keinem anderen herzensverwandt war, PETRARCA, als er die dritte Ecloga mit dem Ende gekrönt hat:
Nunc vigilasse iuvat: dulce est meminisse laborum.
917 Diese Andacht und Verehrung entspricht der Vorschrift, die das Sāmavidhānabrāhmaṇam 14, 11 gibt: sie soll von der Dämmerung an so lange dauern bis die Sonne auf den Rücken brennt. Desgleichen findet sich im Anguttaranikāyo X Nr. 176 unter den Regeln, die von Buß- und Betpriestern, von Feuer-und Wasserverehrern aus dem Gangesgebiet angegeben werden, auch diese: pañjaliko ādiccaṃ namasseyyāsi, »mit gefalteten Händen magst du die Sonne verehren«. Über die aneinander gefalteten Hände als Zeichen der Huldigung ist in der Anm. 707 das reiche kultur- und kunstgeschichtliche Material beigebracht.
918 S hat, wohl besser, pavuccati für ca vuccati. Die Strophe ist elliptisch im Ausdruck, wie es oft beliebt ist.
919 Mit S richtig hirikopīnaniddaṃsanī; am Ende dann ānuyoge.
920 sankiyo ca hoti tesu tesu ṭhānesu, abhūtavacanañ ca tasmiṃ rūhati, bahūnañ ca dukkhadhammānaṃ purakkhito hoti mit S zu lesen. Im nächsten Absatz pāṇissaraṃ.
921 Die bekannte Vorliebe der Inder für musikalische Darbietungen, denen sie seit den ältesten Zeiten mit leidenschaftlicher Schwäche oder Stärke – wie man es nimmt – sich hingeben, ist in den Anm. 523, 651, 724 eingehend behandelt, und es wird an den angegebenen Orten gezeigt, wie weit sie es gebracht haben. Gründliche Untersuchungen und Beiträge zur Kenntnis der vedischen und rezitativen Musik verdanken wir FELBER und GEIGER in der 7. Abhandlung des 170. Bandes der Sitzungsberichte der kaiserl. Akademie der Wissenschaften, phil.-histor. Klasse, Wien 1912, mit zahlreichen nur für schon vertraute Kenner auflösbaren Notenbeispielen, mehr theoretisch wertvoll. Als ein leichteres Probierstück, wie auch heute noch klassische gītās oder Strophen richtig zu hören sind, folge hier eine zum Vortrag am Klavier transponierte Weise, nach dem Beiblatt zu einem, wenn ich nicht irre, der älteren Jahrgänge des Indian Antiquary. Dabei wird man die Treffsicherheit eines Kenners wie PIETRO [889] DELLA VALLE schätzen lernen, der ebendiese Art Gesang gehört und über solche Kunstübung, gegen Ende seines Briefes aus Surate vom 22. März 1623, mit feinem Ohr geurteilt hat: non era musica strepitosa come le ordinarie degli Indiani volgari, anzi era con bassa voce soavissima.
Der starke Hang zur Musik wird oben, Singālako gegenüber, von einer höheren Stufe aus, als eine Schwäche, ein Fehler betrachtet, nicht anders wie mir gegenüber einmal ROBERT L'ORANGE die Musik »die edle Lärmkunst« genannt hat. In den allumfassenden ādīnavo, in das Elend, reicht sogar sie noch hinein und ist somit auch noch Elend, wird als ein Fremdes, das uns nicht eigentlich angehört, so genannt. Denn bei den Jüngern des Sakyerasketen verstummt der Gesang; Laute, Fiedel, Flöte und Trommel liegen zerbrochen am Boden, wie zu Füßen jener Santa Cecilia, die, endlich des Spieles müde, den Ernst ergreift, ein Sinnbild des Übergangs ist, wie SCHOPENHAUER sagt, oder wie GOETHE das ganze soeben beendete Quintett beschreibt: Fünf Heilige nebeneinander, die uns alle nichts angehn, deren Existenz aber so voll kommen dasteht, daß man dem Bilde eine Dauer für die Ewigkeit wünscht, wenn man gleich zufrieden ist, selbst aufgelöst zu werden.
sehr langsam, molto sostenuto
(Das Gemälde, das unsere Großen so entzückt hat, ist nicht mehr vorhanden, seitdem es, um 1890, die Stadtväter von Bologna einem Anstreicher zum Übermalen ausgeliefert hatten, der es bis zur Unkenntlichkeit übersudelt hat: man wird daher die begeisterten Urteile nur noch an der Hand der [890] jetzt sehr seltenen Photographien vor jener Zeit bestätigt finden.) Ob wohl also die Musik oben im Text auch mit ādīnavo, Elend, genannt wird, handelt es sich immerhin um kunstgerechte Ausübung der Sache: einer Kunst, die leider in unseren Tagen auch in Indien im reißenden Verfall steht und der Folge kaum entrinnen kann in den Sumpf des Grammophongequaks zu versinken, in die überall wiedergetuteten, alles auch dort schon wie die Wasserpest überziehenden feschesten Operettenschlager, Gassenhauer und das ganze schmalzige Tongemauschel unaufhaltsam einzugleiten und in der Schlammastik zu ersticken. Daß jedoch anderseits Gotamo auch die Pflege der Musik gelegentlich zu schätzen wußte, ist aus manchen Hinweisen ersichtlich, wo er es nicht verschmäht hat ihre Anwendung gleichnisweise darzustellen, wie z.B. Anguttaranikāyo VI Nr. 55, v. 638 der Lieder der Mönche und Mittlere Sammlung 953 bis 954 klar anzeigen; recht so, wie es bei PYTHAGORAS einmal heißt: Das Leben wird wie ein Instrument durch richtige Stimmung der tiefen und der hohen Saiten freundlicher gestaltet, bei MULLACH, Fragmenta philosophorum Graecorum, Paris 1860, vol. I p. 485 No. 4; oder wie SEXTUS EMPIRICUS in seinem sechsten Buche bemerkt hat: Die da mächtige Meister der Weltkunde waren, wie etwa Platon, die sagten, daß der Weise dem Musiker gleiche, weil er den Geist richtig gestimmt habe, ed. FABRICIUS fol. 359. Daher denn allgemein über die Blütezeit griechischer Weisheit der einst klügste Botschafter, der Freund des Schöpfers der Santa Cecilia, Graf BALDESAR CASTIGLIONE, im Cortegiano Buch I gegen Ende, sehr erfahren sich bewährt: »Et ricordomi haver gia inteso, che Platone, et Aristotele vogliono che l'huom bene instituito sia anchor musico, et con infinite ragioni mostrano la forza della musica in noi essere grandissima«, Blatt 45 b meiner unpaginierten Venediger Ausgabe von 1538. Darum wollte auch TASSO, in seinem Dialog über die Dichtkunst, der Musik nicht entraten und nannte sie »quasi l'anima della poesia«. Das ist der Grund, warum sogar im Drama eine unvergleichlich erhabene Wirkung erzielt wird, als der todsieche König nichts mehr hören will und auf dem Sterbelager zu den Fürsten spricht, Henry IV, 2., 4, 4:
Let there be no noise made, my gentle friends;
Unless some dull and favourable hand
Will whisper music to my weary spirit.
Doch weitaus das stärkste mir überhaupt bekannt gewordene Lob hat SOKRATES ausgesprochen, im Minos p. 318, einem Dialog, der zwar nicht von PLATON selbst verfaßt ist, aber auf guter Überlieferung beruht: Τουτων δη και τα αυληματα ϑειοτατα εστι, και μονα κινει και εκφαινει τους των ϑεων εν χρειᾳ οντας; και ετι και νυν μονα λοιπα ὡς ϑεια οντα, »Das Flötenspiel nun eben dieser [Jünger des Marsyas und des phrygischen Olympos] ist das Göttlichste, und es allein bewegt uns und offenbart was wir an göttlicher Sehnsucht empfinden: und immer noch ist es das Einzige, was von göttlichem Wesen übrig geblieben.« So aber galt auch in der altindischen Kultur die Tonkunst als das göttliche Substrat der ganzen Welt: Tad yo 'sau kruṣṭatama iva sāmnaḥ svaras, taṃ devā upajīvanti, »Was da gleichsam der höchste Ton der Musik ist, davon leben die Götter«, und weiter bis zum Ergebnis sāmaivānnam iti, »Musik nur ist Nahrung«, Sāmavidhānabrāhmaṇam I 8; vergl. noch Mittlere Sammlung Anm. 360. Diese himmlische Nahrung meint THOMASIN im Welschen Gast, 8929f., wo er gar fein sagt:
Musica mit weise schoene
Geit uns weistum an di doene.
[891] Eine von aller Mystik nüchterne Äußerung Gotamos über die Musik und ihren vergleichbaren Wert ist uns in der Überlieferung des Kanons nach einer chinesischen Übersetzung erhalten, aus dem vierten Buch im Komplex des alten, hochberühmten Shau-leng-yan-king, d.i. Sūrangamasūtram, nach BEALS Catena of Buddhist Scriptures, London 1871, p. 354: Gleichwie etwa eine Laute, Fiedel, Flöte und Trommel angenehm im Zusammenspiel erklingen mögen; wenn sie aber nicht kunstgerecht behandelt werden, nur häßlichen Mißklang erzeugen: ebenso auch kann wohl das Wort des Vollendeten durch rechte Behandlung, weise Kunstfertigkeit, die Maße der Dinge vergegenwärtigen, während es den anderen mißlingt. Das aber ist, nebenbei bemerkt, gerade dasselbe musikalische Gleichnis, das auch im Hamlet auf das glücklichste veranschaulicht wird, im zweiten Gespräch mit Guildenstern, III 2, 365-389, zu dem der Prinz dann am Ende sagt: and there is much music, excellent voice, in this little organ; yet cannot you make it speak. Dazu paßt auch die Parabel vom Muschelbläser, in unserer 23. Rede, S. 410f. Die tiefste Anwendung aber findet man im Saṃyuttakanikāyo, ed. Siam. vol. IV p. 243f. (PTS 196). Gesetzt den Fall, heißt es dort, daß ein König oder ein Fürst den Ton einer Laute noch nie gehört hätte und eines Tages solche Musik vernähme. Und er fragte: »Ach woher kommt denn nur dieser Klang, so entzückend, so berauschend und berückend, so fesselnd und so befreiend?«. Darauf würde ihm gesagt: »Das ist, o Herr, eine Laute, wie man sagt: die hat diesen Klang, der so entzückend ist, so berauschend und berückend, so fesselnd und so befreiend.« Er aber gäbe den Befehl: »Geht, ihr Lieben, und bringt mir jene Laute herbei.« Die würde ihm gebracht: »Da ist sie, o Herr, die Laute, die jenen entzückenden Klang hat.« Darauf sagte der Fürst: »Was soll ich, ihr Lieben, mit der Laute? Ihr sollt mir doch jenen Ton herbeischaffen!« Die Diener erwiderten: »Das ist, o Herr, eine Laute, wie man sagt; die ist gar kunstvoll gebildet, kunstvoll gebaut: wenn sie auf mancherlei Weise richtig behandelt wird, dann redet sie. Wie sie da ist, besteht sie aus einem gewölbten Kasten, ist mit einer Zarge (mañcaṃ S) versehn, hat einen Steg, hat einen Hals, ist mit Saiten bespannt, und dazu gehört ein Bogen. Wenn nun ein Mann sich entsprechend bemüht, so kann da, o Herr, die Laute, wie man sagt, die gar kunstvoll gebildet, kunstvoll gebaut ist, auf mancherlei Weise richtig behandelt Rede geben.« Jener Fürst aber – der sie nicht spielen könnte – würde die Laute in Stücke schlagen, zertrümmern, zerstoßen, verbrennen und die Asche in den Wind streuen. Dann sagte er: »Das war ja doch, ihr Lieben, gar keine Laute, wie man sagt: was ist denn da irgend an der Laute gewesen! Damit treibt nur das müßige Volk seinen Possen und Schabernack.« Ebenso nun auch, wird nun die Summe des Gleichnisses gezogen, erforscht da ein Mönch die Form, wie weit die Form reichen kann; er erforscht das Gefühl, die Wahrnehmung, die Unterscheidungen, das Bewußtsein, wie weit es reichen kann. Während er so die Form, das Gefühl, die Wahrnehmung, die Unterscheidungen, das Bewußtsein erforscht, wie weit es reichen kann, kommt ihm wohl etwa ein ›Ich‹ oder ›Mein‹ oder ›Bin‹ zu, und es kommt ihm doch eben nicht zu.
922 jito vittam anusocati, sandiṭṭhikā dhanajāni zu lesen; so auch bei GRIMBLOT p. 301. Die Realien zu diesem und dem nächsten Absatz über die Freunde zur Zerstreuung, als Schwärmer, Spieler usw., findet man bei der echt indischen Musterung dieser Dinge in der 17. und 23. Rede S. 303, 310f., 417; insbesondere aber, ab ovo usque ad mala, ein Gleichnis dazu in der Udayanavatsarājaparipṛcchā: wie Fliegen, eine Wunde witternd, heranschwärmen, geradeso schwärmen Toren entzückt zum Weibe heran, BENDALLS Ausgabe des ikṣāsamuccayas, St. Petersburg 1897, p. 80. Auch uns ist sie ja keineswegs fremd geblieben, diese Freundschaft und Liebschaft mit Paukenschlag [892] und Trommelklang, mit Festgepränge und Trompetengeschmetter, mit Feuerwerk und Fackelzug, mit Böllerschüssen und fliegenden Wimpeln und Fahnen, mit Saus und Braus und Juchhe, und was sich mit heisa und hurra anschließt; und wir haben dazu eine Ausführung im biederen alten RABENER, garnicht zopfig: Ein junger Mensch, der sein Vermögen durchgebracht, dem der wollüstige Müßiggang das Gemüte zu höheren Beschäftigungen träge gemacht, und die Knochen zur Arbeit entkräftet hat, den das Andenken seiner vorigen Glückseligkeit verzweifelnd, und der gegenwärtige Mangel unverschämt macht, der es nicht gewöhnen kann unbemerkt zu leben, da er noch vor kurzem durch seine kostbaren Torheiten die Augen der ganzen Stadt auf sich zog: ein Mensch von dieser Art, und deren sind unzählige, wird eine Beruhigung für seinen Hochmut, und für seinen Hunger finden, wenn er zuerst die innerlichen Vorwürfe seines eigenen Gewissens damit übertäuben kann, daß alle heilige und bürgerliche Pflichten, die uns die Religion predigt, ein eigennütziges Gewäsche der Pfaffen sind: und er nun sich selbst, und allen, die es hören, und die es auch nicht hören wollen, die neuen Entdeckungen täglich vorsagt, die sein starker Geist aus Scham und Verzweiflung wider die Religion erfunden hat. Satiren, vierter Teil, 10. Aufl. Leipzig, 1771, S. 163.
923 Der Willkommene, sugato, wörtlich: der Wohlgegangene, Wohlgekommene; nach unserem Sprachgebrauch also: der Willkommene. Besser läßt es sich italienisch sagen, il Benvenuto: ein Ausdruck, der, als gleichbedeutend mit bentornato, die getreueste Wiedergabe vermittelt. In der italienischen Übersetzung der Mittleren Sammlung, die ich mit DE LORENZO ausgearbeitet habe, entspricht daher Wort und Begriff diesem Titel genau: I Discorsi di Gotamo Buddho del Majjhimanikāyo, per la prima volta tradotti dal testo pāli, Bari 1907, p. 266. Auch bei wichtigeren Worten und Wendungen kommt der italienische dem indischen Sprachgebrauch manchmal näher als der deutsche. Dies zeigt sich in der genannten Ausgabe recht gut und einleuchtend an zahlreichen Stellen. Ein vorzügliches Beispiel bietet das Ende der 144. Rede, wo die Eigenart des Originals ideal wiedergegeben werden konnte: cf. DE LORENZO, India e Buddhismo antico, 2a edizione, Bari 1911, p. 292, upādiyati upavajjo = riprende riprensibile; desgleichen bei Asokos letztem Erlaß und Abschied vyuthena vivuthā = uscito dalla uscita: worüber ich in der Sitzung der Accademia dei Lincei zu Rom vom 21. Dezember 1913 berichtet habe, vol. XXII fasc. 12. In der überwiegenden Anzahl der Fälle erweist die deutsche Sprache sich freilich als besser geeignet. Sugato, der Willkommene, il Benvenuto, war übrigens schon von BURNOUF, vor etwa 70 Jahren, als le Bienvenu übersetzt worden, bei GRIMBLOT p. 211. – Der folgende kurze Denkspruch über den Trinkbruder, der nur im Glücke treu bleibt, bei Elend aber sich alsbald abkehrt, ist im Bhāgavatapurāṇam VI 2, 9, gut in den Begriff gekoppelt, surāpo mitradhruk, Schluckerjan Freundverräter; trefflich auch im Kural v. 784, nach GRAULS Wiedergabe: Nicht zum Zusammenlachen ist Freundschaftmachen; und er ist vielleicht nirgend so anschaulich ausgeführt, als ein Corollarium, wie in SCHUBARTS Gedicht »Der Arme«, mit den Strophen:
Hülfe, willst du lange säumen?
Halb verschmachtet steh' ich hier;
Goldne Früchte an den Bäumen,
Reicher Herbst, was helft ihr mir?
Bauern sammeln in die Scheune
Korn und Weizen auf wie Sand:
[893] Aber wenn ich Armer weine,
So verschließen sie die Hand.
Reiche rasseln mit dem Wagen,
Fett vom Haber ist ihr Pferd;
Rasselt nur, daß ihr die Klagen
Eines armen Manns nicht hört.
– – – – – – – – – – – – – – – – – –
O so werft, wie euren Hunden,
Mir nur einen Bissen zu!
Doch wer Armuth nie empfunden,
Weiß es nicht, wie weh' sie thu'.
924 divāsoppaṃ pāricariyā akāle mit S etc.
925 nihīyati kāḷapakkhe va candimā S richtig, wie Theragāthā 292. Gegensatz zu diesem Gleichnis ist der voll aufgegangene Mond, der Mensch, dessen Geist entwölkt ist gleichwie der volle Mond um Mitternacht, Lieder der Mönche v. 306, der wie der Mond auf der Sternenbahn dahinzieht, Wahrheitpfad v. 208; ein Bild, das Kālidāsas mit Vorliebe wiedergegeben, z.B. als nakṣatranāthas im Raghuvaṃ am VI 66, und das auch schön im Nibelungenlied von Kriemhild auf Siegfried angewandt ist, XIV 4:
nu siehstu wie er stât,
wie rehte hêrlîche er vor den recken gât,
alsam der liehte mâne vor den sternen tuot.
926 pipāso pibam atthāpagato zu lesen. Trinkers Trost, in der Saufmette oder Compotatio compotatorum, ist: Vivere pro bibere. Und das Motto »Dum vita est, bene est« wandelt der Bibax in »Dum vinum est, bene est«, per pocula poculorum nach dem Gebet im Hibernischen Pantheisticon, wo gesungen wird: »Omnipotens et sempiterne Bacche, qui hominum corda donis tuis recreas, concede propitius« etc. Drum immer aufs neue: Bibamus. Schon trunken noch trinkend, pipāso pibam; eine der erbärmlichsten Leidenschaften, sagt Manus XII 45, jaghanyā rājasī gatiḥ, ein schweres Verbrechen gegen sich selbst, mahāpātakam, IX 235, XI 54. Was man mit KANT so kommentieren kann: »Als Wirkung aber vom Bewußtsein des moralischen Gesetzes, folglich in Beziehung auf eine intelligibele Ursache, nämlich das Subject der reinen praktischen Vernunft, als obersten Gesetzgeberin, heißt dieses Gefühl eines vernünftigen von Neigungen afficirten Subjects, zwar Demüthigung (intellectuelle Verachtung), aber in Beziehung auf den positiven Grund derselben das Gesetz zugleich Achtung für dasselbe, für welches Gesetz gar kein Gefühl stattfindet, sondern im Urtheile der Vernunft, indem es den Widerstand aus dem Wege schafft, die Wegräumung eines Hindernisses, einer positiven Beförderung der Causalität gleich geschätzt wird. Darum kann dieses Gefühl nun auch ein Gefühl der Achtung fürs moralische Gesetz, aus beiden Gründen zusammen aber ein moralisches Gefühl genannt werden.« Dieses moralische Gefühl wird in der Trunkenheit aufgehoben: die nun wirklich, wie man mit Timon zu ergänzen hat, das Feld wird,
Whereof ingrateful man, with liquorish draughts,
And morsels onctuous, greases his pure mind,
That from it all consideration slips.
[894] 927 khaṇā accenti māṇave nach der besseren Variante Theragāthā 231 zu lesen. Hierzu Bruchstücke der Reden v. 52, auch 966. Vergl. die Strophen Sirimaṇ ḍos in den Liedern der Mönche, v. 447-452, mit dem Ende:
Und ob du wandelst, ob du weilst,
Und ob du sitzen, liegen magst:
Die letzte Stunde stellt sich ein,
Die Zeit ist kurz und ungekannt.
Tiruvalluver sagt im Kural, v. 336, übersetzt von GRAUL: Das ist die Würde dieser Welt: »Der gestern war, ist heute nicht.« Wir haben dafür das mächtige Wort der CATERINA BENINCASA, der Heiligen von Siena, die Papst GREGOR XI geschrieben hat: Io vi dico: »Venite, venite, venite, e non aspettate il tempo, chè il tempo non aspetta voi.« Ein gleiches wendet besser bei sich an der Principe constante, III 7:
Bien sé al fin que soy mortal,
Y que no hay hora segura.
Nicht so genau übereinstimmend, nur als kurzer volksmäßiger Spruch: Heute reich, morgen eine Leich. In FREIDANKS »Bescheidenheit«:
Heute lieb, morgen leid,
Das ist der Welt Unstetigkeit.
Der mehr die tägliche Tätigkeit bewertende Gehalt unserer beiden oben im Text abschließenden Strophen mit ihrer schlichten und doch so gewichtigen Lebensweisheit und Erfahrung ist von THEOGNIS in das Distichon gefaßt:
Μητε κακοισιν ασω τι λιην φρενα μητ' αγαϑοισιν,
τερφϑῃς εξαπινης πριν τελος ακρον ιδειν.
928 S aññadatthuharo, vacīparamo, āhu. Über diese Art Freunde und Freundschaft findet man die kürzeste und nur allzu triftige Maxime bei DE LA ROCHEFOUCAULD: La plupart des amis dégoûtent de l'amitié, et la plupart des dévots dégoûtent de la dévotion. Sehr heiter sagte SOKRATES, als ihn jemand fragte, warum er sich ein so kleines Haus gebaut habe: »Wenn ich es nur voll kriege mit wahren Freunden«, nach PHAEDRUS III 9.
929 Vergl. die verwandte Stelle aus dem Anguttaranikāyo, übersetzt in der Anmerkung 150 der Lieder der Mönche, auch die ungemein anschauliche Darstellung der zwei Freunde in der 125. Rede der Mittleren Sammlung, 928, wo nebenbei auf meisterhafte Weise, echt gotamidisch, ein oft gebrauchter Priesterspruch der tieferen Bedeutung nach, arthāntaranyā sena, erklärt wird, nämlich der Wunsch mitro nayatu vidvān, nach der Ṛksaṃhitā I 90, 1, dem Gopathabrāhmaṇam II 5, 12 etc. Cf. BLOOMFIELDS Vedic Concordance s.v., in LANMANS Harvard Oriental Series vol. X, Cambridge, Mass., 1906. Eine wichtige Parallele und Bestätigung dieser feineren, nur eben zart angedeuteten, aber ganz sicher erkennbaren Beziehungen in der Anm. 177. – Weil nun eine solche Freundschaft zu finden zu den Dingen gehört, die man fast für fabelhaft anzusehn berechtigt wäre, hat CICERO zum Worte des ENNIUS
Amicus certus in re incerta cernitur
den auch hier gültigen Kommentar gegeben, der den schmutzigen Markt und Tummelplatz der Menschen wie ein Schimmer aus einer anderen Welt überglänzt: Qui [895] igitur utraque in re gravem, constantem, stabilem se in amicitia praestiterit, hunc ex maxime raro genere hominum iudicare debemus et paene divino. De amicitia liber, cap. XVII i.f. Einem derartigen Genossen, in Freuden wie Leiden immer gleich bewährt, hat MICHELANGELO eines der unbrechlichen Denkmale gesetzt, im Brief an VASARI vom 23. Februar 1556, indem er über den Tod seines treuen URBINO schreibt: »in vita mi teneva vivo, morendo m'à insegnato morire, non con dispiacere, ma con desidéro della morte«: ein Ausdruck, der in seiner schlichten Größe und Innigkeit der indischen Gestalt vielleicht am nächsten kommt. Natürlich wird eine solche Erfahrung stets eine äußerst seltene sein, die sie ja schon in alter Zeit war, und man Dioskuren besser am Himmel wahrnimmt, einen concentus, eine Freundschaft aller mit allem, wie sie IAMBLLCHOS erklärt: τους Διοσκουρους την συμφωνιαν των ἁπαντων, De Pythagorica vita cap. 28 i.f. Es ist eine Erscheinung, die sich auf Erden zumeist nicht über den Nullpunkt des ARISTOTELES erheben kann, den HELVÉTIUS als allgemein gültig anerkennt, De l'esprit III 14: »Il n'est donc plus d'amitié; on n'attache donc plus au mot d'ami les mêmes idées qu'on y attachait autrefois; on peut donc en ce siècle s'écrier avec Aristote: O mes amis! il n'est plus d'amis.« Wozu er noch anmerkt: »J'aurai contre moi leurs clameurs, et malheureusement j'aurai pour moi l'expérience.« In dem altmodischen aber immer noch schönen Drama des METASTASIO, Wo er »Alexander in Indien« darstellt, sagt König Poros, II 1 Ende:
L'unico ben, ma grande,
Che riman fra' disastri agl' infelici,
È il distinguer da' finti i veri amici.
Und so wägt denn die alte Regel in Ost und West und der ganzen Himmelsrose mit dem leichtesten Feingehalt richtig ab:
Freunde in der Not
Hundert auf ein Lot.
Kein Zweifel aber, daß trotz alledem auch heutzutage noch ab und zu einmal in der Praxis das Yankee-Wort sich bewähren mag: Friend in need, friend indeed; wie mir ROMAN WOERNER bezeugt, amico verificatore delle favole antiche. Doch am schönsten der Spruch, mit dem Wanderers Sturmlied anhebt, in fünffacher Folge, immer gesteigert: »Wen du nicht verlässest, Genius« – der ist sicher, der bedarf keiner Freunde; wohl zu erkennen als die Wiedergeburt einer attischen Gnome, die uns der Rhodier ANDRONIKOS in seinem Kommentar zur Nikomachischen Ethik, Buch IX Kapitel 10 am Anfang, aufbewahrt hat:
Ὁταν ὁ δαιμων ευ διδῳ, τι δει φιλων;
Wie herrlich entsprechend Gotamo dieses Verhältnis erkannt und dargetan hat, ist im 2. Absatz der 957. Anmerkung gezeigt.
930 Die Verehrung, Hingabe und Dankbarkeit den Lehrern und Meistern gegenüber ist eine der Grundlagen der vedischen Kultur; in der Manusaṃhitā II 225 in den Spruch gefaßt: ācāryo brahmaṇo mūrtiḥ, »der Meister ist das Brahma selbst«, d.i. das sichtbar verkörperte Brahma, die leibhaftig gewordene höchste Wesenheit. Dieser edelste Anthropomorphismus, der ebenso klar aus unserem Text oben hervorleuchtet, ist von Kankhārevato in den Liedern der Mönche v. 3 irdisch vereinfacht worden:
Die Wissenschaft Vollkommner magst erkennen,
Gleichwie man Fackeln mitternächtig wahrnimmt:
[896] Sie leihen Licht, verleihen Aug' und Einsicht,
Gewißheit wirkend jedem der hinzukommt.
Ein Bild wunderbar ähnlich erneut im Merchant of Venice, V gegen die Mitte:
That light, we see, is burning in my hall.
How far that little candle throws his beams!
So shines a good deed in a naughty world.
Das ist die Seite, die der gewöhnlichen Welt zugekehrt ist, und die auch oben Singālako dem Bürgersohn zu zeigen war. Die eigentlichen Nachfolger, die Jünger im Orden, hat Gotamo, wie das immer das besondere Merkmal seiner Lehre ist, von allem Glauben an Autorität freigesprochen: kein Meister und dessen Worte waren zu verehren, nur was sie selbst durchdacht, selbst erkannt, selbst verstanden hatten war zu beherzigen, Mittlere Sammlung S. 295 und oft. Als Gegenstück zur Belehrung, die dem Bürgersohn zuteil wird, kann man daher die Ansprache an die Jünger betrachten, im Saṉyuttakanikāyo ed. Siam. IV 168-170 (PTS IV 136-138, fehlerhaft), wo in echt gotamidischer Weise zugleich ein gewisser Humor die Bedeutung vertieft. »Ohne Schülertum, ihr Mönche«, sagt da der Herr, »wird dieses Asketenleben geführt, ohne Meistertum. Wer als Mönch, ihr Mönche, ein Schüler ist und einen Meister hat, der fühlt sich leidend, nicht wohl; wer als Mönch, ihr Mönche, kein Schüler ist und keinen Meister hat, der fühlt sich glücklich und wohl. Wie aber, ihr Mönche, fühlt sich der Mönch als ein Schüler mit einem Meister leidend und nicht wohl? Da hat, ihr Mönche, ein Mönch mit dem Auge eine Form gesehn, mit dem Ohr einen Ton gehört – mit dem Geist einen Gedanken erkannt, und es steigen ihm üble, unheilsame Dinge auf, Erinnerungen ergreifen ihn wieder, sie machen ihn zu ihrem Schüler: ›sie schulen ihn ein, die üblen, unheilsamen Dinge‹, darum wird er ›eingeschult‹ genannt: sie bemeistern ihn: ›es bemeistern ihn die üblen, unheilsamen Dinge‹, darum wird er ›bemeistert‹ genannt. Also, ihr Mönche, fühlt sich der Mönch schülerhaft und bemeistert leidend und nicht wohl. Wie aber, ihr Mönche, fühlt sich der Mönch nicht als ein Schüler und ohne Meister glücklich und wohl? Da hat, ihr Mönche, ein Mönch mit dem Auge eine Form gesehn, mit dem Ohr einen Ton gehört – mit dem Geist einen Gedanken erkannt, und es steigen ihm keine üblen, unheilsamen Dinge auf, keine Erinnerungen ergreifen ihn wieder, sie können ihn nicht mehr zu ihrem Schüler machen: ›sie schulen ihn nicht mehr ein, die üblen, unheilsamen Dinge‹, darum wird er ›nicht eingeschult‹ genannt; sie können ihn nicht mehr bemeistern: ›es bemeistern ihn nicht mehr die üblen, unheilsamen Dinge‹, darum wird er ›nicht bemeistert‹ genannt. Also, ihr Mönche, fühlt sich der Mönch uneingeschult und unbemeistert glücklich und wohl. Ohne Schülertum, ihr Mönche, wird dieses Asketenleben geführt, ohne Meistertum. Wer als Mönch, ihr Mönche, ein Schüler ist und einen Meister hat, der fühlt sich leidend, nicht wohl; wer als Mönch, ihr Mönche, kein Schüler ist und keinen Meister hat, der fühlt sich glücklich und wohl.«
931 sāmikam anukampanti mit S. – Der Gedanke, daß die Natur dem hold ist, der ihr liebevoll entgegenkommt, daß sie also Gleiches mit Gleichem vergilt, stammt aus den alten Upanischaden: so z.B. versprechen die Altarfeuer dem jungen Priester, der sie jahrelang treu bedient hat, daß auch sie ihm in dieser Welt und in jener Welt gern zu Dienste stehn wollen, Chāndogyopaniṣat IV 10-13; und in der Bṛhadāraṇyakā IV 2, 5 erklärt Yājñavalkyas dem Könige Janakas: sarvā di aḥ sarve prāṇāḥ, »alle Himmelsgegenden: alle Atemzüge«. Im Anschluß an solche Lehren sind es also auch bei uns oben [897] die Himmelsgegenden, die dann zugleich als Menschen verkörpert werden, sichtbar erscheinen als die Umgebung des Gönners und Wohltäters. Da geht denn hier schon das Sprichwort »Tal amo, tal criado« restlos auf. Diese Empfindung und Erfahrung, das Einigsein mit dem All, ist es eben auch, die aus dem Liede Angulimālos widerklingt, jenes berüchtigten Räubers und Mörders, der sich die Fingerlein, das sind die Ringe der Erschlagenen, um den Hals kränzte und daher so genannt wurde, der »grausam war, gräßlich wie die Höllengründe«, und der beim Meister zum entsühnten Heiligen sich umwandelt, Mittlere Sammlung 657-665: er konnte nun von sich sagen: »Seitdem ich in heiliger Geburt geboren bin weiß ich nicht, daß ich mit Absicht ein Wesen des Lebens beraubt hätte«, er konnte diesen Wahrspruch so augenfällig bezeugen, wie er es wirklich getan (S. 662), er durfte wohl, einsam zurückgezogen, das Heil der Erlösung erfahrend, endlich folgende Weise verlauten lassen:
Die Lüfte sollen lauschen meinem Sange
Und lieblich wehen um den Auferwachten,
Die Lüfte sollen grüßen mir die Menschen,
Die Großen, die sich nach der Wahrheit sehnen.
Den Lüften tu' mein Lied ich kund,
Das Lob der Liebe, der Geduld:
O wehet nieder, neigt euch her
Und tragt die Wahrheit weiter dann!
Die Lüfte, alles was atmet und lebt, die Himmelsgegenden waren ihm nun Freund geworden, wie er ihnen. Dem Kommentar zu dieser Stelle, die auch in den Liedern der Mönche v. 874f. wiederkehrt, war ein tieferes Verstehn versagt: daher er die disā nicht als die Himmelsgegenden, wie bei uns oben von di , di ā, sondern als die Feinde, von dviṣ, dviṣas, erklärt, mit welchen sich Angulimālo nunmehr zu versöhnen sucht. Aber der erbauliche Scholiast brauchte seinen Geist nicht besonders anzustrengen oder gar an unser entscheidendes Gegenstück oben zu denken um auf die rechte Spur zu kommen: es hätte genügt die unmittelbar vorangehenden zwei Strophen Angulimālos zu beachten, wo der Heilige, bevor er die Himmelsgegenden anspricht, sich selber dem Monde vergleicht, der aus Wolkennacht hervorbricht und die finstere Welt durchleuchtet. CAROLINE RHYS DAVIDS, M.A., in ihrer kürzlich erschienenen Fortsetzung der »Psalms of the Early Buddhists«, London 1913, p. 323, hält zwar den Kommentar mit den Feinden für richtig und meint, die Ansprache an die Himmelsgegenden oder die Lüfte wäre »gänzlich im Stil und in den Worten der deutschen romantischen Dichter des letzten Jahrhunderts« gehalten: was ihr spaßig vorzukommen scheint. Daß aber die Romantiker, in begeisterten Augenblicken, auch solche Anklänge gefunden haben, daran ist Angulimālo doch wohl unschuldig; während sein Exeget mir freilich auch beim klassischen Texte gar wenig oder oft nur jenes Verständnis zu verraten pflegt, bei dem man versucht wird mit WALTER SCOTT zu fragen: »and what does he say, that exquisite critic in beauty and blanc-mange?« – So starke Genossenschaft mit sich und der Natur zu bewahren war dem Inder längst Pflicht [898] und Lohn zugleich geworden. Es ist dies eine Geistesrichtung, die sich bei allen indogermanischen Edlen der Vorzeit, seien sie auch sonst unbeholfen und zottig verwildert gewesen, da und dort immer wieder als stammväterlich aufspüren läßt, als untrügliches Kennzeichen ihrer Art und Mitbrüderschaft, von alters her. Recht erfreulich zeigt es sich z.B. in dem tapferen, urwüchsigen Bericht über RADBOT, den Herzog der Friesen, Deutsche Sagen der Brüder GRIMM No. 446, wo zahlreiche weitere Belege angegeben sind. Als der heilige WOLFRAM, heißt es da, den Friesen das Christentum predigte, brachte er endlich RADBOT, ihren Herzog, dazu, daß er sich taufen lassen wollte. RADBOT hatte schon einen Fuß in das Taufbecken gestellt; da fiel ihm ein vorher zu fragen, wohin denn seine Vorfahren gekommen wären, ob sie bei den Scharen der Seligen oder in der Hölle seien? Sankt WOLFRAM antwortete: »Sie waren Heiden, und ihre Seelen sind verloren.« Da zog RADBOT schnell den Fuß zurück und sprach: »Ihrer Gesellschaft mag ich mich nicht begeben; lieber will ich elend bei ihnen in der Hölle wohnen, als herrlich ohne sie im Himmelreich.«
932 dinnādāyino mit S etc., nachher sukatakammakarā.
933 Eine verwandte Stelle hierzu findet sich im Anguttaranikāyo XI No. 16: »Wird liebreich, ihr Mönche, Herzensablösung zu wirken begonnen, geübt, gepflegt, ausgeführt, ausgebildet, angewendet, durchgeprüft, durchaus entrichtet, so ist eine elffache Fördernis zu erwarten: und was für eine elffache? Wohl schläft man ein, wohl wacht man auf, hat keinen bösen Traum, Menschen sind hold, Nichtmenschen sind hold, Himmlische beschirmen, kein Feuer, Gift oder Stahl greift an, eilig einigt sich das Gemüt, das Antlitz wird heiter, unverstört kommt man zu sterben, und wer nicht zum Letzten durchgedrungen ist gelangt in heilige Welt empor. Wird liebreich, ihr Mönche, Herzensablösung zu wirken begonnen, geübt, gepflegt, ausgeführt, ausgebildet, angewendet, durchgeprüft, durchaus entrichtet, so ist diese elffache Fördernis zu erwarten.«
934 samapekkhanti paṇḍitā S. – Singālako scheint wirklich beigetreten und später als Jünger wohlbekannt worden zu sein, da unter dem Titel »Vater Singālo« in den Liedern der Mönche eine Strophe überliefert ist, No. 18, die wahrscheinlich ihm zugehört: denn der Name Singālo, Singālako, ṉngāras, ṉngārakas, war damals selten und kommt bei uns anderweitig überhaupt nicht vor. Er entspricht dem athenischen EROTIAS, auch unserem altdeutschen LIEBHARDT. Ein kleiner Ort rngāraṃkoṭam, Liebhardtstal, reich an geschichtlichen Überlieferungen, besteht noch heute an den Ausläufern der östlichen Ghats, im Bezirk von Vizagapatam.
935 Der Text dieses und des mit dazugehörigen 20. Stückes unserer Sammlung ist in tibetischer Fassung nach CSOMA KÖRÖSIS Analyse von FEER im Mdo-sde des Bkah-hgyur bestätigt worden, 5. Abteilung 30. Band No. 15-16, fol. 543-564: Annales du Musée Guimet, Paris 1881, vol. II p. 288. Im chinesischen Kanon ist hiervon nur das 20. Stück bisher aufgefunden, das dort als No. 19 der Längeren Sammlung gezählt wird, nach ANESAKIS Konkordanz in den Transactions of the Asiatic Society of Japan, vol. XXXV part 3, Yokohama 1908, p. 37.
Abstammung, Entwicklung und Geschichte all jener vielen Geister ist in den Anmerkungen 625-643 nach den verschiedenen Richtungen hin beglaubigt. Die allgemeine Naturgeschichte der Himmelsboten insbesondere ist in der Anmerkung 592 behandelt. Mit dieser, aus Indien auch uns überkommenen Schar sind wir schon seit älteren Zeiten einigermaßen bekannt geworden. Es sind die Engel oder αγγελοι, die Göttergesandten, Himmelsverwandten, die gelegentlich, wie oben wieder sich zeigen wird, in ihrem gemächlichen Fluge und weilenden Zuge als ein purpurn [899] und grün entsprießender paradiesischer Frühling dahinschweben um Staub zu beleben, liebreich allen Naturen freundliche Spuren zu wirken streben, beim Klingen und Schwingen einer überirdisch beglückenden Zaubermusik, die freilich in mephistophelischen Ohren zunächst nur als Mißton und garstiges Geklimper oder allenfalls auch wie der Mückenchoral im Hörselberg widerklingt, den jeder hören kann. Der Gesang wurde schon in den vedischen Hymnen oft vernommen, so in der Atharvasaṃhitā III 26, mit dem herrlichen Vorspiel:
Ye syāṃ stha prācyāṃ di i hetayo nāma,
devās teṣāṃ vo agniriṣavaḥ,
te no mṛḍata te no 'dhi brūta,
tebhyo vo namas tebhyo vaḥ svāhā.
Um einen Ton tiefer zu hören bei der Huldigung an die Schlangengeister, im Mantrabrāhmaṇam 1. Stück des 2. Buches: mit den Gegenstrophen in den Bruchstücken der Reden, merkwürdigerweise auch da im 1. Stück des 2. Buches. Im Vinayapiṭakam ist der Gesang zu einer gewöhnlichen Schlangenbeschwörung herabgesunken, Cullavaggo V 6, ebenso im Jātakam, No. 203 usw. In der Mitte stehn die liturgischen Gebräuche des Gṛhyasūtram, z.B. bei Gobhilas III 7. Im ursprünglichen Sinne aber haben noch die Sirenen solche Gesänge verstanden, im Reigen der Mondnacht, Faust 8075-8077:
Sind Götter! Wundersam eigen,
Die sich immerfort selbst erzeugen
Und niemals wissen, was sie sind.
Vielfarbig verschieden und doch wiederum ein und dasselbe, wie die Trimūrti oder auch das Chaos del tri per uno bei MERLINO COCCAJO, kommt ihnen insgemein der irradiante Vergleichsbegriff mit der Sonne zu, den AURELIUS PRUDENTIUS in seiner Hamartigeneia gibt: einig ist sie und doch zugleich Licht und Wärme und Lebenskraft. Oder man könnte, nach dem Eingang unserer 19. Rede wohlgewitzigt, auch sagen, es sei nur ein Schein und Abglanz, der »tief in der Nacht in immer hellerem Schimmer den ganzen Umkreis im Gebirge am Geierkulm« erglitzern läßt, ein Flimmern und Leuchten im Traum der Mittsommernacht, wo alle die raunenden Robingoodfellows und fairies im Chore singen und sagen:
If we shadows have offended;
Think but this, (and all is mended,)
That you have but slumber'd here,
While these visions did appear.
And this weak and idle theme,
No more yielding but a dream,
Gentles, do not reprehend;
If you pardon, we will mend.
Und der Pardon wird denn wirklich vom Erhabenen schweigend gewährt, so daß der indische Oberon alsbald der Elfen schönste Pflicht erfüllen und seinen Unversehrbaren Schutz anbringen kann. Ob nun aber dieser Vorgang damals genau und geradeso stattgefunden hat oder nicht, darf uns billigerweise gleichgültig bleiben. Wir können auch hier nur der Meinung beipflichten, die der heilige NEILOS auf Sinai in einem seiner Briefe ausgesprochen hat, kurz wieder gegeben von SCHIWIETZ, Das morgenländische Mönchtum II 54: »wir verwerfen nichts von dem, was wirklich geschehen und geschichtlich [900] überliefert ist. Aber da wir die Welt sind (επειδη ἡμεις εσμεν ὁ κοσμος), so beziehen wir das, was vor Zeiten geschehen ist, noch heute auf uns selbst und ziehen Nutzen daraus. Denn heute gibt es keinen Joseph, keine Ägypterin, keinen König Ezechias, keinen Verräter Judas usw.; aber wenn wir einen enthaltsamen Menschen sehen, so nennen wir ihn Joseph, wenn wir ein ehebrecherisches Weib sehen, so nennen wir sie Ägypterin ... Wenn du hiernach alle unsere geistigen Deutungen beurteilst, so wirst du keineswegs an uns Anstoß nehmen. Alles also, was typisch geschehen und von den Alten vollbracht worden ist, wende auf dich selbst an« usw. – In der bildenden Kunst ist die Szene solcher huldigender Götter – und Geisterscharen zumal auf den Freskogemälden gern dargestellt worden, in Indien sowohl, wie es die Grotten von Ajaṇṭā zeigen, als in allen buddhistischen Kulturländern. Schöne, besser erhaltene Beispiele der Art hat GRÜNWEDEL im Januar 1906 im östlichen Turkestan entdeckt, in der großen Schlucht von Ming-Oei, südwestlich von Kuchar: wiedergegeben in seinem Folioband über die »Altbuddhistischen Kultstätten in Chinesisch-Turkistan«, Berlin 1912, Blatt 107/8. GRÜNWEDEL beschreibt sie zutreffend als »prächtige, im ganzen wohlerhaltene Landschaftsbilder, bestehend aus aufsteigenden Bergreihen«. Wolken senden rote zuckende Blitze aus, Teiche erheitern die Gegend, bunte Blumen, stilisierte Bäume; dazwischen mancherlei Getier, Elefant und Tiger, Eber und Gazelle, Pfau und Fasan u.a.m.: und rings im Reigen die Göttergestalten, Götterpaare mit Aureolen, himmlische Harfenspieler, Lautenschläger, Blumenspender, wundersame Genien und Geister, während mitten im Gebirge der Mönch, in Schauung vertieft, dasitzt. Eine Komposition, zart gedacht und reich ausgeführt, wie ein Bildnis nach unserem Unversehrbaren Schutz. Anordnung, Einteilung, alles bevormundet stark die, etwa 900 oder 1000 Jahre später geschaffene, Thebaïs auf dem Camposanto zu Pisa; doch steht die Kunst jener altindischen Meister und ihrer Schulen auf einer höheren Stufe der Entwicklung. So außerordentlich schön und mächtig sich damals diese Blüte entfaltet hatte, so rasch ist leider auch hier der Verfall gewesen. Vom 7. Jahrhundert an war die Malerei in Indien wie erstorben, oder nur mehr zu einem immer tiefer sinkenden rohen Handwerk herabgekommen; bis sie endlich in der Gegenwart, bei künstlich angefachter Begeisterung, in einen argen akademischen Pantsch ausgeartet ist, ohne das Aroma einer Beziehung zur einstigen hohen Kultur. Belege sind die 32 Gemälde heutiger indischer Meister und Principals of the Calcutta School of Art und so weiter, in ANANDA K. COOMARASWAMYS Myths of the Hindus and Buddhists, London 1913, als ungewollte Karikaturen veröffentlicht,
to hang
Quite out of fashion, like a rusty mail
In monumental mockery.
Es ist dies eine Erscheinung, die wir ja ebenso außerhalb Indiens, in China und Japan, beobachten können: auch dort ist die strenge ernste Pracht unrettbar untergegangen, schlechteste westliche Rüpelkunst gilt nun als der Nachahmung wert – als ob es sich dabei auch bloß um die Übernahme und Nutzbarmachung von Drähten und Kabeln, Bomben und Torpedos handelte. Auf so einen Principal of Art paßt im besten Fall doch nur was DEMOSTHENES von AISCHINES sagte: er sei ein tragierender Affe, τραγικος πιϑηκος. Wie denn auch hier wieder im besonderen sich bestätigt, was JUVENAL uns auf seiner zehnten kostbaren Obstschale gleich als die erste Frucht seiner Erfahrung darbietet, die Erkenntnis des Weltgesetzes, das von den Säulen des Herkules bis zu den Palmen am Ganges und überall herrscht:
[901] Omnibus in terris, quae sunt a Gadibus usque
Auroram et Gangen, pauci dinoscere possunt
Vera bona atque illis multum diversa, remota
Erroris nebula.
936 Vergl. unsere 23. Rede S. 399 nebst Anm. 707. Die feierliche Vorstellung mancher der hochgeborenen Herrschaften, die ganz nach höfischer Sitte erst ihre Visitkarte abzugeben, will sagen: ihren Namen und Stand dem verehrten Einsiedler anzuzeigen für schicklich erachten, erinnert in gewisser Weise an jenen verwandten huldigenden Besuch, als ALEXANDER sich dem DIOGENES zu erkennen gab mit den Worten: »Ich bin Alexander der große König«, worauf allerdings der griechische Weltpilger sich nicht enthalten mochte zu erwidern: »Und ich Diogenes der Hund«, nach DIOG. LAERT. VI 60. Der indische Asket hat jedoch so billige Scherze verschmäht und nur, kaum merklich, gelächelt. Daher ist wiederum, bei einer ähnlichen Gelegenheit, sehr fein ausgeführt in den Liedern der Mönche v. 628-630 und 1082 bis 1086, am Ende gesagt:
Vom Götterkreise sanft gegrüßt
Erglänzte Sāriputto licht;
Da kam nun Kappino heran
Und ließ ein Lächeln sehn, der Mönch.
Denn andere können ja Götter nicht sehn: wie auch in unserer dritten Rede, S. 63, ein hochmächtiger blitzhändiger Geist nur von den Zuständigen und sonst nicht bemerkt wird. Es entsteht also auf Anlaß einer paradoxen und daher unerwarteten Subsumtion, nach SCHOPENHAUERS trefflicher Erklärung, jene Inkongruenz zwischen Begriff und Anschauung, die, plötzlich wahrgenommen, ein Grauen erzeugt oder – Lächeln, wie bei uns hier; und wie auch bei Prospero, als er den nur ihm sichtbaren Ariel wieder zu den Elementen entläßt: Be free, and fare thou well! Vielleicht noch schöner zu merken wenn bei Fingal gesungen wird: »Ghosts fly on clouds, and ride on winds«, said Connal's voice of wisdom, »they rest together in their caves, and talk of mortal men.« Solche Szenen haben die altindischen Bildner in der Skulptur wundervoll darzustellen vermocht: s. Anm. 649 das Relief von Sikri. Über diese und dergleichen Verhältnisse haben wir einen schönen, sogar volkstümlich gewordenen Spruch, den man gelegentlich heute noch zu hören bekommt, nach dem Subhāṣitārṇavas:
Der Kenner lächelt mit dem Blick,
Die Zähne zeigt man insgemein,
Der Bauer wiehert, wenn er lacht,
Und nichts belacht der Denkerfürst.
Nach Sankt BERNHARD: Nam iuxta sapientem, amictus corporis, et risus dentium, et gressus hominis, enunciant de illo.
937 Hierzu Lieder der Mönche v. 490 u. 536. – Es ist, wie bei GRIMBLOT schon erkannt ist, sabbadukkhā panudanam zu lesen; vergl. noch Lieder der Mönche Anm. 69.
938 Mit M und GRIMBLOT tejanā apisuṇā 'tha zu lesen; vītasārado, einer, der den Jahren entkommen, der Zeit entgangen ist. Mit anderen Worten also einer, der wirklich erreicht hat was dem gewöhnlichen Menschen nur als Wahn vorschwebt; oder nach dem köstlich naiven Bekenntnis in einem Briefe der Me. DE SEVIGNÉ an Mr. DE BUSSY, IV, No. 45, so ausgesprochen: »si je pouvois vivre seulement deux-cens ans, [902] je deviendrois la plus admirable personne du monde.« Was da die geistvolle Frau, ohne Zweifel mit einem Seitenblick auf damals beliebte astrologisch-horoskopische Tändeleien, halb scherzhaft gesagt hat, wird aber von den modernen Galahadisten und Makrobiotikern furchtbar ernst genommen, nach deren Begriffen das Ziel des Menschen nicht von der Qualität sondern von der Quantität bestimmt wird und nichts weniger wäre als den Jahren zu entkommen, vielmehr der Lebensfähigkeit möglichst kumulierte Jahrzehnte wie einer verkalkten Trichinenkapsel gewährzuleisten; wobei man es immerhin, bei gutem karma, so weit bringen kann wie jener berühmte Grammatiker in Rom, von dem PIETRO DELLA VALLE am Ende seines Briefes vom 1. August 1626 erzählt, er habe noch im 115. Lebensjahr bei bester Laune und Gesundheit Tag um Tag eifrig weitergelehrt und immer neue, sehr nützliche und lesenswerte Abhandlungen geschrieben: »ma non ha ancor mai dato fuori in istampa cosa alcuna.«
939 Vergl. 15. Rede S. 228 die Götter brahmischer Kreise einig an Denkart usw.
940 Zu Indanāmādi cf. Anm. 630.
941 Verwandte Stellen hierzu Bruchstücke der Reden Anm. 544.
942 Sutaṃ ne tam abhiṇhaso zu lesen. Mit der gleichen Strophe schließt der Gesang auch ab, dessen Hauptthema in der Epanalepsis gegeben ist, die außer an diesen beiden Stellen noch zweimal vorkommt. Ähnlich ist die Figur in unserem 20. Stück bei Kumbhīro angewandt, S. 357f., besonders mächtig aber in den Bruchstücken der Reden v. 1136 bis 1140. Gern wird im Epos ihre bedeutende Wirkung bemerkt, z.B. Rāmāyaṇam I 52, 7f.; wie sie auch der Ilias wohlbekannt ist, II 671 etc., und ebenso im Faust 7484f. dem Hörer nachhaltenden Eindruck macht. Bei Pāṇinis ist das der āmreḍitasamāsas.
943 Ein solches Reisgericht ähnlich in der 27. Rede, S. 122f., tuṇḍikīro = tuṇḍikerī ist eine melonenartige Gurke, Momordica monadelpha Roxb., unter dem Namen Balsamkürbis, Balsamgurke bekannt.
944 Über Wettrennen usw. Bruchstücke der Reden Anm. 300.
945 Ariṭṭhanemi ist der Herr des himmlischen Sonnenrades, nach den Liedern im Ṛk und Atharvan, der rasche Sieger im Kampfe gegen die finsteren Geister: Wunsch um Wünsche zu erlangen wird seinem Glanze gehuldigt, wo auch immer der Mensch zur Sonne blickt. Denn: Was ist herrlicher als Gold?, fragte der König. Das Licht, antwortete die Schlange, nach GOETHE im Märchen; gleichwie Vi vāmitras der Seher, in der Ṛksaṃhitā III, 5, 10, singt: Das liebe Licht, der Herrlichkeiten höchste. Der heilige Jünger freilich, der sein Herz liebreich abgelöst hat, strahlt selbst soweit wie die Sonne, wann sie im letzten Monat der Regenzeit, im Herbste, nach Zerstreuung und Vertreibung der wasserschwangeren Wolken, am Himmel aufgeht und alle Nebel der Lüfte strahlend verscheucht und flammt und leuchtet: und jedwede andere Tugend und Tüchtigkeit kommt der liebreichen Herzensablösung auch nicht in einem Sechzehntel gleich, Itivuttakam No. 27. Dieses herrliche Bild ist einem anderen hohen Geiste ein paar Jahrtausende später ebenso leuchtend aufgegangen, der Freundin MICHELANGELOS, VITTORIA COLONNA, die es ihrem 122. Sonett als Initial verliehn hat:
Com' il calor del gran pianeta ardente
Dissolve il ghiaccio, ovver borea turbato
Fuga le nubi, così 'l sole amato
Nessun basso pensier nel cor consente.
Ähnlich mit unserem Gleichnis, aber keineswegs künstlerisch gesehn, nur apokalyptisch vergröbert, heißt es in den im Äthiopischen erhaltenen Visionen SCHENUTES III [903] 30: »Wahrlich, wahrlich, sage ich euch, das Licht des Antonius, des Vaters von euch Mönchen allen, wird so stark sein wie zwölf Sonnen«, nach GROHMANNS Übersetzung, Zeitschr. d. deutschen morgenländ. Gesellsch. 67, 225. Weil eben die liebreiche Herzensablösung alle Sonnenherrlichkeit überstrahlt, wird im Anguttaranikāyo I, 6, 3 gesagt: »Wenn ein Mönch, ihr Mönche, auch nur solang als ein Augenblick andauert liebreichen Sinn hegt, so wird er, ihr Mönche, Mönch genannt: nicht leer ist sein Schauen, er folgt der Weisung des Meisters, vollbringt das Gebot, nicht umsonst empfängt er Atzung im Lande – geschweige von denen, die es da weitgebracht haben.« Ein Abglanz und Angedenken dieser ungewöhnlichen Meinung vom liebreichen Gemüt des Mönchs ist auch heute noch auf Zeilon an den entlegeneren Orten zu finden, wenn man über den von Haus zu Haus still abwartend hingetretenen sagt piṇḍaṃ sahati, »er duldet Almosen«: wobei sahati, er duldet, erträgt, sehr fein zugleich den Begriff der Gunst einschließt, die der Empfänger der Spende durch die Annahme gewährt. Vergl. Epigraphia Zeylanica, ed. DON MARTINO DE ZILVA WICKREMASINGHE, vol. I, p. 102 n. 9; auch den Subhāṣitārṇavas, bei BÖHTLINGK 2 4489: bodhayanti na yācante bhikṣāhārā gṛhe gṛhe, »sie künden sich an, nicht erbitten sie, die von Almosen leben, von Haus zu Haus«. Ein Wort der Bitte läßt ja der echte Mönch nie verlauten: das wäre gegen den vinayo, der Sitte des Ordens zuwider. Und GRACIAN hat den Spruch dazu: Antes el pedir es morir para los hombres de bien, Dem Bitten geht Sterben voran bei edlen Menschen, Criticòn III 6 im letzten Absatz. Den höchsten Grad dieser Freiheit und Unabhängigkeit des Pilgers zeigt ein Spruch Kassapos an, Lieder der Mönche v. 1057:
Als Atzung alter Speise Rest,
Urin von Rindern als Arznei,
Als Bett der Bäume Wurzelwerk,
Den fahlen Fetzenrock als Kleid:
Wer das vermocht hat über sich
Ist Bürger in der ganzen Welt.
So sprach Kassapo der Große, als Fürst der Askese in rauher Zucht, wie er sich dann in v. 1087 nennt. Zweihundert Jahre später hat im Westen bekanntlich DIOGENES als erster einen solchen Begriff des Weltbürgertums aufgestellt und verwirklicht, vierhundert Jahre nach diesem im Westen wie im Osten APOLLONIOS von Tyana ihn erneut mit dem Wort »Es ist schön die ganze Erde als Vaterland zu betrachten«, Epist. 44; und ihm nach hat noch ein Jahrhundert später als letzter im Bunde dieser Weltbürger der rauhe TERTULLIAN gesagt: Unam omnium Rempublicam agnoscimus, mundum. Apologeticus, cap. 38. In unseren Zeiten und Ländern ist endlich als letzter Nachfahre jenes Weltbürgertums nur mehr, etwa noch am Gestade der Marosch, der indische Abkömmling anzutreffen, den LENAU so echt vor Augen führt:
Der Zigeuner wandert, arm und heiter,
In die Ferne, Fremde, fort und weiter;
– – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Wenig brauchend kommt und geht
Dieser fiedelnde Asket. –
Das zarte Empfinden, daß Geben seliger ist als Nehmen, kann man sogar im alltäglichen Verkehr im Osten gelegentlich schon bemerken. Wenn irgend möglich, gibt auch der Mönch lieber als er nimmt, noch heute wie Ariṭṭhanemi, der Herr des Sonnenrades. [904] Als ich nach längeren Studien am Daḷadāmāligāva in Kandy von SURIYAGODA SOṆUTTARA Terunnānse, dem Leiter dieser altsiṇhalesischen Klosterschule, mich verabschiedete, beschenkte mich der edle Gastfreund noch obendrein mit Palmblatthandschriften und brachte auch ein großes, auf Holz gemaltes Buddhobildnis herbei um es mir zur Erinnerung mitzugeben: trotz alles Sträubens mußte ich es endlich annehmen, weil der gute alte Herr sagte, er selbst erwürbe sich durch die Spende Verdienst – er der Mönch, mir einem Laien gegenüber, immer schenkensfroh wie die Sonne.
946 Mit S etc. vassā yato patāyanti.
947 Sārī, eine Dohle mit klangvoll wechselnder Stimme, ist Eulabes musica. Vergl. Lieder der Mönche Anm. 1232. Sārī, die Holde, wie wir sagen könnten, ist dann als Rufname den Mädchen gern beigegeben worden, allgemein am Festland und weit über Indien hinaus: auch eine Sitte, um mit dem braven Indophilen FERNÃO BRANDÃO zu reden,
que foy nacida
e escolhida
antre as filhas de Siam.
Vorher mit S etc. kukkuṭakā. – Nach irdischem Maße verwirklicht ist »Kuveros lichter Lotusteich« vielleicht am schönsten anzuschauen im Hofe der Tempelburg von Madura, inmitten der hochragenden vierundachtzigtausendfach glitzernden Götterpracht rings umher. Er wird der Goldene Lotusweiher genannt, umrahmt von Säulengängen mit herrlichen Freistiegen zum Wasserspiegel herab: edel und unverändert erhalten im rein indischen Baustil, der eben hier, an diesem schlichten Wasserbecken, zu Füßen einer ungeheuer üppigen Felsenkuppelskulptur, zur glücklichsten Wirkung gelangt. Solcher Göttersitz, devālayo, ist der südliche Gegenschein zu Beowulfs weox under wolcnum weord myndum, er wuchs unter Wolken würdig empor. Zwei gute Aufnahmen gibt SIEVERS in seinen Bildern aus Indien, Berlin 1911, Tafel 13f. Auf eine Reihe ähnlicher, mit erlesenem Geschmack ausgeführter Anlagen aus früheren Zeiten, von denen heute freilich nur mehr Ruinen erübrigen, ist in der Anm. 539 hingewiesen. Landschaftlich sehenswert gelegen ist der, auch noch in seinem ursprünglichen Stil tadellos erhaltene, heilige Teich am Fuße des Berges von ravaṇabeḷgoḷa in Maisūr.
948 Das Bersten des Hauptes, als eine Folge begangener Schuld, ist altvedischer Glaube; vergl. Bruchstücke der Reden v. 983f. nebst Anm. Der Ausdruck war schon seit alter Zeit zu einer bloß figürlichen Redewendung geworden, nur gebraucht um den Tod anzudeuten. Ursprünglich ist aber gemeint, das Haupt müßte so jemandem infolge unerträglicher Angst oder Reue zerplatzen, wie z.B. Bei ākalyas, als er dem Yājñavalkyas nicht zu antworten wußte, Bṛhadāraṇyakopaniṣat III 9, 28. Er wird vom Schlage getroffen, der Schlag hat ihn gerührt, sagen wir; übertragen, wie oben, dirumperutur dolore, stomacho, risu, bei CICERO, SENECA, APULEIUS: vor Schmerz, Neid, Lachen müßte man bersten, sich zutode ärgern, sich totlachen. Auch Ulysses malt dieses Bild aus, Troilus I 3:
The large Achilles on his press'd bed lolling
From his deep chest laughs out a loud applause,
. . . . . . . . cries: O! enough, Patroclus; –
Or give me ribs of steel! I shall split all
In pleasure of my spleen.
[905] 949 Zu den Schattengeistern im Akazienhain cf. 23. Rede S. 421f. – S hat Sivako, Muccalindo, Pañcālacando.
Die ganze Sangesweise ist nach der Melodie Sarvadevā jine vare vorzutragen. Siehe Bruchstücke der Reden Anm. 656, auch oben Anm. 625 und 643; atapathabrāhmaṇam XII 3, 4 das Nārāyaṇīyam. Es ist die Begleitung zur Erkenntnis der »Vollendeten Einzigkeit« des Überwinders, wie das der priesterliche Weise Hārītas am Ende seiner saṃhitā als pāramaikāntyam angibt, im Dharma āstrasaṃgrahas, Kalkuttaer Ausgabe S. 409. Die beste Erläuterung bietet wohl das Upaniṣadbrāhmaṇam des Jaiminis I 14, ed. OERTEL, New-Haven 1894, p. 93: Na ha dūredevatas syāt. yāvad-dha vā ātmanā devān upāste, tāvad asmai devā bhavanti. atha ya etad evaṃ vedā 'ham eva sāmā 'smi, mayy etās sarvā devatā ity: evaṃ hā' sminn etās sarvā devatā bhavanti: »Nicht soll er götterfern sein. Soviel er da in sich den Göttern huldigt, soviel kommen ihm da der Götter zu. Und wer da nun dieses derart weiß ›Ich eben bin derselbe, in mir sind all jene Gottheiten‹: so kommen also in ihm all jene Gottheiten vor.« Wenn daher rī (Fortuna) von den anderen Menschen immer nur entäußert wird, bahirdheva vai rīh, so hat er sich, auf solche Weise, der rī eben nicht entäußert, tathā ha na bahirdhā riyaṃ kurute: I 4. Etwa acht Jahrhunderte nach dem vedischen Seher hat bei uns einer der tiefsten Menschenkenner ganz dasselbe große Geheimnis entdeckt und verkündet, die Offenbarung aus dem eigenen Herzen, hat JUVENAL seine zehnte Symphonie oder Satura lanx – Tuben tönen herüber zu seinem Päan, fern, sordiniert – im gleichen Ton ausklingen lassen:
semita certe
Tranquillae per virtutem patet unica vitae.
Nullum numen abest, si sit prudentia; nos te
Nos facimus, Fortuna, deam coeloque locamus.
Und von den Gebirgen und Gletschern, über die der Cherubinische Wandersmann hinschreitet, hallt es da II 71 fröhlich zurück, was ich einmal so wiedergehört habe:
Essentialis homo viget instar aeternitatis,
Omnibus externis integra quae caret.
GRACIAN war damals zugegen, und er stimmte mit ein: Recibe este Señor como à padre, hermano, amigo, abogado, fiador, padrino, protector, amparo, sol que te alumbra, puerto que te recibe, asilo que te acoge, centro donde descansas, principio de todos tus bienes, medio de tus felicidades, y fin de tus deseos, por todas las eternidades. El Comulgador, Meditación XLIX. Und von Wolke zu Wolke ist der Chor a capella weitererklungen, dahingetragen auf den rauschenden Flügeln unseres Ewigen Jünglings, im Junius-Nacht-Gedanken JEAN PAULS: »Aber ein Halt steht im Welten-Meer, der Gedanke, daß wir den Gott in uns tragen, der selber wieder das Sonnen-All in sich trägt, und daß in diesem Ur- und Übergeiste, der zugleich Allgegenwart der Zeiten und der Räume ist, sich alle Weltengrößen, Weltenfernen, und Ichsunzahlen sälig sammeln, nähren und durchdringen müssen.« Auch Merlin der Alte, im leuchtenden Grabe, hat mir einst eine ähnliche Kunde geraunt; wie eben doch nur solcher Geisterton auf den Höhen der indischen Lüfte und in den Tiefen ägyptischer Grüfte von jeher schon als der rechte Klang und Widerklang im Herzen vernommen wurde. Diese innere Welt zu verwirklichen kann aber, nach dem Sinn unserer Sangesweise, nur dem gelingen, der alle Götter und Teufel, alle bösen und guten Geister und Zauberkreise in sich eingezogen und aufgelöst hat; nicht bevor er sich wie PORSON die Welt recht angesehn hat als des Teufels Spaziergang, the Devil's Walk, oder noch besser mit[906] VOLTAIRE erkannt hat »C'est ce monde-ci qui est l'enfer«, und nicht anders wie so klar als vollkommen indisch empfunden GUERZO DI MONTESANTI um 1230, es anzeigt:
Or non vi sento piu alcun remeggio
Sol che veder finire l'universo:
E quest' è l'argomento che in ciò veggio,
Da po' che il bene è profondato o perso;
Null' altra cosa domando nè cheggio,
Che il fragil mondo vederlo sommerso.
Das ist des Denkers dies novissimus, ohne gestern und morgen, ohne oben und unten, das allein mögliche Jüngste Gericht. Darum heißt es am Schlusse der Tri ikhibrāhmaṇopaniṣat (v. 162, vergl. Maitryupaniṣat VI 34):
Yathā nirindhano vahniḥ
svayam eva pra āmyate:
Wie Feuer, wo kein Holz mehr ist,
Erlischt er endlich in sich selbst.
950 Ein gleicher Vorgang zu Beginn der 53. Rede der Mittleren Sammlung S. 388. Von derselben Sitte berichtet JAMBLICHOS im Leben des PYTHAGORAS, Kapitel 5: die Halle auf Samos, wo der Weise gelebt und gelehrt hatte, wurde nach seinem Weggang von den Bürgern zu ihren Versammlungen benutzt, weil sie meinten, daß man über schöne, gerechte, zuträgliche Dinge gerade an dem Orte beratschlagen solle, wo der gewirkt hatte, der auf all dies bedacht war. JAMBLICHOS sagt weiterhin, PYTHAGORAS selbst pflegte in einer Höhle außerhalb der Stadt den größten Teil des Tages und der Nacht zu verbringen, um einsam und ungestört seine Gedanken auszudenken. Als er aber dann später die freie Pilgerschaft nach dem Beispiel der ihm vorangegangenen Denker als das bessere Teil erkannt und erwählt hatte und von Samos nach Kroton gezogen war, weil er dort noch geeignetere Jünger zu finden hoffte, sollen sich nach und nach gegen sechshundert seiner Lehre und seiner Gemeinschaft angeschlossen haben – bei Gotamo sind meist fünfhundert genannt, wie auch oben zu Beginn unserer Rede – und sie wurden Koinobiten geheißen. Aus dem ganzen spricht uns eine geläuterte Stimmung an, die der gleichzeitigen gotamidischen bis ins einzelne gemäß ist.
951 Die Maller wurden nach ihrem geistigen Ahnherrn Vasiṣṭhas als Vāseṭṭher angesprochen: cf. Anm. 467.
952 Mit S etc. acirapakkantesu Pāveyyakesu Mallesu.
953 Siehe 29. Rede, Anm. 862, dann Anm. 863.
954 Wie oben in der 29. Rede, Seite 506., ed. Siam. 141, mit S richtig zu lesen Tattha sabbeh'eva sangāyitabbaṃ na viparītabbaṃ. Gotamo selbst empfiehlt den Jüngern seine Worte genau zu beachten, den richtigen Gebrauch zu überliefern: denn »wenn die Worterklärung, ihr Mönche, nicht recht festgelegt wird, ist auch der Sinn nicht recht zu verstehn«, dunnikkhitṭassa bhikkhave padavyañjanassa attho pi dunnayo hoti, Anguttaranikāyo, Pañcakanipāto No. 156 und oft. Vergl. ebenda No. 169 Ānandos Gespräch mit Sāriputto, und in den Liedern der Mönche v. 1027-1031 wie er, als Wortbewahrer, das Thema behandelt: Der Reinheit Wurzel ist das Wort. Daher auch der Ausdruck sotāpanno, einer, der das Gehör erlangt hat = wer gehört hat, für den Beginn der Jüngerschaft, [907] Mittlere Sammlung S. 356, nebst Anm. 37. Ganz ähnlich hatte PYTHAGORAS als den ersten Grad, die erste Stufe des Jüngers die Hörerschaft bezeichnet, die Zuhörer sind die ersten dem Orden schon Beigetretenen: Hi prorsus appellabantur intra tempus tacendi audiendique ακουστικοι, GELLIUS, Noct. Attic. I 9. Der sotāpanno ist wie der ακουστικος der geistige und geistliche Bruder des rotriyas, des vedischen Wortbewahrers, der das Wissen von seinem Meister gehört und erworben hat, und der es nun selbst wieder Wort um Wort richtig überliefert. Darum ist das Gehör das wichtigste Mittel, der glücklichste Sinn des Menschen: alles Gelingen, alles Zutreffen ist zunächst dadurch bedingt, nach der Bṛhadāraṇyakopaniṣat VI 2, 4: »Wer da weiß was Zutreffen ist, zu trifft ihm was für Wunsch er sich wünscht. Das Gehör aber ist Zutreffen: denn im Gehör sind alle die Wissen zusammengetroffen. Zu trifft ihm was für Wunsch er sich wünscht, der das weiß.« Was die Upanischad hier so mächtig betont, das wird uns auch schon nach den bloßen Lautgesetzen begreiflich, wenn die schulgerechte Erfahrung sich meldet, gar nicht mystisch, nur phonetisch wirksam, wie etwa im vorletzten āṇḍilya atasūtrīyaṃ bhāṣyam, der ruti gemäß: abdaḥ ābdapramākaraṃam, »der Laut bestimmt die verlautende Norm«; und die Kunde des Pāli hebt mit dem Spruch an: Attho akkharasaññāto, »Durch Silben wird der Sinn erkannt«, Kaccāyanappakaraṃam 1, vergl. KUHNS Beiträge zur Pāli-Grammatik, Berlin 1875, p. I, und Mittlere Sammlung p. XXVIII. Bei solcher altüberlieferten und gepflegten Wertschätzung des Wortes verstehn wir nun um so besser warum Gotamo zum Hörer seiner Botschaft also spricht und ihn kennzeichnet: tassa te dhammā sotānugatā honti, vacasā paricitā, manasānupekkhitā, diṭṭhiyā suppaṭividdhā, »er hat da die Sätze dem Gehör nach verfolgt, dem Worte nach geprüft, im Geiste untersucht, mit Erkenntnis fein durchdrungen«: Anguttaranikāyo, Catukkanipāto No. 191, ed. Siam. p. 258; und Tikanipāto No. 68, p. 257: Etadatthā bhikkhave kathā, etadatthā mantanā, etadatthā upanisā, etadatthaṃ sotāvadhānaṃ: yadidam anupādā cittassa vimokkho, »Das ist, ihr Mönche, der Zweck des Gesprächs, das ist der Zweck der Beratung, das ist der Zweck bei der Sitzung, das ist der Zweck beim Gehörgeben: und zwar um ohne Anhangen das Gemüt abzulösen.« – Über die Wirkung des treffenden Ausdrucks auf das Gemüt hat in unserer Zeit ein feiner Menschenkenner, der freilich neuerdings von der gewöhnlichen rohen Menge seiner Landsleute meist überschrien wird, die allgemein gültige und insbesondere auch hierhergehörige Bemerkung gemacht: Wenn man nur nachdenkt, so wird man finden, daß es auf der ganzen Welt nichts gibt, das so gewaltig und zugleich so ohnmächtig ist wie ein Wort: TURGENJEFF, Frühlingswogen, Kap. 21 Ende (übers, v. LANGE, RECLAM). Die Erfahrung ist alt und hat den beredtesten Ausdruck im Mythos von Orpheus, dessen melodischem Worte nichts widerstehn konnte, kein Stahl und kein Stein, kein Tiger und kein Drache, wie das auch Proteus, einer der beiden Edelleute von Verona, III gegen Ende, bestätigt:
Whose golden touch could soften steel and stones,
Make tigers tame, and huge leviathans
Forsake unsounded deeps to dance on sands.
955 Alle Wesen bestehn durch Nahrung, sabbe sattā āhāraṭṭhitikā, ist ein Kernspruch, den Gotamo den Jüngern zum eifrigen Nachdenken anheimgegeben, Anguttaranikāyo, Dasakanipāto No. 27: »Ein Ding ist es, ihr Mönche, an dem der Mönch durchaus überdrüssig, durchaus abgewandt, durchaus abgelöst, durchaus des letzten Zieles ansichtig, durchaus über den Sinn sich klar geworden noch bei Lebzeiten dem Leiden ein Ende machen kann: und an was für einem Dinge? Alle Wesen bestehn durch Nahrung. [908] An diesem einen Dinge, ihr Mönche, kann der Mönch durchaus überdrüssig, durchaus abgewandt, durchaus abgelöst, durchaus des letzten Zieles ansichtig, durchaus über den Sinn sich klar geworden noch bei Lebzeiten dem Leiden ein Ende machen.« Wer erkennt, daß alles Dasein immer nur durch gegenseitiges Sichverzehren bestehn kann – aññamaññakhādikā ettha vattati, »einer den anderen auffressen ist da der Brauch«, Mittlere Sammlung 962: ebenso weit zu fassen wie Timons Wort »each thing 's a thief« – wer das innig verstanden hat, kann wohl der Weisheit letzten Schluß bald finden. In diesen Zusammenhang gehört dann noch die Ausführung im Saṉyuttakanikāyo, ed. Siam. vol. V p. 81f. (PTS V 64f.): »Gleichwie etwa, ihr Mönche, dieser Körper durch Nahrung besteht, durch Nahrung bedingt ist, ohne Nahrung aber nicht bestehn kann: ebenso nun auch, ihr Mönche, sind die fünf Hemmungen durch Nahrung bestanden, durch Nahrung bedingt und können nicht ohne Nahrung bestehn. Was ist aber, ihr Mönche, die Nahrung um einen noch nicht entstandenen Wunscheswillen sich entwickeln und einen schon entstandenen sich weiter entfalten und ausbreiten zu lassen? Man kann sich, ihr Mönche, Schönes vorstellen: was dabei an seichten Gedanken mehr und mehr aufgeht, das ist die Nahrung um einen noch nicht entstandenen Wunscheswillen sich entwickeln und einen schon entstandenen sich weiter entfalten und ausbreiten zu lassen. Was ist aber, ihr Mönche, die Nahrung um eine noch nicht entstandene Gehässigkeit sich entwickeln und eine schon entstandene sich weiter entfalten und ausbreiten zu lassen? Man kann sich, ihr Mönche, Widerliches vorstellen: was dabei an seichten Gedanken mehr und mehr aufgeht, das ist die Nahrung um eine noch nicht entstandene Gehässigkeit sich entwickeln und eine schon entstandene sich weiter entfalten und ausbreiten zu lassen. Was ist aber, ihr Mönche, die Nahrung um eine noch nicht entstandene matte Müde sich entwickeln und eine schon entstandene sich weiter entfalten und ausbreiten zu lassen? Man kann sich, ihr Mönche, unrüstig, lässig, schläfrig fühlen, nach dem Essen behaglich, trägen Geistes werden: was dabei an seichten Gedanken mehr und mehr aufgeht, das ist die Nahrung um eine noch nicht entstandene matte Müde sich entwickeln und eine schon entstandene sich weiter entfalten und ausbreiten zu lassen. Was ist aber, ihr Mönche, die Nahrung um einen noch nicht entstandenen stolzen Unmut sich entwickeln und einen schon entstandenen sich weiter entfalten und ausbreiten zu lassen? Es gibt, ihr Mönche, eine geistige Unruhe: was dabei an seichten Gedanken mehr und mehr aufgeht, das ist die Nahrung um einen noch nicht entstandenen stolzen Unmut sich entwickeln und einen schon entstandenen sich weiter entfalten und ausbreiten zu lassen. Was ist aber, ihr Mönche, die Nahrung um eine noch nicht entstandene Zweifelsucht sich entwickeln und eine schon entstandene sich weiter entfalten und ausbreiten zu lassen? Es gibt, ihr Mönche, bezweifelbare Dinge: was dabei an seichten Gedanken mehr und mehr aufgeht, das ist die Nahrung um eine noch nicht entstandene Zweifelsucht sich entwickeln und eine schon entstandene sich weiter entfalten und ausbreiten zu lassen. Gleichwie etwa, ihr Mönche, dieser Körper durch Nahrung besteht, durch Nahrung bedingt ist, ohne Nahrung aber nicht bestehn kann: ebenso nun auch, ihr Mönche, sind diese fünf Hemmungen durch Nahrung bestanden, durch Nahrung bedingt und können nicht ohne Nahrung bestehn.« Durch Nahrung aufgefüttert entwickeln sich also die fünf Hemmungen, die die Weltauflösung vereiteln. »Die Schlechtigkeit ist die Nahrung der Welt«, hat später einmal ein Neuplatoniker kurz angedeutet, κακια κοσμου τροφη, STOBAIOS lib. I cap. 43 No. 1, ed. HEEREN 1792 p. 706; Gotamo aber hatte die gesamte Lebensmittelkunde der Welt in dem Doppelsatz angegeben, Bruchstücke der Reden v. 747: »›Was irgend an Leiden sich entwickelt ist alles aus Nahrung [909] entstanden‹: das ist der eine Anblick; ›Ebendiese Nahrung vollkommen restlos vernichten läßt kein Leiden entwickeln‹: das ist der andere Anblick.
Was irgend auch an Leid entsteht,
Die Nahrung geht im Grunde vor;
Die Nahrung wo man schwinden läßt,
Nicht kann da Leid entwickelt sein.«
An diese wohlbekannte Reihe von Begriffen erinnert Sāriputto im Text oben, indem er den Hauptsatz über das eine Ding anführt: »Alle Wesen bestehn durch Nahrung«, mit dem Zusatz »alle Wesen bestehn durch Unterscheidung«. Hatte der Vordersatz die Grundlage der Daseinsmöglichkeit angegeben, so weist dann der Nachsatz auf die Lehre von der Erkennbarkeit hin: daß nämlich die Eigenart eines jeden Lebewesens in der Unterscheidung besteht, daß ein Wesen sein nichts anderes heißt als sich selbst von fremden verschieden wahrnehmen, von anderen unterschieden, d.i. mit Unterscheidung behaftet sein. Vergl. die sehr wichtigen Belege hierzu im letzten Absatz der Anm. 349. Das eigentümliche Merkmal eines Wesens ist also, der Erkenntnislehre gemäß von außen betrachtet, das sich von anderen verschieden erkennen, gesondert erkennen, die unterscheidende Tätigkeit, die Unterscheidung: und die wurzelt im Nichtwissen, im Unwissen, in der avijjā, Mittlere Sammlung 872: aus Unwissen entstehn Unterscheidungen; ist aber Unwissen ohne Überrest aufgelöst, lösen sich Unterscheidungen auf. Der von Sāriputto angeführte Nachsatz »alle Wesen bestehn durch Unterscheidung« ist demnach gleichbedeutend mit dem anderen berühmten Kernspruch Gotamos »Alle Wesen sind in Unwissen«, sabbe pāṇā avijjā (avijjāya): ein Ausspruch, den der Meister in einer Unterredung mit bekannten, hochangesehenen Pilgern, wie Annabhāro, Varadharo, Sakuludāyī und vielen anderen, als die erste der vier Wahrheiten der Heiligen bezeichnet, Anguttaranikāyo, Catukkanipāto No. 185, ed. Siam. p. 146, PTS 170: »Alle Wesen sind in Unwissen«; ein Heiliger, der also die Wahrheit, keine Unwahrheit sagt, führt nun Gotamo weiter aus, wird sich darum nicht als einen Asketen oder Heiligen betrachten, wird sich darum weder besser noch minder bedünken und auch nicht gleichstellen: jedoch was daran wahr ist, das hat er verstanden und wird an den Wesen nicht mehr aufgebracht werden, wird ihnen mit Erbarmen begegnen. Denn er weiß ja: »Alle Wesen sind in Unwissen.« (Die Variante avajjhā für avijjā, auch in den chinesischen Kanon eingedrungen, ist auf die mangelhafte, seichte Erklärung des Kommentars zurückzuführen, dem das instrumentale etc. avijjā entgangen war: der Ausspruch ist, in unserem Zusammenhange betrachtet, vollkommen klar. OLDENBERG meint zwar, in seinen »Studien zur Geschichte des buddhistischen Kanon«, Nachrichten der Göttinger Ges. d. Wissensch. phil.-hist. Kl. 1912 Heft 2 S. 172: »Offenbar muß es avajjhā heißen: und so gibt die siamesische Ausgabe in der Tat«, aber leider läßt gerade hier einmal, ausnahmsweise, diese sonst so vortreffliche Textgestalt im Stich; die altüberlieferte Fassung ist keine »Unrichtigkeit der Lesung«, kein »schon an sich bedenklicher Wortlaut«, vielmehr zeigt sich die ursprüngliche rechte Überlieferung des Pāli gegenüber den schlecht beratenen späteren Bearbeitern gerade an solchen schwierigeren Stellen im hellsten Glanze.) Auch dieser Merkspruch Gotamos war somit oben von Sāriputto zugleich angedeutet worden: alle Wesen bestehn durch Unterscheidung, s.v.a. »Alle Wesen sind in Unwissen«. Eine weitere Erklärung zu diesem Unwissen ist im Saṉyuttakanikāyo gegeben, III 43f. (PTS 48f.), wo Gotamo den jungen Sono belehrt: »Wer auch immer als ein Asket oder ein Priester bei der Vergänglichkeit, Leidigkeit, Wandelbarkeit der Form, [910] des Gefühls, der Wahrnehmung, der Unterscheidungen des Bewußtseins sich etwa für besser hält, oder anderen sich gleichstellt, oder sich für min der hält: was wär' es anders als ein Nichtsehn der Wirklichkeit? Darum aber gilt eben durchaus von der Form, vom Gefühl, von der Wahrnehmung, von den Unterscheidungen, vom Bewußtsein, von vergangenem, künftigem, gegenwärtigem, innen und außen, ob grob oder fein, ob gemein oder edel, ob fern oder nahe, überall: ›Das gehört mir nicht, das bin ich nicht, das ist nicht mein Selbst‹: so ist das, der Wirklichkeit gemäß, mit vollkommener Weisheit anzusehn.« Umfang und Inhalt der Unterscheidungen ist ebenda III 57 (60) festgestellt: »Was sind aber, ihr Mönche, die Unterscheidungen? Sechs gibt es, ihr Mönche, der Verstandeskreise: Verstand bei Formen, Verstand bei Tönen, Verstand bei Düften, Verstand bei Säften, Verstand bei Tastungen, Verstand bei Gedanken. Das heißt man, ihr Mönche, die Unterscheidungen. Wenn sich Berührung entwickelt, entwickelt sich Unterscheidung: wenn sich Berührung auflöst, löst sich Unterscheidung auf.« Vergl. später noch Anm. 978.
956 »Zweierlei Ansichten sind das, ihr Mönche«, sagt Gotamo, »die Ansicht vom Dasein und die Ansicht vom Nichtsein. Alle die Asketen oder Priester, ihr Mönche, die der Ansicht vom Dasein zugetan sind, der Ansicht vom Dasein huldigen, der Ansicht vom Dasein anhängen, die werden durch die Ansicht des Nichtseins verstimmt. Alle die Asketen oder Priester, ihr Mönche, die der Ansicht vom Nichtsein zugetan sind, der Ansicht vom Nichtsein huldigen, der Ansicht vom Nichtsein anhängen, die werden durch die Ansicht des Daseins verstimmt. Alle die Asketen oder Priester, ihr Mönche, die dieser zwei Ansichten Anfang und Ende, Lust und Leid und Überwindung nicht der Wirklichkeit gemäß verstehn, die gierigen, hassenden, irrenden, noch durstigen, noch anhangenden, unwissenden, bald verzückten bald verstimmten, denen Sonderheit behagt und Sonderheit gefällt: die werden nicht erlöst von Geburt, Altern und Sterben, von Sorge, Kummer und Schmerz, Gram und Verzweiflung, werden nicht erlöst, sag' ich, vom Leiden. Aber alle die Asketen oder Priester, ihr Mönche, die dieser zwei Ansichten Anfang und Ende, Lust und Leid und Überwindung der Wirklichkeit gemäß verstehn, die gierlosen, haßlosen, irrlosen, die nicht mehr durstigen, nicht mehr anhangenden, wissenden, weder verzückten noch verstimmten, denen keine Sonderheit behagt, keine Sonderheit gefällt: die werden erlöst von Geburt, Altern und Sterben, von Sorge, Kummer und Schmerz, Gram und Verzweiflung, werden erlöst, sag' ich, vom Leiden.« Mittlere Sammlung S. 74f., auch 127, desgl. im 49. Itivuttakam und oft in den Bruchstücken der Reden, siehe Register s.v. Sein und Nichtsein, z.B.v. 801:
Nach beiden Enden wer da nimmer hinspäht,
Nach Sein und Nichtsein, hüben oder drüben:
Ein jedes Suchen ist in ihm ersunken,
Bei Dingen wo man lassen muß Erlangung.
Hier, wenn irgendwo, kann man mit KANT weiter erklären: während der empirisch bedingte Mensch einen Verstand hat, der diskursiv ist, seine Vorstellungen also Gedanken, nicht Anschauungen sind, und diese in der Zeit aufeinander folgen, und sein Wille immer mit einer Abhängigkeit der Zufriedenheit von der Existenz seines Gegenstandes behaftet ist; so ist dagegen der vollendete Asket, als höchster Herr bei Gott und Mensch, zu einem reinen Verstandeswesen geworden, mit einem Verstande, der nicht mehr denkt, sondern anschaut, und mit einem Willen, der auf Gegenstände gerichtet ist, von deren Existenz seine Zufriedenheit nicht im mindesten abhängt: [911] lauter Eigenschaften, von denen wir uns gar keinen Begriff, zum Erkenntnisse des Gegenstandes tauglich, machen können. Kritik der praktischen Vernunft, I, 2. Buch II, No. 7, Mitte. – Zu den vorbemeldeten Asketen, die der Ansicht vom Nichtsein zugetan sind, durch die Ansicht des Daseins verstimmt werden, sind im Abendland vor allen Meister ECKHART und seine Jünger zu zählen, unter denen SEUSE stärker als jeder andere sich ausspricht. Es muß sein Non sum, sagt er sechzehnmal in einer seiner wundervollen Reden, der so genannten 2. Predigt. Nur aus dem sein wollen kommt aller Jammer und alle Klage. »Das tut allein, daß wir wollen etwas sein. Ach, dies Nichtsein, das hätte in jeder Weise, an allen Orten, mit allen Leuten ganzen, wahren, wesentlichen, ewigen Frieden, und wäre das Seligste, das Sicherste und das Edelste, was diese Welt hat – und niemand will daran, weder reich noch arm, weder jung noch alt«, ed. BIHLMEYER p. 511. Bei uns oben sind Dasein und Nichtsein die Grenzpunkte jeder möglichen Betrachtung: bhavo und vibhavo, oder bhavo und abhavo, als Antithese. Wohl davon zu unterscheiden ist der andere vibhavo, bei der Darstellung des dreifachen Durstes, in der gesteigerten Triade kāmataṇhā bhavataṇhā vibhavataṇhā: Geschlechtsdurst, Daseinsdurst, Wohlseinsdurst. Da ist vi nicht die Präposition der Trennung sondern die der Verstärkung. Diese je nachdem entgegengesetzte Geltung ein und derselben Präposition ist im indischen Sprachgebrauch häufig anzutreffen, allbekannt; sie hat analog wie bei unserem ver- nach einander gegenüberstehenden Seiten sich entwickelt, vergl. vermögen, vergnügen – verderben, vergessen, und in doppelter Bedeutung: versehn, versprechen u.a.m. Vibhavo als Entfaltung, Macht, Herrschaft, Fülle, Glückseligkeit, gibt die überaus oft vorkommende gewöhnliche Vorstellung, siehe die Belege in der Anm. 697, während der Gegensinn dazu, vibhavo = abhavo, recht selten erscheint, nur wie in der Antithese bei uns oben. Dieses doppelte Verhältnis hatte OLDENBERG einst erkannt, S. 130 der 1. Aufl. seines »Buddha«, ist aber davon abgekommen und redet nun immer, 6. Aufl., S. 147, durch ein Mißverständnis verleitet, vom gesteigerten vibhavo als von einer Vergänglichkeit, nennt die vibhavataṇhā den »Vergänglichkeitsdurst«, ohne den genetisch bedingten Unterschied noch zu merken, verkürzt also beliebig den Begriff in der Triade auf den in der Antithese. Eine mehr und mehr vertiefte Übung und Vertrautheit mit der Ausdrucksweise der älteren, und nicht nur buddhistischen, Texte wird aber bald das schlecht angebrachte einseitige Zustutzen als eine gewaltsame Beschränkung erkennen, die dem indischen Sprachcharakter, wie schon gesagt, so fremd wie dem deutschen ist.
Der Daseinsdurst, bhavataṇhā, und seine weitere Entwicklung zum Wohlseinsdurst, vibhavataṇhā, ein Dürsten, das eben auch noch die höchsten himmlischen Seligkeiten durchzieht, ist entsprechend von DANTE gedeutet worden; jedoch mit dem sehr bezeichnenden Unterschied, daß er es nicht als Steigerung sondern als Gegensatz ansieht: der Daseinsdurst ist der natürliche Durst, der unersättlich ist, »la sete natural che mai non sazia«, Purgatorio XXI 1; der Wohlseinsdurst aber ist der angeborne und immerwährende Durst nach dem göttlich gestalteten Reiche, »la concreata e perpetua sete del deiforme regno«, Paradiso II 19. Daß freilich auch dieser überweltliche alleredelst verfeinerte Wohlseinsdurst immer noch Durst und daher von Übel ist, eine solche Erkenntnis war ihm leider innerhalb seiner katholischen Sphäre verborgen geblieben. Denn da gilt dieser Durst als göttliche Gnade, und die betreffende Stelle wird z.B. in der kostbaren, noch unveröffentlichten Handschrift der Divina Commedia von 1416, in Florenz bei DE MARINIS, Katalog III, No. 3, so glossiert: »La concreata e perpetua sete cioe lo desiderio che a l anima humana di ritornare a ddio onde e uenuta lo [912] quale desiderio e messo da ddio nell anima nella sua creatione naturalmente in pero che questo e instinto di inclinatione nostrale. E pero dice concreata cioe in sieme creata coll anima e perpetua in pero che sempre dura questo desiderio nell anima e non puo fare l anima ch a meritato il sommo bene ella nol uogla ma alchuna uolta lo npaccia lo talento e la uogla come fu decto di sopra.« Über die Umfangsmöglichkeit und den Zentralbegriff des Durstes als springenden Kernpunkt, handelt Anm. 698; vergl. Anm. 684 und damit noch einen anderen trivialen aber triftigen Spruch des LORENZO DE MEDICI IL MAGNIFICO, aus dem Simposio ovvero i beoni, II v. 9:
E come Antèo le sue forze reprende
Cadendo in terra, come si favella,
La sete mia dal ber più sete prende.
Auch FREIDANK wußte hier wohl Bescheid: er führt, wie aus dem Morgenlande mitgebracht, gleichsam eine verkürzte Lesart an, verdichtet sie in den Reim:
Es trinken tausend eh den Tod,
Eh einer stürbe in Durstes Noth.
Zugehörig ist ferner die tiefgründige Bemerkung im Faustbuch von 1587 S. 51, als Faust wissen will, was die Hölle sei, und ihm der Geist Mephostophiles als ersten von einem Dutzend grausiger Zustände den angibt: die Hölle wird genannt höllisch und durstig, weil der Mensch zu keiner Erquickung und Labung kommen kann. Gegensatz war bei den Griechen das himmlische Labsal, das den menschlichen Durst auf ewig stillt: das Nektar, als νεκ-ταρ den Tod überwindend, ϑειον ϑαυμαστον ακηρατον το ανεκαϑεν. Erwähnt sei schließlich noch der uralte sprachliche Zusammenhang, nach welchem taṇhā, tṛṣṇā, tarṣas von tṛṣyati mit τερσομαι usw., und somit auch mit unserem dürsten stammverwandt ist.
957 Was unter Schamhaftigkeit und Bescheidenheit zu verstehn sei zeigt Anguttaranikāyo, Navakanipāto No. 11 (vol. IV p. 376), wo Sāriputto so über sein Betragen Rechenschaft ablegt: »Gleichwie etwa, o Herr, ein Tschandālenknabe oder ein Tschandālenmädchen mit einem Krug im Arme, in zerfetztem Gewande ein Dorf oder eine Stadt betretend, gar niedergebeugt im Gemüte dahinwandelt: ebenso nun bin ich, o Herr, einem jungen Tschandālen ähnlich im Geiste geworden, im weiten, tiefen, unbeschränkten, von Grimm und Groll geklärten.« Sich etwas bedünken, Anerkennung wünschen, ausgezeichnet werden, ist einem Mönche schlimmste Gefahr, zäheste Fessel. »Wer sich, ihr Mönche, allein mit dem schönsten Weibe das Gemüt nicht mehr umgarnen läßt, er läßt sich von Erfolg, Ehre und Ruhm das Gemüt umgarnen«, sagt der Meister zu den Jüngern, Saṉyuttakanikāyo, ed. Siam. vol. II p. 211, PTS 235. Vergl. die umfassende 39. Rede der Mittleren Sammlung und noch Anguttaranikāyo, Dasakanipāto No. 105: »Das Wissen, ihr Mönche, geht der Erlangung heilsamer Dinge voran, gleich aber folgt Schamhaftigkeit und Bescheidenheit.« Aus derselben Erfahrung spricht SEUSE von der »Demütigkeit, die da ist aller Tugend ein rechter Anfang«, ed. BIHLMEYER p. 506. Damit ist aber nichts anderes gemeint als jenes zarte Empfinden, das Meister ECKHART ein Jungfrauengemüt nennt und als Phase des zunehmenden Menschen beschreibt, eine Vorstufe zur Stetigkeit des Mannes, die jeder Asket erst überschritten und tüchtig erprobt haben muß, nach dem niedersten Teil seines äußeren Menschen, ed. PFEIFFER p. 346. Diese zutiefst empfundene Demut und Scham, in der sich der Asket, wie Sāriputto so anschaulich zeigt, von jedem Dünkel, jedem Stolz, jeder Überhebung auf immer abkehrt, gleichwie der [913] unterste Diener, die ärmste Magd: das ist das ewig Weibliche, das ihn hinanzieht. Darum eben soll der Mönch auch mütterliche, schwesterliche, töchterliche Liebe im Gemüt entwickeln und ausbilden, nach Gotamos Anweisung im Saṉyuttakanikāyo vol. IV 138-140 (PTS 110-112): »Geht hin, ihr Mönche, an mutterstatt mögt ihr ein Muttergemüt euch erwerben, an schwesterstatt mögt ihr ein Schwestergemüt euch erwerben, an tochterstatt mögt ihr ein Tochtergemüt euch erwerben.« Es sind die Staffeln, gegründet auf dem Boden der freiwilligen und unbeschränkten Selbstverleugnung, die zur Auflösung der Persönlichkeit hinleiten, Anm. 228. Solcherart hatte auch San FRANCESCO sich das Memento gesetzt: Omnium virtutum custos et decor humilitas, bei CELANO, Vita seconda cap. LXXIX. Aber nicht allein im geistlichen Leben, in jeder höheren geistigen Gemeinschaft wird Bescheidenheit am Ende hervorleuchten, jene Schamhaftigkeit, die auch dem echten Römer wohlbekannt war, ihm ehrwürdig, heilig erschien, nach dem Spruche des PUBLILIUS SYRUS:
Ubicumque pudor est, semper ibi sancta est fides.
Und so spricht denn auch der Physiognom im Subhāṣitārṇavas, BÖHTLINGK 25688, die gleiche Erfahrung aus:
Yauvane 'pi pra āntā ye,
ye ca hṛṣyanti yācitāḥ,
nirvarṇitā ca lajjante:
te narā jagaduttamāḥ.
Obzwar noch jung schon abgeklärt,
Zu helfen andern hocherfreut,
Errötend wenn man recht sie kennt:
Das sind die Besten in der Welt.
Über die oben im Text sogleich angeschlossene treffliche Freundschaft sagt Ānando einmal zu Gotamo: »Die Hälfte ist es, o Herr, des Asketentums: treffliche Freundschaft zu hegen, treffliche Gefährten, treffliche Vertraute zu haben.« Der Meister aber antwortet: »Sage das nicht, Ānando, sage das nicht, Ānando: ist es ja doch, Ānando, das ganze Asketentum, daß man da treffliche Freundschaft hegt, treffliche Gefährten, treffliche Vertraute hat. Von einem Mönch, Ānando, der treffliche Freundschaft hegt, treffliche Gefährten, treffliche Vertraute hat, ist zu erwarten, daß er den heiligen achtfältigen Weg erkunden, daß er den heiligen achtfältigen Weg ausbilden wird. Wie aber, Ānando, kann ein Mönch, der treffliche Freundschaft hegt, treffliche Gefährten, treffliche Vertraute hat, den heiligen achtfältigen Weg erkunden, den heiligen achtfältigen Weg ausbilden? Da wird, Ānando, ein Mönch die rechte Erkenntnis erkunden, die abgeschieden gezeugte, abgelöst gezeugte, ausgerodet gezeugte, die in Endsal übergeht; er wird die rechte Gesinnung, rechte Rede, das rechte Handeln, rechte Wandeln, rechte Mühn, die rechte Einsicht, rechte Einigung erkunden, die abgeschieden gezeugte, abgelöst gezeugte, ausgerodet gezeugte, die in Endsal übergeht. Das ist, Ānando, die Art, wie ein Mönch, der treffliche Freundschaft hegt, treffliche Gefährten, treffliche Vertraute hat, den heiligen achtfältigen Weg erkundet, den heiligen achtfältigen Weg ausbildet. Darum ist das, Ānando, auch wechselweise zu verstehn, wie es eben das ganze Asketentum ist, wenn man treffliche Freundschaft hegt, treffliche Gefährten, treffliche Vertraute hat. Denn zu mir, Ānando, als dem trefflichen Freunde gekommen, werden sie, die der Geburt unterworfen sind, frei von Geburt; [914] werden sie, die dem Alter, dem Sterben, dem Kummer, Jammer, Schmerz, Gram, der Verzweiflung unterworfen sind, frei von Alter, frei von Sterben, frei von Kummer, Jammer, Schmerz, Gram und Verzweiflung. So ist das, Ānando, wechselweise zu verstehn, wie es eben das ganze Asketentum ist, wenn man treffliche Freundschaft hegt, treffliche Gefährten, treffliche Vertraute hat.« Saṉyuttakanikāyo, zu Beginn des letzten Bandes, ed. Siam. p. 2f. (PTS lückenhaft.)
958 Wer Ungebührliches begangen hat, entledigt sich der Schuld durch Bekenntnis. »Denn ein Fortschritt ist es«, sagt Gotamo (in unserer 25. Rede, oben S. 459, wie auch in der 65. Rede der Mittleren Sammlung, S. 476, und wiederholt anderwärts), »im Orden des Heiligen, ein Vergehen als Vergehn einzusehn, nach Gebühr zu bekennen, sich künftig davor zu hüten.« Ebenso hat Manus erklärt, XI 229:
Yathā yathā naro 'dharmaṃ
svayaṃkṛtvānubhāṣate,
tathā tathā tvacevāhis
tenādharmeṇa mucyate.
Sobald der Mensch gefrevelt hat
Und selbst, was er getan, gesteht:
So wird er, wie die Schlange bald
Dem Balg entschlüpft, vom Frevel frei.
Vergl. schon Sāmavidhānabrāhmaṇam I 5,15: svakarmaṇābhibhāṣeta. Diese mannhaft nüchterne Ansicht von Schuld und Bekenntnis hat bei Vermeidung jeder stürmischen Erregtheit den klarsten, wirksamsten Ausdruck erreicht. Ähnlich ist das auch dem heiligen ANTONIUS von Padua gelungen, im »Brüderlichen Rückhalt«, den er gibt: »Es soll da die Berichtigung stattfinden über Vergangenes, die Ermahnung für Künftiges; so daß man etwa mit solchen Worten sich äußern kann: Was hast du derart begangen? Doch Vergangenes ist der Ermahnung entrückt: sei also vor Künftigem auf der Hut.« Siehe Mittlere Sammlung Anm. 337, zweiter Absatz.
959 Ebenso Mittlere Sammlung S. 50. Im Anguttaranikāyo, Chakkanipāto No. 39, sind diese drei Wurzeln noch deutlicher so gezeigt: »Nicht werden, ihr Mönche, durch Werke aus Sucht, durch Werke aus Haß, durch Werke aus Irre die Götter offenbar, die Menschen offenbar, oder was irgend noch etwa eine andere gute Fährte sei: sondern es wird, ihr Mönche, durch Werke aus Sucht, durch Werke aus Haß, durch Werke aus Irre die höllische Welt offenbar, der tierische Schoß offenbar, das Gespensterreich offenbar, oder was irgend noch etwa eine andere üble Fährte sei.« Durch Werke ohne Sucht, ohne Haß, ohne Irre werden Götter und Menschen und alle noch irgend möglichen guten Fährten erkannt. – Es ist da ein sehr hoher Begriff der Menschheit gegeben, einig mit dem Rate des Göttlichen:
Edel sei der Mensch,
Hilfreich und gut!
Einig auch mit der Lehre Meister ECKHARTS und seiner Jünger: »Alles Kornes Natur meint Weizen, alles Schatzes Natur Gold, alle Gebärung meint den Menschen«, ed. PFEIFFER p. 104. Man kann hier auch wohl ein Wort des Wandsbecker Boten noch anführen, 5. Teil S. 34: »Es sind denn im Menschen die Ruinen eines großen heiligen Wesens; und es giebt ein Glück für ihn, das der Rost und die Motten nicht fressen, und das die Welt mit aller ihrer Herrlichkeit nicht geben und mit all ihrem Trotz [915] nicht nehmen kann.« Weiter schließen sich an die zahlreichen mitklingenden Stimmen aus dem Corpus juris Authenticorum, s. oben Anm. 379. Anders freilich betrachtet Kassapo den Menschen, im Durchschnitt genommen, nach der alltäglichen Erfahrung. »Die Menschen«, sagt er im Gespräch mit einem Fürsten, 23. Rede S. 403, »sind den Göttern abscheulich und als abscheulich bekannt. Hundert Meilen weit treibt Menschengeruch die Götter hinweg.« Das ist die Kehrseite, deren Anblick auch HIPPODAMAS zu dem traurigen Ausruf bewegt hatte, nach JAMBLICHOS, De Pythagorica vita 82 i.f.:
O Götter, wo kommt ihr her, woher seid ihr also geworden?
Ihr Menschen, wo kommt ihr her, woher doch so schmählich geraten?
Es ist die Betrachtung, die KRANTOR den Platoniker, Schüler des XENOKRATES, zu dem nachmals berühmten Ausspruch gebracht hat: »Von vielen und gar weisen Männern ist nicht jetzt erst sondern seit alters das Menschenlos beklagt worden: für eine Buße gehalten haben sie das Leben, und gleich schon die Geburt des Menschen für das größte Mißgeschick«, von PLUTARCH angeführt in der Consol. ad Apoll., ed. HUTTEN vol. VII p. 351, wiederholt besprochen in CIGEROS Consolatio, nach dem Zeugnis des LACTANTIUS, Divin, instit. lib. III cap. 18 § 10, cap. 19 § 14: Luendorum scelerum causa nasci homines, etc.; vergl. auch SENECAS Consolatio ad Marciam cap. 22. Von den vielen und gar weisen Männern aus dem Altertum, die schon, wie KRANTOR sagt, derselben Meinung waren, sind insbesondere zu nennen: HOMER, HESIOD, THEOGNIS, BAKCHYLIDES, EMPEDOKLES, PRODIKOS; siehe MULLACH, Fragmenta philosophorum Graecorum vol. III p. 149/50 No. 12.
Über das Böse und Gute im allgemeinen, oder besser: das Unheilsame und Heilsame, akusalam und kusalam, wie es täglich vorkommt, bei jedem Menschen innen und außen Augenblick um Augenblick sich abspielt, klärt Gotamo die Jünger so auf: »Das Unheilsame, ihr Mönche, sollt ihr lassen: man kann, ihr Mönche, das Unheilsame lassen. Wenn es, ihr Mönche, nicht möglich wäre das Unheilsame zu lassen, so würde ich nicht sagen ›Das Unheilsame, ihr Mönche, sollt ihr lassen‹; weil es aber, ihr Mönche, wohl möglich ist das Unheilsame zu lassen, darum sag' ich aus: ›Das Unheilsame, ihr Mönche, sollt ihr lassen.‹ Wenn da etwa, ihr Mönche, das Unheilsame, weil man es gelassen hat, zu Unheil und Leiden gereichte, würde ich nicht sagen ›Das Unheilsame, ihr Mönche, sollt ihr lassen‹; weil aber, ihr Mönche, Unheilsames gelassen zu Heil und Wohl gereicht, darum sag' ich aus: ›Das Unheilsame, ihr Mönche, sollt ihr lassen.‹ – Das Heilsame, ihr Mönche, sollt ihr schaffen: man kann, ihr Mönche, das Heilsame schaffen. Wenn es, ihr Mönche, nicht möglich wäre das Heilsame zu schaffen, so würde ich nicht sagen ›Das Heilsame, ihr Mönche, sollt ihr schaffen‹; weil es aber, ihr Mönche, wohl möglich ist das Heilsame zu schaffen, darum sag' ich aus: ›Das Heilsame, ihr Mönche, sollt ihr schaffen.‹ Wenn da etwa, ihr Mönche, das Heilsame, weil man es geschaffen hat, zu Unheil und Leiden gereichte, würde ich nicht sagen ›Das Heilsame, ihr Mönche, sollt ihr schaffen‹; weil aber, ihr Mönche, Heilsames geschaffen zu Heil und Wohl gereicht, darum sag' ich aus: ›Das Heilsame, ihr Mönche, sollt ihr schaffen.‹« Anguttaranikāyo, Dukanipāto No. 19. ed. Siam. p. 74f. (PTS 58 lücken- und fehlerhaft). Es ist hier, in dieser schlichten Rede, nicht mehr und nicht weniger als die Freiheit des Willens dargetan, zugleich Fundament für das allermodernste Verständnis, das erst kürzlich VERWORN angeschürft hat. Erst diesem unvoreingenommenen Manne, als einem wirklich erfahrenen Biologen, ist es geglückt uns aus dem labyrinthischen Wust einer Scholastik, der noch SCHOPENHAUER zum [916] Opfer fiel, herauszuleiten. Ja er gibt geradezu die physiologische Erklärung und Bestätigung zur praktisch freilich längst gesicherten und bewährten Kunde Gotamos, wenn er sagt: »Der momentane Zustand der Assoziationsbahnen, die sich in sehr früher Zeit bereits angelegt haben und unter denen dann bestimmte Geleise durch die Erfahrungen des Lebens, und zwar durch Lehren ebenso wie durch eigene Beobachtungen besonders ausgeschliffen sind, dieser Zustand der Assoziationsbahnen in der Großhirnrinde ist es, der die Willenshandlung determiniert, indem er über die Wege entscheidet, nach denen die zur Willenshandlung führende Erregung abläuft. Hier liegt das System von Bedingungen, das die Handlungsweise eines Menschen bestimmt, das System von Bedingungen, die in kontinuierlichen konditionalen Reihen zurückreichen einerseits bis tief in die Geschichte seiner ererbten Eigenschaften, andrerseits bis zu den ersten Anfängen seiner individuellen Erziehung. Die Vergangenheit des Menschen bedingt seine Willenshandlungen nicht minder, wie die Gegenwart mit ihrer augenblicklichen Situation der äußeren Verhältnisse.« Kausale und konditionale Weltanschauung, Jena 1912, S. 28. Solche, durch das Leben immer und überall bestätigte Erfahrung ist es, die Gotamo in den Ausspruch gefaßt hat: »der Herzensentschluß ist zu erzeugen«, alles weitere findet sich dann von selbst, stellt sich folgerecht ein, Mittlere Sammlung S. 47, »die Herzensentschließung zum Guten nenn' ich ja, Cundo, wichtig: was soll da erst von Geboten des Tuns und Redens gesagt werden!« Und beim rechten Mühn, 22. Rede S. 395f., erzeugt der Mönch auf seinen Assoziationsbahnen, auf den Geleisen seiner reichen Erfahrung je und je den bestimmten Willen, der über den Weg entscheidet, unheilsame Dinge zu meiden, heilsame zu finden versteht, so daß sie »sich festigen, nicht lockern, weiterentwickeln, erschließen, entfalten, erfüllen«. – Hier sei noch eine kleine, nicht ungehörige Berichtigung eingeschaltet. SCHOPENHAUER hat bekanntlich gern davon gesprochen, daß VOLTAIRE im reiferen Alter »die sogenannte Willensfreiheit« geleugnet habe. Damit hat er jedoch bei dem »sehr großen Manne«, wie er ihn mit Recht nennt, ganz die gleiche einseitige Auslegung angewandt wie bei GOETHE, dessen höchstes Wort zur Bestätigung der Freiheit, »Nur allein der Mensch vermag das Unmögliche«, er völlig unbeachtet gelassen; vergl. oben Anm. 879. Denn auch der Philosoph von Ferney ist es, der in einem seiner späteren Stücke, Le droit du seigneur III 1, 61/62, so spricht:
De son cœur on est maître;
J'en fis l'épreuve: est sage qui veut l'etre.
Mit Recht darf man hier auch das Wort EPIKURS berücksichtigen, es in seinem Sinne und zugleich mit den anderen großen Denkern übereinstimmend verstehn: Alles gut und böse liegt in der Wahrnehmung, παν αγαϑον και κακον εν αισϑησει, bei DIOG. LAERT. X 124 – Was der Jünger auf seinem Gang durch die Welt als heilsam und als unheilsam, als gut und als böse, wie man gewöhnlich sagt, verstehn lernt, das ist im Text oben von Sāriputto nach je drei Wurzeln befunden, auf diese zurückbezogen, der Lehre des Meisters gemäß. Hat nun ein Mensch etwas Schlechtes begangen, führt Gotamo weiter aus, so kann er sich die Folge davon sogleich zum Bewußtsein bringen, und er kann auf diese Weise die Wirkung ausgleichen, unschädlich machen, auflösen: so ist er imstande sich zu heiligem Leben zu entwickeln, er lernt die Möglichkeit verstehn das Leiden vollkommen auszutilgen. Er wird dann was er begangen schon bei Lebzeiten auskosten, so daß es ihm weiter nicht mehr viel scheinen kann. Wenn man ein Salzkorn in einen mit Wasser gefüllten Becher wirft, wird das Wasser davon salzig und untrinkbar; wirft man aber ein Salzkorn in die Fluten des Ganges, [917] werden etwa die davon salzig und untrinkbar werden? Ebenso nun auch kann sogar eine geringfügige schlechte Handlung den ungedeihsamen, engherzigen, beschränkten Menschen zugrunde richten; während einer, der sich zu üben versteht, zu erziehn versteht, sinnig zu entfalten, weise auszubilden, nicht mehr beschränkt bleibt, sich selbst erweitert, unermeßlich wird: ein Mensch der Art wird auch solch ein geringes Schlechte, das er begangen, schon bei Lebzeiten auskosten, so daß es ihm weiter nicht mehr viel scheinen kann (nānu pi khāyati bahu-d-eva, Tmesis). Anguttaranikāyo, Tikanipāto No. 101, ed. Siam. p. 324-326; Pāli Text Society No. 99 nur verglichen brauchbar.
960 Vollständig behandelt in der Mittleren Sammlung S. 878.
961 Wie Bruchstücke der Reden v. 855, 918; siehe auch oben Anm. 956. Zu vidhā, Zwieheit, die 1072. Anmerkung, gegen Ende des ersten Teils, das Zitat aus dem Anguttaranikāyo, und ebenso Saṉyuttakanikāyo III 72, PTS 81: »über die Zwieheit hinwegkommen, zur Ruhe gänzlicher Freiheit eingehn.« – Die vorangehende Einteilung in Art der Form, Art ohne Form, Art der Auflösung ist in der Bṛhadāraṇyakā unter zwei Haupttiteln begriffen: Dve vā va brahmaṇo rūpe, mūrtaṃ caivāmūrtaṃ ca: Zwei nur der Formen hat das brahma, gestaltet und auch ungestaltet, II 3, 1. Diese Doppelbetrachtung wurde ebenso von den Platonikern angewandt, auch später bei STOBAIOS, Eclog. lib. I cap. 43 No. 6 i.f.: Των γαρ οντων δει τα μεν σωματα ειναι, τα δε ασωματα, Was aber irgend ist, muß entweder körperhaft sein oder unkörperhaft. – Der Wahn, āsavo, wäre, wenn man in künftigen Zeiten vielleicht auch einmal eine rein mechanische Interlinearversion unserer Texte durchführen sollte, als »Einfließen« wiederzugeben; wobei KANT dem Wort als Taufzeuge beistehn würde, kraft seiner Ansicht, daß »wir der Natur in uns, und dadurch auch der Natur (sofern sie auf uns einfließt) außer uns, überlegen zu sein uns bewußt werden können.« Vergl. oben Anm. 764, letzter Absatz. Die Ansicht vom Einfließen der Natur als eines Wahns ist ebenso bei den Jainās zu finden, nach Aupapātikasūtram, ed. LEUMANN § 56, wo es heißt: atthi āsave, atthi saṃvare, »es gibt ein Einfließen, es gibt ein Wehr dagegen«; auch wird Nāthaputto aṇāsave genannt, »frei von Einfließen«, d.i. wahnlos, Kalpasūtram, ed. JACOBI p. 62. Obzwar nun die jinistischen Urkunden etwa tausend Jahre später als die buddhistischen gesammelt und endgültig festgestellt wurden, so ist doch diese Ansicht als die echte alte Lehre der Freien Brüder nachzuweisen; sie wird nämlich in der 101. Rede der Mittleren Sammlung ausdrücklich als die Grundlage der Lehre Nāthaputtos von dessen Jüngern vorgetragen, S. 777-784 u. Anm. 325: āyatim anavassavo, »ferner kein Zufluß«. Dieser unaufhörliche avassavo, der Zufluß oder das Zufließen von seiten der Natur, ist aber nur eine andere Wendung für āsavo, den Einfluß oder das Einfließen: weil ja der avassavo, avasravaṛ, Zufluß, als Folge von āsavo, āsravaṛ, Einfluß, gedacht ist. Nāthaputto, der Meister der Freien Brüder, hatte demnach, ganz wie Gotamo und KANT, DEN Einfluß, oder das Einfließen der natürlichen Regungen als jenen Wahn des Menschen erkannt, ohne dessen Versiegung kein Wohlsein möglich ist. Der khīṇāsavo, der Wahnversieger, hat alles Einfließen versiegen lassen, zu Ende gebracht; und dadurch ist er, genau wie KANT es mit höchster Besinnung darlegt, der Natur überlegen geworden, er hat Schritt um Schritt unermüdlich kämpfend jene Freiheit gefunden, die zu erfahren und zu verwirklichen nur dem Menschen möglich ist. Dies Versiegen der Einflüsse, āsavakkhayo, ist noch im altchinesischen Kanon trefflich wiedergegeben durch Ende des Einträufelns: stillationis finis, wie RÉMUSAT es übersetzt und erklärt hat, Foe Koue Ki, Paris 1836 p. 130; während EITEL in seinem Hand-Book of Chinese Buddhism, 2. Aufl. London 1888, p. 21, nur den mehr allgemeinen, schon übertragenen [918] und daher viel weniger anschaulichen Begriff »the finality of the stream of life« dafür ansetzt. Der erste, der dann für āsavā Einflüsse gesagt hat, ist meines Wissens SCHRADER gewesen: »Die Fragen des Königs Menandros«, Berlin [1905], S. 155, 158; und jüngst hat auch der fleißige Bhikkhu NYĀṆATILOKA (sic), einer der deutschen buddhistischen Mönche auf Zeilon, diese alte Bedeutung aus dem Kommentar hervorgeholt und ganz richtig verwertet, indem er akusalā dhammā anvāssaveyyum übersetzt »böse Dinge möchten hier einfließen«, in seinen »Reden des Buddha aus der ›Angereihten Sammlung‹ – Aṉguttara Nikāyo«, 3. Bd., Leipzig 1914, S. 17. GRIMM ist ihm nachgefolgt und stützt sich mit Recht noch auf SCHRADER als Vorgänger, Die Lehre des Buddha, München 1915, S. 206, Anm. 1. NYĀṆATILOKA hatte die Stelle der Tugendsatzung im Auge, wo der Mönch stets als Torwart der Sinne dargestellt wird, und da kann man anvāssaveyyum durch »beeinflussen würden« sehr gut wiedergeben. Bis auf einen, den ich sogleich nennen werde, haben sämtliche anderen Forscher das Wort nach ihren vorgefaßten Meinungen begrifflich auszulegen gesucht und daher immer ungehörig behandelt. So sagt BURNOUF für āsavā les souillures du vice, OLDENBERG einmal Verderbnis, ein andermal Sünde, dies dann auch PISCHEL, KERN moral infection, WARREN Depravities, RHYS DAVIDS Einmal great evils, ein andermal Intoxicants, auch wieder Intoxications und intoxicating drugs, oder auch Deadly Floods, auch taints, usw. Es ist, wie man sieht, eine je und je verschiedene, willkürliche, gewissen westlichen Vorstellungen angepaßte Interpretation, die mit der etymologischen und semasiologischen Bedeutung in krausem Zusammenhang steht. Jener einzige aber, der das Wort wirklich erkannt und es dementsprechend ohne Zwang, rein, klar verdeutscht hat, war ALBRECHT WEBER, der schon 1860 seiner Übersetzung des Dhammapadam zu v. 89 die Anmerkung beifügte: »āsavā, s. âsrava, was Einen anfließt«. Diese Wiedergabe ist so wohlgelungen, daß es noch die Frage ist, ob man, bei einer künftigen Interlinearversion, für āsavā »die Einflüsse« oder besser, d.h. noch näher, noch feiner der ursprünglichen Anschauung gemäß, »die Anflüsse« wählen wird. Der khīṇāsavo ist demnach einer, bei dem die Möglichkeit, daß ihn noch irgend etwas anfließen könnte, nicht mehr besteht.
962 Sāriputto bezieht sich hier auf die berühmte Brandparole, die Gotamo bald nach der vollen Erwachung den Jüngern nach ihrer Aufnahme gleich zu Beginn seiner Laufbahn einst auf der Feste Gayā, oben am Felsentor, gegeben hatte, Saṉyuttakanikāyo ed. Siam. vol. IV p. 23 (PTS 19, auch Vinayapiṭakam ed. OLDENBERG I No. 21): »Alles, ihr Mönche«, begann da der Meister, »ist in Brand: was alles aber, ihr Mönche, ist in Brand? Das Auge, ihr Mönche, ist in Brand, die Formen sind in Brand, das Sehbewußtsein ist in Brand, die Sehberührung ist in Brand, was auch durch Sehberührung fühlbar entsteht an Wohl oder Weh oder weder Weh noch Wohl, auch das ist in Brand: wodurch in Brand? Durch Feuer der Gier, Feuer des Hasses, Feuer des Unverstandes in Brand, durch Geburt, Alter, Sterben, Kummer, Jammer, Schmerz, Gram und Verzweiflung ist es in Brand, sage ich. Das Ohr, ihr Mönche, die Nase, die Zunge, der Leib, der Geist ist in Brand, die Gedanken sind in Brand, das Denkbewußtsein ist in Brand, die Denkberührung ist in Brand, was auch durch Denkberührung fühlbar entsteht an Wohl oder Weh oder weder Weh noch Wohl, auch das ist in Brand: wodurch in Brand? Durch Feuer der Gier, Feuer des Hasses, Feuer des Unverstandes in Brand, durch Geburt, Alter, Sterben, Kummer, Jammer, Schmerz, Gram und Verzweiflung ist es in Brand, sage ich.« Bei solchem Anblick wird der erfahrene heilige Jünger des Auges und aller Dinge überdrüssig, er wendet sich ab, löst sich los. – Ferner gehört noch hierzu die große Parabel von der Grube glühender [919] Kohlen, an der ein Aussätziger Linderung seiner Qualen sucht, und indem er das Feuer nur schmerzlich und immer ärger empfindet dabei wähnt: ›Das tut wohl‹; gleichwie man von begehrendem Dürsten verzehrt am Feuer der Begierden nur schmerzlich und immer ärger empfindet was im Genusse der Glut doch ein gewisses Behagen scheint: Mittlere Sammlung 541-543. So auch hat der Dichter das »trialfire« gesehn, Merry Wives gegen Ende:
Lust is but a bloody fire,
Kindled with unchaste desire,
Fed in heart; whose flames aspire,
As thoughts do blow them, higher and higher.
Alle drei Übel gibt der Merkspruch im Wahrheitpfad, v. 251:
Kein Feuer brennt wie Lustbegier,
Kein Fallstrick hält so fest wie Haß,
Kein Netz verstrickt wie Unverstand,
Kein Fluß rast wie der Durst dahin.
963 Mit S etc. Sant' āvuso sattā sukham uppādetvā uppādetvā sukhaṃ viharanti.
964 te santaṃ yeva santusitā cittasukhaṃ paṭivedenti mit S etc. Vergl. Anguttaranikāyo V No. 170, ed. Siam. p. 235 (PTS 202), te santaññeva tusitā sukhaṃ paṭisaṃvedenti. Das Wohl in solchen Götterbereichen wird später geprüft, Anm. 996. Hier sei zunächst das Gespräch von der letztgenannten Stelle angeführt, das sich auf jene Bereiche mitbezieht. Als der ehrwürdige Ānando einst bei Kosambī weilte, in der Gartenstiftung, wandte er sich also an den ehrwürdigen Bhaddaji, der gekommen war ihn zu besuchen: »Was ist wohl, Bruder Bhaddaji, das höchste Gesicht, was ist das höchste Gehör, was das höchste Wohl, was die höchste Wahrnehmung, was ist das höchste Dasein?« – »Es gibt, Bruder«, antwortete Bhaddaji, »einen Brahmā, den Übermächtigen, Unübermächtigten, Allsehenden, Selbstgewaltigen: sieht man diesen Brahmā, so ist das das höchste Gesicht. Es gibt, Bruder, Götter, die man die Leuchtenden nennt, die sind von Wohl durchtränkt und durchdrungen; die lassen hin und wieder einmal tief aufatmend ›O Wonne, o Wonne‹ verlauten: hört man diesen Ton, so ist das das höchste Gehör. Es gibt, Bruder, Götter, die man die Strahlenden nennt; die nehmen, beseligt, ein gar stilles geistiges Wohl in sich wahr: das ist das höchste Wohl. Es gibt, Bruder, Götter, die zum Bereich wo nichts mehr besteht emporgelangt sind: das ist die höchste Wahrnehmung. Es gibt, Bruder, Götter, die zum Bereich der Grenze möglicher Wahrnehmung emporgelangt sind: das ist das höchste Dasein.« Auf diese Erklärungen Bhaddajis erwidert Ānando: »Da stimmt wohl der ehrwürdige Bhaddaji darin mit der großen Menge überein.« – »Der ehrwürdige Ānando«, entschuldigt sich gleichsam Bhaddaji, »hat viel erfahren: mög' es doch der ehrwürdige Ānando aufweisen!« – »Wohlan denn, Bruder Bhaddaji, so höre und merke sorgsam was ich dir sagen will.« Gern stimmt Bhaddaji zu, und Ānando überliefert ihm nun das Meisterwort: »Der Anblick, Bruder, wo man unmittelbar die Wahnversiegung erfährt, das ist das höchste Gesicht. Die Kunde, wo man unmittelbar die Wahnversiegung erfährt, das ist das höchste Gehör. Das Wohlbefinden wo man unmittelbar die Wahnversiegung erfährt, das ist das höchste Wohl. Die Bewußtheit wo man unmittelbar die Wahnversiegung erfährt, das ist die höchste Wahrnehmung. Der Zustand wo man unmittelbar die Wahnversiegung erfährt, das ist das höchste Dasein.« Da hatte denn [920] freilich Ānando dem Bruder Bhaddaji, der wie oben Sāriputto mehr volksmäßig redete, in etwas anderer Weise ein kräftiges Beschließen angeregt
Zum höchsten Dasein immerfort zu streben. –
So klar und einfach wie möglich spricht sich gelegentlich einmal auch Sāriputto ganz allgemein über den Begriff des Wohls aus, im Dasakanipāto des Anguttaranikāyo No. 65, bei der Begegnung mit dem Pilger Sāmaṇḍakāni. Der war zu ihm gekommen um die Frage zu stellen: »Was ist denn eigentlich, Bruder Sāriputto, Wohl und was Wehe?« Worauf Sāriputto antwortet: »Wiederentstehn, Bruder, ist Wehe, Nichtwiederentstehn Wohl. Kommt es, Bruder, zu Wiederentstehn, so ist als Wehe zu gewärtigen: Frost und Hitze, Hungern und Dürsten, Koten und Harnen, Feuer, Stock und Schwert kennenlernen, und auch vom Beigang und Umgang mit Verwandten und Freunden sogar Plage haben. Kommt es, Bruder, zu Wiederentstehn, so ist dies als Wehe zu gewärtigen. Kommt es Bruder, zu keinem Wiederentstehn, so ist als Wohl zu gewärtigen: kein Frost, keine Hitze, kein Hungern und Dürsten, kein Koten und Harnen, nicht Feuer, Stock und Schwert kennenlernen, und auch vom Beigang und Umgang mit Verwandten und Freunden sogar keine Plage mehr. Kommt es, Bruder, zu keinem Wiederentstehn, so ist dies als Wohl zu gewärtigen.«
965 Bei diesen drei Arten der Einigung wird angedeutet, daß eine um die andere immer leerer wird an vorstellbaren Dingen, bis der Jünger die »durchaus reine, allerhöchste Armut errungen hat«, d.i. die suññatā, Leerheit, Mittlere Sammlung 909. Von hier aus vielleicht in die Maitryupaniṣat aufgenommen als ūnyaḥ āntaḥ, II 4 etc., leer geworden, still geworden; und in der Tejabindūpaniṣat v. 11 heißt es: sarvaṃ tat paramaṃ ūnyaṃ, na paraṃ paramāt param, Alles ist jenes höchste Leere, nicht das Höchste, über das Höchste hinaus. Zu diesem Spruche hat WEBER schon vor langen Jahren bemerkt, daß hier »der Einfluß und die Verschmelzung buddhistischer Lehre nicht zu verkennen« sei, Indische Studien, Berlin 1851, S. 64: was übrigens durch SADĀNANDAS, den Verfasser des Vedāntasāras, zur Gewißheit erhoben wird, da er die von ihm zurechtgestellte These ūnyam ātmā, die Leerheit ist das Selbst, als eine buddhistische Maxime angibt, ed. BÖHTLINGK No. 155. Die Leerheit als Anfang und Ende zu wissen ist aber das Ziel fast aller höheren geistigen Schulen geworden. Das Kamahāyānikam, ein Leitfaden des Mahāyānam, dessen Text in das 6. Jahrhundert zurückreicht, faßt die einzelnen Meinungen so zusammen: Die Ansicht der ehrwürdigen Buddhisten ist die von der Leerheit des höchsten wahren Selbst, ūnyaḥ paramasadātmā; die der ehrwürdigen iviten von der Leerheit der höchsten Wonne, ūnyaḥ paramānandaḥ; die der ehrwürdigen Mīmāṃsisten von der Leerheit des höchsten Geheimnisses, ūnyaṃ paramaguhyam; die der ehrwürdigen Seher, ṛṣayaḥ, die Leerheit schlechthin, ūnyatā; das höchste Leere aber, parama ūnyam, ist den Brāhmanen eigen: nach SPEYER, Ein altjavanischer mahāyānistischer Katechismus, Zeitschrift der deutschen morgenländischen Gesellschaft 1913, S. 352. Als Erläuterung im Sinne PASCALS könnte man hier anfügen, daß die indischen Mathematiker mit ūnyam Null bezeichnen und auch die unbekannte Größe: beides mit demselben Zeichen für Zero und X, einem Punkt. Von eben solcher Nullität oder Irrationalität, Leerheit und Armut des Menschen sagt erfahren Meister ECKHART: bis er nichts mehr will und nichts mehr weiß und nichts mehr hat, weder auswendig noch inwendig, ed. PFEIFFER p. 418. Es war ebenso die Lehre des DIONYSIUS AREOPAGITA gewesen, auf den sich ECKHART oft beruft; wie ja auch IOANNES DAMASKENOS Gott über dem Seienden nennt, ὑπερ ουσιαν, und SCOTUS ERIGENA sagt, daß Gott nicht weiß was er ist, weil er nicht irgendwas ist, nescit [921] se quid est, quia non est quid. Sankt BERNHARD aber faßt es praktisch in eines seiner kurzen, kostbaren, alles enthaltenden Merkworte: compauperari filio Dei, mit dem Gottessohne verarmen, gegen Ende des großen Briefes De vita solitaria etc., fol. 1045 der Pariser Ausgabe 1621. Und siebzehn Jahrhunderte vor dem Zisterzienser war es auch schon immer nur die Leerheit gewesen, die LAO-tse gründlich dargestellt hat, namentlich im 4. und 11. Abschnitt seines 1. Buches, ed. JULIEN p. 6 u. 14: »Dreißig Speichen treffen um die Nabe zusammen: es ist die Leerheit, die das Rad zustande bringt.« Da haben wir denn wiederum das berühmte Gleichnis der Upanischaden, nach der Chāndogyā VII 15, 1, Bṛhadāraṇyakā II 5 15 usw.: »Wie die Speichen um die Nabe, so ist alles um das Selbst angefügt.« Das Selbst oder der ātmā ist aber späterhin, wie wir oben gehört haben, dem ūnyam oder der Leerheit schlechthin gleichgesetzt worden: bei dem Anblick der Nabe war es im vedischen Kreise noch nicht ausgesprochen, nur bildlich gezeigt; was freilich auf 1 = o herauskommt. Jeder von diesen Denkern ist also ein Meister, zu dem der Jünger wie Faust Vertrauen fassen, die Überfahrt wagen kann:
Du sendest mich ins Leere,
Damit ich dort so Kunst als Kraft vermehre;
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Nur immer zu! wir wollen es ergründen,
In deinem Nichts hoff' ich das All zu finden.
Recht fein ist ein Gleichnis, das der Mönch Khemako anwendet, Saṉyuttakanikāyo ed. Siam. vol. III, p. 117f. (PTS 131): der scharfe, beißende Geruch des Dünkels der Ichheit wird durch den Duft der Lehre nach und nach ausgetrieben. Siehe noch Mittlere Sammlung S. 1007f. nebst Anm. 503, zweiter Absatz: »auf eines gestützt ein anderes abstoßen«, mit anderen Worten s.v.a. jene selige Sehnsucht vom ›Stirb und werde‹ zum Abschluß bringen, ›Dies um das‹ erobern. Sehr eingehend werden diese Übungen in der 20. Rede der Mittleren Sammlung der Reihe nach gezeigt und zu Beginn so empfohlen und veranschaulicht: »Gleichwie etwa, ihr Mönche, ein geschickter Maurer oder Maurergeselle mit einem feinen Keil einen groben heraustreiben, herausschlagen, herausstoßen kann, ebenso nun auch, ihr Mönche, soll ein Mönch, wenn er eine Vorstellung faßt, eine Vorstellung sich vergegenwärtigt, und ihm dabei böse, unwürdige Erwägungen aufsteigen, Bilder der Gier, des Hasses und der Verblendung, aus dieser Vorstellung eine andere gewinnen, ein würdiges Bild. Während er aus dieser Vorstellung eine andere gewinnt, ein würdiges Bild, schwinden die bösen, unwürdigen Erwägungen, die Bilder der Gier, des Hasses und der Verblendung, lösen sich auf; und weil es sie überwunden hat, festigt sich eben das innige Herz, beruhigt sich, wird einig und stark.« Das hier von Gotamo gegebene drastische Gleichnis ist, nebenbei bemerkt, in FREIDANKS Weltkunde wiederzufinden, ed. GRIMM 127, 4-7; SHAKESPEARE hat es auf Coriolanus bezogen, den Unbeugsamen »poor'st of all« zu machen, IV Ende:
One fire drives out one fire; one nail, one nail;
Rights by rights falter, strength by strength do fail.
Ist es dahingekommen, so wird man, wie es am Ende jener Rede heißt, »Mönch Herrscher über der Erwägungen Arten genannt. Welche Erwägung er will, die wird er erwägen, welche Erwägung er nicht will, die wird er nicht erwägen. Abgeschnitten hat er den Lebensdurst, weggeworfen die Fessel, durch vollständige Dünkeleroberung [922] ein Ende gemacht dem Leiden.« – Im Mahāyānam wurde etwa ein Jahrtausend später der Begriff der Leerheit, ūnyatā, in unendlichen Variationen, Progressionen, Permutationen abgewandelt; er ist dort in eine müßige Spielerei ausgeartet, mit der sich die hybriden Geister und Metaphysiker ihre Zeit und Langeweile vertrieben haben: wo hingegen er ursprünglich von Gotamo immer nur kurz gefaßt und als Schlagwort gegeben war, nur als Mittel zur praktisch durchgeführten Läuterung von jedwedem Einfluß, āsavo. Bis zu welchem Pegel von Aberwitz das Fangballspiel mit den tausend und hunderttausend Kategorien der Leerheit in Nepāl, China und Tibet endlich gelangt ist, zeigen die Fluten der Prajñāpāramitās, von deren kleinster, der achttausendfachen, BURNOUF schon vor 70 Jahren eine meisterhafte Übersetzung angefertigt und daraus fast den ganzen 1. Abschnitt veröffentlicht hat, Introduction à l'histoire du Buddhisme indien II section IV »Abhidharma ou Métaphysique«; eine Auswahl mit 10 weiteren Kapiteln hat neuerdings WALLESER lesbar zu verdeutschen gesucht, »Prajñāpāramitā, die Vollkommenheit der Erkenntnis, nach indischen, tibetischen und chinesischen Quellen«, Göttingen 1914. Man kann da schon, obenhin zugänglich, die ufer-und bodenlose Verwässerung besehn, worin das loṇaphalam oder Salzkorn unserer Texte, wie es z.B. in der 121. Rede der Mittleren Sammlung oder in v. 1119 der Bruchstücke der Reden dargeboten wird, schmacklos zerschmilzt. Die Mahāyānisten waren nämlich von der überaus zarten Würze, die an solchen Stellen als der letzte Geschmack oder paramaraso auf immer zurückbleibt und die darum in den Reden Gotamos so sparsam wie möglich verwendet ist, derart entzückt, daß sie nun alles und jedes damit einsalzen und durchdringen wollten: dazu eignete sich aber die kleine feinste Zugabe ganz und gar nicht, und sie haben denn nur das Gegenteil ihrer Absicht erreicht, eine Verquirlung, in der kaum eine Spur der Würze des Meistergedankens noch zu merken ist. Ebendieses ursprünglich echte Salzkorn aber auch aus dem ewig-öde wallenden Malstrom und Wortschwall wiederum als schlichten kleinen Würfel abkristallisiert zu haben, ist nur einem gelungen: dem scharfsinnigen und unendlich geduldigen und bis zur letzten Tiefe sich durchkämpfenden 1. J. SCHMIDT. In einer seiner Abhandlungen und Übersetzungen hat dieser wirklich einzigartige Forscher alles darzulegen verstanden, was man nur irgend aus den hunderttausendfältigen Prajñāpāramitās an Erkenntnis lernen kann. Es ist das die, bereits von SCHOPENHAUER gewürdigte, Arbeit »Über das Mahâjâna und Pradschnâ-Pâramita der Bauddhen«, in den Denkschriften der kaiserl. Akademie der Wissenschaften, St. Petersburg 1837, historisch-philologische Abteilung, 6. Serie 4. Bd. S. 123-228. Vergl. noch Anm. 356, Lieder der Mönche v. 469.
966 Der Rausch der Gesundheit, Rausch der Jugend, Rausch des Lebens ist in der 14. Rede untersucht, S. 195f., dazu Anm. 312. Vergl. auch die 13. Rede der Mittleren Sammlung 98f., wo die schimmernde Schönheit einer Jungfrau in der Blüte des sechzehnten Jahres ihrer späteren Erscheinung im achtzigsten oder neunzigsten [923] Lebensjahr gegenübergestellt wird: da sehe man sich dieselbe an, als gebrochen, giebelförmig geknickt, siech, welk, zahnlos, mit wackelndem Kopfe schlotternd dahinschleichen. In so herber Größe ist nur noch etwa die Ansprache Achills an Lykaon gehalten, mit dem και εγω καλος τε μεγας τε, και εμοι ϑανατος και μοιρα, Ilias XXI 108-110. Es ist das Bild, worunter PERSIUS I 9/10 den Vers gesetzt hat:
Tunc, quum ad canitiem et nostrum istud vivere triste
Aspexi ac nucibus facimus quaecumque relictis.
Volksmäßig heißt es im Liede HAUFFS: »Ach, wie bald | Schwindet Schönheit und Gestalt«: das ist die Offenbarung des Rausches der Jugend, ist sein Katzenjammer. Oder um, hier nicht unklar, mit HEGEL Zu reden: die Offenbarung der Idee in ihrem Anderssein. Wunderbar unserem Text entsprechend hat BURNS gesagt:
Look not alone on youthful prime,
Or manhood's active might;
Man then is useful to his kind,
Supported in his right:
But see him on the edge of life,
With cares and sorrows worn,
Then age and want, oh! ill match'd pair!
Show man was made to mourn.
Ebenso zuständig hatte HERRERA im Sonett an PACHECO dieses Verhältnis erkannt, es aber dann in einem echt indischen Akkord verklingen lassen:
Pero el dulce color y hermosura
De nuestra humana vida cuando huye
No torna, i oh mortal suerte, oh breve gloria!
Mas sola la virtud nos asegura;
Que el tiempo avaro, aunque esta flor destruye,
Contra ella nunca osò intentar victoria.
So uns köstliche Farbe und Schönheit umwinden
Im menschlichen Leben, und diese verkrumen,
Blüht nichts mehr. O sterblicher Anteil, o kurzes Entzücken!
Allein in der Tugend ist Zuflucht zu finden,
Da der neidigen Zeit, zerpflückt sie dort Blumen,
Hier siegreiche Willkür doch nie konnte glücken.
Dieser doppelten Betrachtung nie vergessen zu haben ist der unsterbliche Ruhm PETRARCAS, der unser morsches gebrechliches Wohl einen Wind und Schatten heißt mit dem Namen Schönheit, es darum mit anderen Augen ansieht, Sonett 291; und der die klare Erkenntnis davon seinem Lebenswerk im ersten Sonett voranstellt:
e 'l conoscer chiaramente
Che quanto piace al mondo è breve sogno.
Mitten aus Kampf und Schlacht, Tod und Leben und unbeugsamer Tapferkeit entwickelt ist das doppelte Verhältnis auf der Umschrift der Medaille bewährt, die dem Seehelden PIET HEIN, dem Eroberer der spanischen Silberflotte 1628 geprägt wurde, mit dem markigen Spruche:
[924] Noch Zilver, Goud, noch Staet,
De Deugd te boven gaet.
Das abgeblühte welke Alter ist aber in solchem Hinblick und Gegensatz wohl nie schöner verklärt worden als in einer Legende der Mittleren Sammlung, S. 623-629, wo die ersten grauen Haare, die sich am Haupte zeigen, Götterboten genannt werden: wenn die sich gemeldet haben, ist es die letzte Zeit und Gelegenheit aus dem Hause in die Hauslosigkeit zu ziehn. Das ist der heilsame Wandel von alters her, den sind alle die großen Herrscher der Vorzeit gewandelt, bis auf König Nimi herab. Immer wann der königliche Bader auf dem Haupte des Herrschers zuerst graues Haar wahrgenommen, hatte er die Weisung es mit einer Zange zart auszuziehn und dem Herrscher auf die Hand zu legen; und der wußte nun: die Zeit der Einkehr ist gekommen. Diese uralte sinnige Legende ist auch bis zu unseren Volkserzählern und -dichtern gedrungen, sie ist, obzwar auf dem weiten Wege stark vergröbert, immer noch kennbar geblieben. Bruder JOHANNES PAULI, der barfüßige Franziskaner im Elsaß, bringt sie bei, in seinem »Schimpf und Ernst«, ohne Zweifel durch GEILER VON KAISERSBERG angeregt, zum Gedächtnis des Todes, wo er von einem Bauern erzählt, der lange Zeit hindurch ein heimlicher Übeltäter und Mörder gewesen. Den hat nun eines Tages sein Töchterlein gekämmt und gelaust und dabei, sieh' da, gefunden, daß er schon graues Haar habe. Als sie ihm das meldet, läßt er sich eins ausziehn, nimmt es in die Hand und spricht: O ewiger Gott, nun ist es Zeit, daß ich mich bessere. Und er hat Buße getan, um eines grauen Haares willen. – Auch der hatte also den Götterboten da gesehn, wo ihn sonst keiner in so alltäglicher Gestalt zu erblicken vermag; denn: »Die Menschen sind im ganzen Leben blind«, ist doch der Sorge letzte Botschaft an Faust. Eine noch weiter vergröberte Gestalt zeigt die Legende von den »Boten des Todes« in GRIMMS 177. Märchen, wo sie bis auf TRIMBERGS Renner 23666/722 nachgewiesen ist. Dann hat noch MORRIS eine lange, beliebte Seitenlinie hierzu verfolgt in seinen Notes and Queries s.v. Death's Messengers, Journal of the Pāli Text Society 1885, S. 34-47 des Sonderdrucks.
Die drei Arten von Oberherrschaft, die Sāriputto im Text oben alsbald nennt, beziehn sich auf die Angaben im Anguttaranikāyo III No. 40, ed. Siam. p. 188-190. Der Mönch, der zurückgezogen in der Einsamkeit des Waldes oder in leerer Klause weilt, erwägt und überlegt, daß er ja nicht um Kleidung, Nahrung, Obdach und dergleichen aus dem Hause in die Hauslosigkeit gezogen sei, sondern weil er erkannt hatte: ›Versunken bin ich in Geburt, in Altern und Sterben, in Wehe, Jammer und Leiden, in Gram und Verzweiflung, in Leiden versunken, in Leiden verloren! Oh, daß es doch etwa möglich wäre dieser ganzen Leidensfülle ein Ende zu machen!‹ Daher stände es ihm übel an, noch irgendwelchen Wünschen zu frönen. So wird er denn Kraft erkämpfen, unbeugsame, die Einsicht gewärtig haben, unverrückbar, der Körper wird sich beschwichtigen, ihm nicht mehr widerstehn, gesammelt der Geist, einig werden. So gelangt er allmählich zur Oberherrschaft über sich selbst, kann das Unheilsame verwerfen und das Heilsame erringen, Tadelhaftes ablegen und Untadelhaftes gewinnen, sich rein bewahren. Das heißt man Oberherrschaft über sich selbst. Und was ist Oberherrschaft über die Welt? Keine Gedanken der Gier, des Hasses, der Wut mehr kennen, in dieser großen Weltgemeinschaft. Und Oberherrschaft über die Satzung?[925] Nicht nachlässig, nicht vergeßlich werden bei dieser Lehre und Ordnung, die der Erhabene so wohl kundgetan hat, die ersichtliche, zeitlose, anregende, einladende, die den Verständigen von selbst verständlich wird. Das heißt man Oberherrschaft über die Satzung. Im Catukkanipāto No. 245 (PTS 243), ed. Siam. p. 339, ist noch hinzugefügt: »Um die Übung zu fördern, ihr Mönche, wird dieses Asketenleben geführt, in Weisheit läuft es aus, von Erlösung ist es durchströmt, Einsicht hat es zur Oberherrschaft.«
967 Siehe Anmerkung 1034 gegen Ende.
968 Dazu unsere elfte Rede S. 149f. Pāṭihāriyam, Wunder, ist erst im volkstümlichen Gebrauch zu dieser Bedeutung gekommen: im Orden selbst hat es die alte vedische Geltung, wie etwa Chāndogyopaniṣat I 11 i.f., »das Erfaßbare, Ergreifbare«. Die populäre Steigerung ist so zu verstehn, daß man das Ergriffensein als ein Wunder betrachtet hat, je nach den drei verschiedenen Anlässen oder Äußerungen, wie Sāriputto im Text oben es einteilt: als ein Wunder der Macht, ein Wunder der Vorzeige, ein Wunder der Unterweisung. Die Belege sind in Anm. 407 gegeben. Vergl. auch die kurze Rede im Anguttaranikāyo, Tikanipāto No. 126 (PTS 123), ed. Siam. p. 361: »Zum Erkennen, ihr Mönche, leg' ich die Satzung dar, nicht zum Verkennen, begründet, ihr Mönche, leg' ich die Satzung dar, nicht unbegründet, erfaßbar, ihr Mönche, leg' ich die Satzung dar, nicht unerfaßbar. Da ich also, ihr Mönche, zum Erkennen die Satzung darlege, nicht zum Verkennen, begründet die Satzung darlege, nicht unbegründet, erfaßbar die Satzung darlege, nicht unerfaßbar, muß ich der Sprache pflegen, der Unterweisung pflegen: genug aber schon euch Mönchen zur Zufriedenheit, genug zum Frohsinn, genug zur Freude: ›Vollkommen erwacht ist der Erhabene, wohlkundgetan vom Erhabenen die Satzung, wohlvertraut die Jüngerschaft.‹«
969 So Lieder der Mönche v. 397; vergl. auch Bruchstücke der Reden v. 203 und 502, wo noch wichtige Nachweise aus dem Anguttaram und Saṃyuttam verzeichnet sind. Ein verwandter Merkspruch dieser vollendeten Asketenschaft und ihrer Bekenner ist, nach der Überlieferung der Seher, wie es heißt, in der Saṃnyāsopaniṣat bestätigt, am Ende des ersten Abschnitts, in der Bombayer Hundertacht Upanischadenausgabe von 1895 fol. 634 b, später im Mahābhāratam wiederholt, XII 252, 6:
Yathā 'hani tathā rātrau
yathā rātrau tathā 'hani
va e tiṣṭhati sattvātmā
satataṃ yogayoginām.
Gleichwie bei Tage so bei Nacht,
Bei Nacht sind wie bei Tage sie
Nach Wunsch bestanden echt in sich,
Zur Einkehr stetig eingekehrt.
Das ist des Asketen Tag- und Nachtgleiche, sein Aequinoctium, von dem aus er die Bestimmungen aller Höhen und Tiefen richtig zu treffen vermag, zur Erlangung der Wissensklarheit. Merkwürdig klingt hier ein Spruch aus dem Sachsenspiegel an, aus dem Eingang 191-194:
Stolczen helde, sît bedâcht,
Nâch tage volget ie die nacht:
Der tag ist ouch an uns gewant,
Uns sîget der âbent in die hant.
[926] Der Asket als der immer streitbare Kämpfer, ein Held bis zum letzten Atemzuge, weiß wenig von Schlaf und Schlummer. Wenn irgendeiner, so ist er der verkörperte devo 'nimiṣaṛ, wie einer der tausend Namen Vischnus lautet: der Gott, der nicht blinzelt, der die Augen nicht schließt, der wo alles schläft wach bleibt. – Als Gotamo an die Anuruddher Mönche die Frage stellt, ob sie ernsten Sinnes, eifrig, unermüdlich verweilen, berichten sie auch, daß sie jeden fünften Tag die ganze Nacht hindurch in Gesprächen über die Lehre beisammensitzen. Recht so, recht so, Anuruddher, sagt darauf der Meister zu den edlen Söhnen, billigt also damit den jeweilig ebensowohl gesellig bewährten urasketentümlichen Brauch seiner Einsiedler im Gosingam-Walde: Mittlere Sammlung 234f., 950. So auch mochte in späteren Zeiten der ägyptische ANTONIOS oft und oft die ganze Nacht in seiner lichten Wüste durchwachen; und nach ihm hat ARSENIOS der Große, der da ein Jahrtausend später von unserem lieben SEUSE zum Vorbild gewählt und der summus philosophus genannt wurde, es gern bestätigt, daß einem eifrigen Kämpfer eine Stunde Schlafs genüge: er selbst pflegte jede Nacht durchzuwachen und erst gegen Morgen eine Weile sitzend zu schlummern, FLOSS, MACARII Aegyptii Epistolae etc., Köln 1850, p. 92. EPICHARMOS Sagte: »Alles Bedeutende wird besser bei Nacht ausgefunden«, und: »Wer da um Weisheit wirbt, muß es bei Nacht bedenken«, nach der Hellenischen Theologie des KORNUTOS, Kapitel 14 am Ende. Mit ebendiesem Gedanken hat GOETHE das Lied an den Mond beschlossen, wo er davon spricht,
Was, von Menschen nicht gewußt,
Oder nicht bedacht,
Durch das Labyrinth der Brust
Wandelt in der Nacht.
Berühmt ist der Spruch der Ilias II 24 (cf. X 4, Aeneis I 305):
Nicht soll schlafen ein Mann, der Rat pflegt, gänzlich die Nacht durch,
eine Weisung, die von großen Herrschern stets treulich befolgt wurde, zumal von ALEXANDER, von MARC AUREL, JULIAN, JUSTINIAN; ein Ehrentitel des letzteren war: Παντων βασιλεων αγρυπνοτατος, Aller Könige unschläfrigster. Wie aber schlafen und wachen bei den Menschen verschieden sei, das stellt Gotamo einmal in folgender Weise dar: »Fünf sind es, ihr Mönche, die bei Nacht mehr wachen als schlafen: und welche fünf? Das Weib, ihr Mönche, das einem Manne nachhängt, schläft wenig bei Nacht und wacht lange; der Mann, ihr Mönche, der einem Weibe nachhängt, schläft wenig bei Nacht und wacht lange; der Dieb, ihr Mönche, der einem Raube nachhängt, schläft wenig bei Nacht und wacht lange; der Königsdiener, ihr Mönche, der die königlichen Geschäfte versieht, schläft wenig bei Nacht und wacht lange; der Mönch, ihr Mönche, der seiner Ablösung nachhängt, schläft wenig bei Nacht und wacht lange. Das sind fünf, ihr Mönche, die bei Nacht mehr wachen als schlafen.« Anguttaranikāyo, Pañcakanipāto No. 137. Im Sattakanipāto No. 58 ist ein Gespräch erhalten, wobei der Meister dem ehrwürdigen Moggallāno, der sich müde fühlt, den Rat gibt, sich mit Wasser die Augen zu benetzen, rings umher zu schauen und zu den Gestirnen und leuchtenden Himmelskörpern emporzublicken: da sei es wohl möglich, daß ihm bei solcher Betrachtung die Müdigkeit vergehn werde. Und er wird dann ferner das Licht aufmerksam im Sinne haben, den Tag aufmerksam in Obacht nehmen:
[927] Wie lichter Tag so Mitternacht,
Wie Mitternacht so lichter Tag.
So mag er mit entschleiertem Geiste, frei von jeder Hülle, ein selbstleuchtendes Gemüt erwerben. Ebendiese Stelle – ein wichtiger Merkspruch, wie eingangs bemerkt – wird oben von Sāriputto den Jüngern angesichts des Meisters wiederholt. Eingedenk solcher Weisung sagt auch einmal ein anderer Nachfolger des Sakyerasketen, Soṇo Poṭiriyaputto, in den Liedern der Mönche v. 193:
Nicht lob' ich Schlaf in dieser Nacht
Mit Sternenkränzen hoch gekrönt,
Zum Wachen taugt sie einzig nur
Dem Denker, der um Wissen wirbt.
Der bestirnte Himmel über mir, und das moralische Gesetz in mir: der letzte Anblick und Einblick der praktischen Vernunft war da schon vorbeschlossen; der Satz, den BEETHOVEN im Herzen bewahrt und den JEAN PAUL zu dem Exkurs benützt hat: »Wenn ich den weiten zu gestirnten lichten Bildern ausgestochenen dunkeln Himmel ansah, gleichsam als den verzognen silbernen Anfangsbuchstaben unsers Sein; – und Milchstraßen und Nebelflecken gegen Kellner und Philosophen, jetzige Literatur, Ostermessen, zweite Edizionen hielt: so wollten die letztern nicht mehr recht glänzen, und ich fing an, wenig darum zu geben.« Dergleichen Worte und Winke sind freilich, in Indien so gut wie bei uns, nicht mehr als bloße ayuktapadārthās oder enthymematische Andeutungen gewesen um den Mitkämpfer zu beflügeln, dahin zu leiten wohin, nach dem parallel verlaufenden Exkurs, den der Magus aus Norden eingeschlagen hat, nur selbsterworbene Kenntnis führen kann. »Die Idee des Lesers«, meint nämlich HAMANN und meint es ohne zu scherzen, »ist die Muse und Gehülfin des Autors; die Ausdehnung seiner Begriffe und Empfindungen der Himmel, in den der Autor die Idee seines Lesers versetzt und in Sicherheit bringt, den Mann im Monde vorbei – den Ring des Saturns vorbei – die Milchstraße vorbei – in solcher unermeßlichen Ferne, daß von der Idee des Lesers nichts als ein Zeichen in Wolken übrig bleibt, das niemand kennt als der Leser, der es macht, und der Autor, der es weiß.« Sibyllinische Blätter, 2. Buch No. 47. Vom Standpunkt des logischen Verstandes und seiner berufenen Vertreter sind solche Dinge natürlich Unsinn, ganz ebenso wie jene Gleichstellung von Hell und Dunkel, Tag und Nacht. Gerade diese Doppelbegriffe hat aber SEXTUS EMPIRICUS zu einer sehr eingehenden Untersuchung περι αποδειξεως gewählt, nämlich zur Demonstration der stets nur bedingten, stets nur relativen Gültigkeit der Schlußfolgerung: Ει ήμερα εστι, φως εστιν; ει νυξ εστι, σκοτος εστιν, Wenn Tag ist, ist es licht: wenn Nacht ist, ist es dunkel, adv. Logicos lib. II sect. 302-312 ac 413-421. Hatte doch schon HERAKLIT gesagt, bei PLUTARCH Aqua an ignis etc. cap. 7: Ει μη ήλιος ην, ευφρονη αν ην, Wäre nicht Sonne, würde Nacht sein. Und ebendiese recht selbstverständliche Evidenz geltend zu machen hat auch ein anderer höchster Denker, Meister ECKHART, nicht verschmäht, ed. PFEIFFER, p. 49: »Tag beweist Nacht: denn wäre keine Nacht, so wäre und hieße es auch nicht Tag.« Der gewöhnliche Mensch kann nun aber das Problematische solcher Aussagen schwerlich merken. Ja er mag sich in seiner Unschuld wohl denken: ›O Weiser, das hab' ich so wie so schon gewußt.‹ Bei weiterer Prüfung wird er es dann etwa so begutachten, wie ROUSSEAU einmal dasselbe Schulbeispiel, gewiß unabhängig von Meister [928] ECKHART oder SEXTUS EMPIRICUS und den Pyrrhonikern, dem Erzbischof von Paris lächerlich dargestellt hat, ungefähr in der Mitte seines langen Schreibens vom 18. November 1762. Nehmen wir an, sagt er, daß uns jemand um Mitternacht einreden wollte, es sei Tag; man wird ihn auslachen. Aber er soll sich nur mit der Zeit eine Sekte dazu heranziehn, dann werden seine Anhänger über kurz oder lang uns beweisen, daß er recht hatte, buchstäblich, figürlich oder sonstwie. »L'un dira: il a dit à minuit qu'il était jour, et il était nuit; l'autre dira: il a dit à minuit qu'il était jour, et il était jour. Chacun taxera de mauvaise foi le parti contraire, et n'y verra que des obstinés. On finira par se battre, se massacrer; les flots de sang couleront de toutes parts; et si la nouvelle secte est enfin victorieuse, il restera démontré qu'il est jour la nuit. C'est à-peu-près l'histoire de toutes les querelles de religion.« Die Abweisung ist jenem Prälaten gegenüber nur allzu berechtigt gewesen. Gotamo selbst hatte ja von diesem Standpunkt aus den gewichtigen Brāhmanen Jāṇussoṇi einst ebenso abgewiesen, gegen Ende der vierten Rede der Mittleren Sammlung, S. 25: »Doch gibt es, Priester, manche Asketen und Priester, die halten die Nacht für Tag und den Tag für Nacht. Das nenn' ich, Priester, einen Wahn jener Asketen und Priester. Ich aber, Priester, halte die Nacht für Nacht und den Tag für Tag.« Wie also Gotamo den gewöhnlichen Menschenverstand zunächst ganz im gleichen Ausdruck mit ROUSSEAU als Richtschnur den Überhebungen der Priesterkaste vorzieht, so ist anderseits der eingangs dieser Anmerkung gegebene Spruch vom Oben und Unten, Hell und Dunkel, Tag und Nacht im höheren, überweltlichen Sinne, im rein asketischen Verstande begriffen: und hier wieder überraschend gleichartig in den Bekenntnissen der KLETTENBERG entwickelt worden, Wilhelm Meisters Lehrjahre 6. Buch Mitte. Der Heiland, von dem sie da spricht, ist wohl ihr evangelischer Herr: aber immerhin, nach der Definition der eigentlichen christlichen Philosophie, jene vortreffliche Gestalt voll tiefen Lebens, von größter poetischer Wahrheit und höchster Bedeutsamkeit; und darum war auch der schönen Seele die Spur, die Bahn, die ewige Art des Erhabenen schon klar genug aufgegangen als sie sagte: »O, warum müssen wir, um von solchen Dingen zu reden, Bilder gebrauchen, die nur äußere Zustände anzeigen? Wo ist vor ihm etwas Hohes oder Tiefes, etwas Dunkles oder Helles? Wir nur haben ein Oben und Unten, einen Tag und eine Nacht. Und eben darum ist er uns ähnlich geworden, weil wir sonst keinen Teil an ihm haben könnten.« Sehr nüchtern und daher am feinsten zutreffend könnte man jedoch einen solchen Mann so schildern wie ihn begrifflich zu verkörpern dem VELLEIUS PATERCULUS gut gelungen ist, Historiae Romanae II 127; wo er den praefectus praetorio SEIANUS preist als den höchsten Ausdruck römischer virtus – der Allvermöger hätte, seiner erworbenen Tüchtigkeit nach, bei eiserner Selbstzucht es vielleicht dahinaus bringen können – ihn betrachtet als den richtigen Übermenschen: virum severitatis laetissimae, hilaritatis priscae, actu otiosis simillimum, nihil sibi vindicantem eoque adsequentem omnia, semperque infra aliorum aestimationes se metientem, vultu vitaque tranquillum, animo exsomnem. Jedes der Worte, nach innen gedreht, spiegelt unser Helldunkel ab.
970 Ebenso Mittlere Sammlung, Ende der 123. Rede.
971 Vergl. die 2. Rede der Mittleren Sammlung, S. 14-16.
972 Eine verwandte Darstellung zu Beginn der 77. Rede der Mittleren Sammlung, S. 566-567.
973 Ausgeführt in der 22. Rede S. 385f.; zum Vorangehenden Mittlere Sammlung S. 889, 15, 203. Der Kampf des Jüngers, der allein durchgekämpft werden muß, ist im Dhammapadam v. 165 angedeutet, mit dem Abschluß:
[929] Suddhī asuddhī paccattaṃ,
nāñño aññaṃ visodhaye.
Selbst ist man böse oder rein,
Kein andrer kann Erlöser sein.
Dasselbe hat der ägyptische ANTONIOS vor seinem Ende den um ihn versammelten Nachfolgern als Summe der Satzung hinterlassen: ζησατε προσεχοντες έαυτοις, »Suchen sollt ihr Zuflucht in euch selbst«, Vita p. 117, cf. Anm. 403. SEUSE hat dieses Vermächtnis des von ihm hochverehrten Altvaters der Anachoreten wohl beherzigt, er nimmt darauf Bezug in seiner Lebensbeschreibung, indem er aus den Verba seniorum das überlieferte Wort anführt: »Antonius sprach zu einem Bruder: Mensch, hilf dir selbst: anders kann weder ich noch Gott dir jemals helfen«, ed. BIHLMEYER p. 105.
974 Zur gründlichen Kenntnis vom Leiden gehört auch das Wissen, gehört die Erfahrung, daß alles was irgend empfunden werden kann, auch was sich als Wohl anläßt, doch nur Leiden ist: dies zu durchschauen wird beim Erhabenen das Asketenleben geführt. Saṉyuttakanikāyo vol. II. 53, IV 138. Wir hören hier eine Lehre, die mit der gleichen überweltlichen Kraft der Besinnung zwei Jahrtausende später KANT herausgefunden und in den Satz gefaßt hat, daß jedes Gefühl überhaupt pathologisch ist: siehe Anm. 808, 3. Absatz und Anm. 1058. Von dem, der genesen, heil geworden ist, vom Dahingelangten, Vollendeten, Wahnversiegten kann somit nur gesagt werden, nach Sāriputtos Vortrag der Meisterlehre: er ist weder in der Form zu finden, noch im Gefühl, noch in der Wahrnehmung, noch in den Unterscheidungen, noch im Bewußtsein; er ist aber auch außerhalb dieser fünf Stücke nicht zu finden. Er kann also bei Lebzeiten schon so wenig wie nach dem Tode wahrhaft und wirklich gekennzeichnet werden: keinerlei Begriffsbestimmung ist bei ihm möglich, trifft bei ihm zu, gilt bei ihm. Man kann nur sagen: Form, Gefühl, Wahrnehmung, Unterscheidungen, Bewußtsein ist vergänglich; was vergänglich ist, ist leidig; was leidig ist, das ist aufgelöst, das ist untergegangen. Er hat ein jedes der fünf Stücke des Anhangens gleichwie einen Meuchelmörder erkannt, der sich bei einem vermögenden Manne einschmeichelt, ihm freundlich und schön tut, heimlich aber mit gezücktem Dolche lauert und nachschleicht. Daher läßt er sich nicht mehr betören, läßt sich nicht täuschen, betrachtet Form, Gefühl, Wahrnehmung, Unterscheidungen, Bewußtsein nicht mehr als sich selbst, oder selbstähnlich, oder in sich, oder sich in ihnen. »Mörderisch ist die Form«, hat er richtig erkannt, »mörderisch das Gefühl, mörderisch die Wahrnehmung, mörderisch die Unterscheidungen, mörderisch das Bewußtsein«, und er ist keinem der fünf Stücke, als ob die etwa er selber wären, zugetan, angehangen, hingegeben. Diese Darstellung entwickelt Sāriputto dem Mönche Yamako, als dieser vermeint hatte, der Meister lehre Vernichtung. So aufgeklärt war ihm dann, wie er sagt, das Herz ohne Hangen vom Wahne frei geworden, Saṉyuttakanikāyo ed. Siam. vol. III p. 99-103, PTS 111-115. In derselben Sammlung wird bald nachher, 106 (119), im gleichen Zusammenhang eine Unterredung des Meisters mit dem ehrwürdigen Anurādho berichtet, wo Gotamo zu dem Ende kommt: »Vormals hab' ich, Anurādho, wie auch jetzt nur das Leiden dargelegt und des Leidens Auflösung.« Wie aber das Leiden gerade der Mittelpunkt ist, von dem alles ausgeht und auf den sich alles zurückbezieht, wird ebenda II 30 (32) so entwickelt: »Dem Unwissen angeschlossen sind Unterscheidungen, den Unterscheidungen angeschlossen ist Bewußtsein, dem Bewußtsein angeschlossen ist Bild und Begriff, dem Bild und Begriff angeschlossen ist sechsfaches Reich, dem sechsfachen Reich angeschlossen ist Berührung, der Berührung [930] angeschlossen ist Gefühl, dem Gefühl angeschlossen ist Durst, dem Durst angeschlossen ist Anhangen, dem Anhangen angeschlossen ist Werden, dem Werden angeschlossen ist Geburt, der Geburt angeschlossen ist Leiden, dem Leiden angeschlossen ist Zutrauen, dem Zutrauen angeschlossen ist Freude, der Freude angeschlossen ist Heiterkeit, der Heiterkeit angeschlossen ist Beschwichtigung, der Beschwichtigung angeschlossen ist Wohlsein, dem Wohlsein angeschlossen ist Einigung, der Einigung angeschlossen ist wahrheitgemäß erkennen und sehn, dem wahrheitgemäß erkennen und sehn angeschlossen ist Überdruß, dem Überdruß angeschlossen ist Abkehr, der Abkehr angeschlossen ist Freiheit, der Freiheit angeschlossen ist Erkenntnis der Versiegung.« Zweimal elf Kreise, aus dem Dunklen ins Helle, um das Leiden herum und hinaus. Unter dem Zutrauen ist die Zuversicht verstanden zu den vier heiligen Wahrheiten: vom Leiden, von der Leidensentwicklung, von der Leidensauflösung, von dem zur Leidensauflösung führenden Pfade. – Die vorangehende Bezugnahme Sāriputtos auf die Kenntnis der Satzung, Kenntnis der Folgerung, dhamme ñāṇam, anvaye ñāṇam, ist im Saṃyuttakanikāyo II 53-55 (56-59) ausgeführt. Die erste ist die Kenntnis der bedingten Entstehung; hat der Mönch dieses Ding gesehn, gefunden, zeitlos erfaßt, ergründet, so hat er damit die Norm für Vergangenheit und Zukunft. Und wenn er dann einsehn lernt, daß wer auch immer ehemals oder künftighin diese Satzung wiederentdecken wird oder schon entdeckt hat, ein jeder sie gerade so verstanden hat oder verstehn wird wie sie eben jetzt zu verstehn ist: so ist das seine Kenntnis der Folgerung. Insofern nun der heilige Jünger diese zwei Kenntnisse geläutert hat, abgeklärt hat, die Kenntnis der Satzung und die Kenntnis der Folgerung: so wird er ein heiliger Jünger gennannt, ein Ansichtvertrauter, einer, der sehend geworden ist, angekommen bei dieser guten Satzung, sichtbar geworden ist ihm diese gute Satzung; mit kämpfender Kenntnis ist er ausgerüstet, mit kämpfendem Wissen versehn, er hat das Gehör der Lehre erlangt, ist heilig durchdringend weise: an das Tor der Unsterblichkeit getreten bleibt er stehn.
Die Logik der späteren buddhistischen Gelehrten führt mit Recht auf diese hier angegebenen beiden Hauptarten alle Kenntnis zurück, Dvividhaṃ samyagjñānaṃ, pratyakṣam anumānaṃ ca, »Zwiefach ist vollkommene Kenntnis: augenfällig und schlußfolgernd«, Nyāyabindus I 1. Damit war bereits das Schema der praktischen und der reinen Vernunft aufgestellt. Das Verhältnis aber, von dem Sāriputto in der oben mitgeteilten Unterredung mit Yamako spricht, haben diese Logiker höchst scharfsinnig bestimmt als anyonyābhāvas, gegenseitiges Nichtsein, d.h. x ist nicht gleich y: Tarkasaṃgrahas 69.
975 Vergl. 16. Rede nebst den dazu gehörigen Erklärungen, Anm. 389. – Mit S etc. etc. richtig esa bhagavato sāvakasangho, dann akkhaṇḍehi, aparāmaṭṭhehi.
976 Stellennachweis im Reg. III. Wer von der Botschaft nichts gehört hat und nichts wissen will, sich überhaupt ganz und gar nicht darum kümmert, der wird bāhiro puthujjanapakkhe ṭhito genannt, »außen stehend, auf seiten der gewöhnlichen Leute«, Saṃyuttakanikāyo vol. V p. 382 (P T S 397): eine Bezeichnung für die prakṛti, pakati oder den natürlichen, rohen Zustand des Menschen; so daß prākṛtas, naturalis, communis, allgemein, gleichwie αγροικος, βεβηλος, rusticus, villanus, endlich so viel als vilain, gemein bedeutet, un villano en su rincon, ein Bauer in seinem Winkel. Daher kommt es, daß »gemein, Gemeinheit« schließlich ein Schimpfwort geworden ist; weil eben allerseits das gemeinsame Band, das die Menschen untereinander verknüpft, nur aus grobem Zeug besteht, wo die feinen Fäden, die das zartere menschliche Muster ausmachen, im geschäftigen Verkehr nach und nach abgenutzt, verschlissen und [931] ausgegangen sind, so daß dann sehr bald der gemeine Mensch kein anderes Bild mehr darbietet als wie es DANTE, hierin brav aristokratisch, al fresco malt, Canzoniere V 2:
Uomo da sè virtù fatta ha lontana,
Uomo non già, ma bestia ch'uom somiglia.
Diese Ansicht hat LEOPARDI der timonischen angeglichen, sie aber hernach bis zu einer indischen Höhe gebracht, im Dialog des Timandro mit Eleandro: »Manche sagen, daß TIMON nicht die Menschen gehaßt habe, sondern die wilden Tiere in Menschengestalt. Ich hasse weder die Menschen noch die wilden Tiere.« In Schwaben pflegt man, und aller Wahrscheinlichkeit nach von DANTE und LEOPARDI unabhängig, das geflügelte Wort anzuwenden: Das Vieh und die Leut. Auch darf wohl an SCHOPENHAUERS bekanntes Gleichnis von den Roß- und den Edelkastanien erinnert werden. Die ersteren sind die Hippocastaneae hirsutae, bittere Roßfrüchte, Eitelfritze, mock-men, moghapurisā: bei denen hat man, ob sie nun weiß oder rot blühen, in der Regel »schon lange angemerket«, wie unser wackrer LISCOW bekundet, »daß diejenigen, welche die wichtigsten Ämter verwalten, und die größesten Ehrenstellen bekleiden, wie viel sie auch sonst auf sich halten, doch gemeiniglich so bescheiden gewesen sind, daß sie sich in ihren Urteilen wenig oder gar nicht von dem Pöbel entfernet, sondern sich zu allen Zeiten nicht so sehr durch den guten Geschmack, als durch die Kleidung von demselben zu unterscheiden gesuchet haben.« So zutreffend wie prākṛtas, bāhiro oder das orphische βεβηλος, so einfach, unauffällig, unverletzend ist freilich kein anderer Ausdruck der Sache. Und muß man sich hüten zu vermeinen, daß darin etwa ein Vorwurf verborgen wäre: es ist damit nichts anderes als das Natürliche bezeichnet, wenn auch, von hüben angesehn, zumeist als natura pudenda oder φαυλοτης. Doch ist diese immerhin noch erquickend zu nennen gegenüber den Maulaffen, Maulwürfen und Mißgestalten unserer entgeisterten Kulturdämmerung mit ihrer Gelehrtendichterkünstlerkrähwinkeleitelkeit, die als bālāvatārapallavam oder Blödistenpallawatsch vom Tüchtigen stets abgelehnt wurde,
Projicit ampullas et sesquipedalia verba,
sagt HORAZ; weil eben bei jener Sorte Menschen und Menschenentwicklung nach und nach alles in Spottnatur ausschlägt, und selbst der ärmste Rest eines ehrlich ordinären Empfindens schmählich verkümmert. Auch NIETZSCHE als Prunkredner gehört leider hierher. Nicht als Tadel sondern als Kennzeichen ist also das Wort »gemein« zu verstehn; wobei man das Hidalgolächeln GONGORAS gewahr wird: Alle sind schließlich Menschen, nur verschieden gekleidet,
Cual mas, cual menos,
Toda la lana es pelos:
Ob reich oder sparig,
Alles Wollzeug ist haarig.
Und wenn man sich die Sache von oben anschaut, stellt sich zuguterletzt sogar jenes Lob ein, zu dem GOETHE sich bekennt, im Brief an den Konsul SCHÖNBORN in Algier, vom I. Juni 1774: »Ich habe bei dieser Gelegenheit das gemeine Volk wieder näher kennengelernt und bin aber- und abermal vergewissert worden, daß das doch die besten Menschen sind.« Es sind eben die alltäglichen lieben guten Leute, die da ihre [932] mancherlei Art und Unart bald so und bald so, aber eigentlich stets gleich gewöhnlich entwickeln und ausleben, von der Wiege bis zur Bahre mehr oder weniger immer nur geschäftige Kinder bleiben, unsere Mit- und Milchbrüderschaft von der Promethidengemeinde.
977 Siehe Bruchstücke der Reden v. 747.
978 Vergl. 15. Rede S. 227-229. Zur genaueren Feststellung des Begriffs sankhāro, Unterscheidung, sind die Erklärungen im Khajjaniyasaṃyuttam wohl zu beachten: Was aus den Bestandteilen an Form, Gefühl, Wahrnehmung, Unterscheidung, Bewußtsein zusammengesetzt wird, das ist ein sankhāro, eine Unterscheidung, nämlich der besonderen Merkmale je und je eines Dinges: »Zusammengesetztes faßt man zusammen: darum sagt man die ›Sammelhaften‹«, die Unterscheidungen, sankhatam abhisankharonti, tasmā sankhārā ti vuccanti, Saṃyuttakanikāyo ed. Siam. vol. III p. 77 (PTS 87). Kantisch ausgedrückt: was die Synthesis der Wahrnehmungen als regulative Tätigkeit schafft, wird dadurch zu einer Unterscheidung, die Stück um Stück das Zusammengesetzte in eine Einheit der Apperzeption befaßt. SPENCE HARDY hat dies zuerst richtig erkannt, indem er »Sankhāro-khando, or powers of discrimination« umschreibt, Manual of Buddhism 2. Aufl. S. 419, und nach ihm ist es BURNOUF gewesen, der den Begriff am besten verstanden hat: er übersetzt sankhārā »les concepts«, also im Sinne von zusammenfassenden Unterscheidungen, Introduction à l'histoire du Buddhisme indien 2. Aufl. X. 419 (item), 449ff. ALBRECHT WEBER, der BURNOUF mit Recht »unseren großen Meister« nennt, hat mit fein geschulter Aufmerksamkeit sankhāro und visankhāro einander gegenübergestellt, nach Dhammapadam v. 154, als »Einkleidung« und »Entkleidung«, Indische Streifen, Berlin 1868, I 143. Diese Wiedergabe strebt kühn zu den gleichartigen eckhartischen Begriffen von der »inbildunge« und »entbildunge« heran, sie deutet die Denktätigkeit je nach der geistigen Einkleidung, also geistigen Unterscheidung, zutreffend an: im Gegensatz zu den unzutreffenden Erklärungen der späteren Forscher, die im sankhāro immer so etwas wie eine metaphysische Kraft und Schaffensgewalt vermuten, an Stelle der bloß sichtenden, regulativen Synthesis der Apperzeption. Die Darstellung des sankhāro als einer solchen unterscheidenden, synthetischen Einheit der Wahrnehmung, die ich ausführlich in meiner Buddhistischen Anthologie, Leiden 1892, S. XXIII-XXV begründet habe, ist jetzt von L. DE LA VALLÉE POUSSIN übernommen, indem er das Ergebnis meiner Untersuchung sehr gut so zusammenfaßt: »saṃskāras, (synthesis), idéologie«, Théorie des douzes causes, 40me fascicule du recueil de travaux publiés par la faculté de philosophie et lettres de l'université de Gand 1913 p. 2. Vergl. noch die kurze Erläuterung in der Anm. 490. Im Saṃyuttakanikāyo ist der scharf begrenzte Gebrauch von sankhāro, Unterscheidung, als einer Verknüpfung der Wahrnehmungen zu einer einheitlichen Vorstellung, endgültig III 85-88 (96-99) für alles und jedes irgend Denkbare bestimmt: Wenn man die Form als sich selbst betrachtet, so ist eben ein derartiges Betrachten, samanupassanā, eine Unterscheidung, ein sankhāro. Wenn man sich als formähnlich, oder in sich die Form, oder sich in der Form betrachtet, so ist eben wiederum ein solches Betrachten schlechthin eine Unterscheidung. So auch wird beim Gefühl, bei der Wahrnehmung, bei den Unterscheidungen, beim Bewußtsein ein jedes sich selbst darin Betrachten sogleich zur entsprechenden Unterscheidung. Ebenso ist jede Ansicht oder Meinung von Ewigkeit oder Zeitlichkeit usw., kurz jede nur irgend mögliche geistige Zusammenfassung nichts anderes als ein sankhāro, eine »Sammlichkeit«, wie man wörtlich genau sagen müßte, nämlich eine sammelhafte Unterscheidung. Bemerkenswert ist hier noch wie aus dem Begriff des Zugerüsteten, Ausgebildeten, Ausgeschmückten [933] usw., der in saṃskāraḥ, sankhāro liegt, einerseits sankhatam für zusammengesetzt und anderseits Sakkatam als Name für die richtig gebildete Sprache, das Saṃskṛt, fein differenziert hervorgegangen ist, beides aus demselben saṃskṛtam: eine Bereicherung der Ausdrucksmittel und eine unterschiedliche Sprechweise, die nur in der kräftigen, volkstümlich schöpferischen Mundart des Pāli überhaupt möglich war; und ferner sei auch nicht übersehn die gleichartige Entwicklung aus kṛ kirati + sam zu sankaro, sankāro, Gemenge, Gemisch, was dann zur gewöhnlichen Bezeichnung für Kehricht, Mist wurde: z.B. sankāradhānam ein Haufen Mist, sankārabhūto wirres Zeug, Dhammapadam v. 58f. Der sankāro ist der zusammengefegte Unrat, der Abraum der Straße; und der sankhāro, von kṛ karoti, ist die Sammlichkeit der Wahrnehmungen, und so auch mit der Mist der Erscheinungen, das Kehricht der reinen Vernunft, das diese sammelt und unterscheidet um es in ihrem Bewußtsein, viññāṇam, zu erkennen: und zwar wie? Eben nur kritisch, sichtend, unterscheidend. Die Phänomenalität ist daher wirklich nichts anderes als eine Synthese, compositio; und jedes Ding, jede Erscheinung, so innen wie außen betrachtet, stellt sich composite dar, als eine bestimmte con-Position: wobei es einen Kompost aus den fünferlei Dungstoffen gibt, der zugleich eine Komposition aus den fünferlei Denkstoffen, Dünkstoffen ist. So wird allerdings jeder insofern sein eigener Komponist, oder man kann auch sagen Kombinator und Quincuplicator, Augenblick um Augenblick und alle Zeiten durch, solange er sein Kombinieren und Multiplizieren nicht aufgibt, nämlich die mit der Unterscheidung bedingten Einflüsse auf seinen Willen nicht planmäßig versiegen lassen kann. Darum aber sagt oben im Text Sāriputto von solcher Komposition, von derart gebildeter, derart betätigter Aufmischung und immer wieder durchmischender Sammlichkeit der Unterscheidung: mittelst der Unterscheidung bestehend besteht das Bewußtsein, an die Unterscheidung gehalten, auf die Unterscheidung gestützt, Genügen suchend gedeiht es auf, reift empor und entfaltet sich. Siehe noch oben Anm. 955 gegen Ende. Es ist in hohem Grade merkwürdig, daß die Gegenseitigkeit der wahrnehmenden Unterscheidung und der zugleich deutlich einsetzenden Willenstätigkeit von keinem geringeren als dem Vater der neueren Erkenntnislehre klar eingesehn und in die entsprechenden Sätze gefaßt wurde: »sicher ist, daß wir nicht irgendetwas wollen können ohne zu gleich wahrzunehmen, daß wir es wollen. – Weil nun aber diese Wahrnehmung und dieser Wille in Wirklichkeit dasselbe ist, wird die Benennung immer nach dem vorzüglicheren gegeben: und so mag man es nicht Empfindung heißen, sondern schlechthin Tätigkeit«: certum est nos non posse quicquam velle quin percipiamus simul nos id velle. – Attamen quia haec perceptio et haec voluntas revera idem sunt, denominatio semper fit ab eo quod nobilius est: et sic non solet appellari passio, sed solummodo actio. DESCARTES, De passionibus, pars I articulus 19 de perceptione. Hier ist wirklich der Punkt gegeben, den KANT gesucht und berührt hat, KRV II 2 2, 3, 7 (ROSENKR. 503f.), wo man durch Vergleichung die versteckte Identität entdecken und nachsehn kann, ob nicht Einbildung, mit Bewußtsein verbunden, eben nichts anderes als Empfindung und Unterscheidungskraft sei. Die Vernunfteinheit aber ist bloß hypothetisch. Hierzu Anm. 668. Die Anfänge solcher Erkenntnis finden wir sogar bei ARISTOTELES, wenn er die bilderschaffenden Unterscheidungen darstellt, τας ειδοποιουσας διαφορας, Eth. Nik. X 4, 2, Top. VI 6, cf. CLEMENS ALEXANDRINUS Strom. VIII fol. 779; wie ja schon dem PLATON die Auslegung der Unterschiedlichkeit kritisch geläufig war, ή της διαφοροτητος ἑρμηνεια, Theait. p. 209 usw. Daher wird der Platoniker NUMENIOS vielleicht so ein Verhältnis im Sinne gehabt haben, da er lehrte: Alles ist gemischt, nichts besteht einfach, Παντα [934] μεμιχϑαι, ουδεν ειναι ἁπλουν, bei MULLACH, Fragm. philos. Graec. III 173 No. 21. GOETHE hat daraus, eigener Anschauung gemäß, das Epirrhema gemacht:
Kein Lebend'ges ist ein Eins,
Immer ist's ein Vieles.
Mit dem geistigen Auge Zeitlosigkeit erschauend spricht JAKOB BÖHME von der Einheit im Gegensatz zur Schiedlichkeit, Tafeln von den drei Prinzipien etc. § 68; gleichwie GOTTFRIED im Tristan v. 1857. den von ihm gemeinten höchsten Begriff der Einheit so angibt:
Wir zwei sin immer beide
Ein ding ân' underscheide.
Ein Sprüchlein, nebenbei, das leise und ungezwungen tiefer zum Gehör des Herzens dringt als all das süße Dröhnen des unendlichen Isoldenparoxysmus. – Nun aber können wir erst das, nach gewöhnlichen und alltäglichen Begriffen und Vorstellungen freilich sinnlose, Rätselwort Meister ECKHARTS von der Indistinctio richtig auflösen, mit unseren Texten im Einklang verstehn: »Alles was sich durch Ununterschiedlichkeit unterscheidet, je mehr es ununterschiedlich ist, desto unterschiedlicher ist es: denn es unterscheidet sich gerade durch seine Ununterschiedlichkeit«: Omne quod indistinctione distinguitur, quanto est indistinctius tanto distinctius: distinguitur enim ipsa indistinctione: eine Glosse zum Liber Sapientiae, oder vielmehr aus dem Kommentar zu diesem, den ECKHART verfaßt hat, zitiert von BIHLMEYER zu SEUSE 355. Die Indistinktion ist also die Distinktion des distinguiertesten Menschen. Das ist jedoch nicht etwa das An-und-für-sich-sein im Sinne HEGELS, sondern es ist das an und für sich Nichtsein des stillen Denkers, wie er in der 140. Rede der Mittleren Sammlung dargestellt wird, S. 1031. Der schaut die Dinge »ohne jedweden Unterschied, aller Gebilde entbildet, und entglichen aller Gleichheit in dem Einen«, sagt SEUSE 347; der hat allen Unterschied aufgelöst, ist ein exemplar aeternitatis, »ein Exemplar der Ewigkeit« geworden, 237. Von außen betrachtet, nach der stehenden Wendung unserer Urkunden, wie oben S. 289: nachdem der ehrwürdige N.N. verstanden hatte ›nicht mehr ist diese Welt‹, war er noch bei Lebzeiten »auch einer der Heiligen« geworden.
979 Vergl. die 29. Rede, S. 510.
980 Vergl. Die 28.Rede, S. 492f. – Die Art des Vorschreitens auf einem schmerzlichen Pfade, wo man langsam verstehn oder auch eilends verstehn lernt, hat der Winterkönig FRIEDRICH VON DER PFALZ mit dem treffenden Worte kommentiert: »Es gibt Tugenden, welche nur das Unglück uns lehren kann«, in SCHILLERS Geschichte des dreißigjährigen Kriegs, erster Teil, erstes Buch, gegen Ende. MOLINOS hat dieselbe Erfahrung durch ein Gleichnis des Sankt GREGORIUS erläutert: Quia ergo nos de medicamento vulnis facimus, facit ille de vulnere medicamentum, ut qui virtute percutimur vitio curemur: Guida spirituale II No. 133 ed. Neapol. 1908. Als weitere Ausführung ist SCHOPENHAUERS Ansicht von der Heilsordnung zu beachten, Hauptwerk II Kap. 49, nach welcher der Zweck unseres Daseins nicht der ist glücklich zu sein, und es demnach richtiger wäre, den Zweck des Lebens in unser Wehe und nicht in unser Wohl zu setzen. Das Leben stellt sich dar als ein Läuterungsprozeß, dessen reinigende Lauge der Schmerz ist. SCHOPENHAUER weist hier insbesondere auf den letzten Brief SENECAS hin, an dessen Schlusse dieser dem Freunde LUCILIUS der Weisheit Krone vor Augen stellt: Tunc beatum esse te iudica, cum tibi ex te gaudium [935] omne nascetur, cum in his quae homines eripiunt, optant, custodiunt, nihil inveneris, non dico quod malis, sed quod velis. Brevem tibi formulam dabo qua te metiaris, qua perfectum esse iam sentias: Tunc habebis tuum, cum intelleges infelicissimos esse felices. SENECA sagt also hier abschließend: Dann wirst du das Deine haben, wenn du verstehn wirst: am unglücklichsten sind Glückliche. Nebenbei bemerkt: das bonum, das SCHOPENHAUER dem tunc voranfügt, ist von ihm nicht »aus dem Vorhergehenden ergänzt«, wie DEUSSEN In seiner Ausgabe II 808 ganz willkürlich angibt, ohne irgendeine Prüfung der Textquellen; sondern es ist das die Lesung fast aller Ausgaben SENECAS und geht auf fünf alte Codices zurück. Erst C.R. FICKERT hat aus den besten Handschriften das Tunc habebis tuum als ursprünglich festgestellt, in seiner mustergültigen, den gesamten Apparat darbietenden Textredaktion, Leipzig 1842, I 737. SCHOPENHAUER hatte also das interpolierte bonum aus einer der zu seiner Zeit gangbaren älteren Ausgaben treulich mitübernommen, etwa der Frankfurter von 1808, vol. I tom. II. 391, wo sich genau der Wortlaut findet, den SCHOPENHAUER bringt, also auch intelliges statt des besseren intelleges, und quum für cum. Man darf demnach den philologisch recht wohlgeschulten SCHOPENHAUER nicht so eilfertig wie DEUSSEN getan einer stillschweigenden Ergänzung aus dem Vorhergehenden bezichtigen. Zutreffend aber könnte man gegen den Philosophen einwenden, daß er das berühmte Schlußwort SENECAS etwas zu einseitig, ja absonderlich pietistisch aufgefaßt habe, da es ihm »allerdings auf einen Einfluß des Christentums zu deuten scheint«: während es in Wahrheit nichts Apostolisches zeigt, sondern die einige Erfahrung aller Weisen, nach welcher Glück, anders betrachtet, Unglück heißen mag, und umgekehrt Unglück eigentlich Glück sein kann: je nach dem Standpunkt, von dem aus man Glück und Unglück betrachtet, als gewöhnlicher Mensch oder als erfahrener Denker. So richtig erkannt bezeugt nun erst das Vermächtnis des großen Römers zugleich eine bis zum wörtlichen Ausdruck reichende Übereinstimmung mit dem Paradoxon der Heiligen, in welchem Gotamo selbst die beiden Begriffe umspannt und sie dargestellt hat, Bruchstücke der Reden S. 174: »Was da, ihr Mönche, in der Welt mit ihren Göttern, ihren bösen und frommen Geistern, mit ihrer Schar von Priestern und Büßern, Göttern und Menschen als ›wohl‹ betrachtet wird, das eben wird von den Heiligen als ›wehe‹, wie es wirklich ist, mit vollkommener Weisheit richtig angesehn: das ist der eine Anblick. Was da, ihr Mönche, in der Welt mit ihren Göttern, ihren bösen und frommen Geistern, mit ihrer Schar von Priestern und Büßern, Göttern und Menschen als ›wehe‹ betrachtet wird, das eben wird von den Heiligen als ›wohl‹, wie es wirklich ist, mit vollkommener Weisheit richtig angesehn: das ist der andere Anblick. Also vollkommen beide Seiten erblickend, ihr Mönche, mag dem Mönche, unermüdlich in heißem, innigem Ernste beharrend, eins von beiden zur Reife gedeihen: Gewißheit bei Lebzeiten oder, ist ein Rest Hangen da, Nichtwiederkehr.« Die letztere Wegscheide oder Alternative erkennt man annähernd gleichsinnig in der Doctrina des heiligen BERNHARD wieder, wo als Ziel des Asketen verheißen wird: aut in morte purgabitur, auti in brevi post mortem, ed. 1621 fol. 1750. – Der schmerzliche Pfad, von dem Sāriputto im Text oben spricht, ist also insofern pariyāyena zu verstehn, je nachdem wie man ihn zu Ende wandert: möglich, daß er zur Heilsordnung hinleiten kann.
981 Vergl. Lieder der Nonnen v. 275-277. Für dhammapadam, der Satzung Pfad, könnte es auch heißen: der Wahrheit Pfad, da dhammo als Satzung, Recht, Norm gewissermaßen auch zur Wahrheit gehört; aber für diesen Begriff haben wir eben das bestimmte, selten gebrauchte Wort saccam, wahr. Gleichwohl entspricht es dem [936] dhammapadam, wenn CELANO einmal sagt: viam apprehendere veritatis, den Pfad der Wahrheit erkunden, war die summa philosophia San FRANCESCOS: Vita duorum annorum cap. II. Er kennzeichnet da seinen Meister höchst lebendig und ganz undogmatisch, aus dem täglichen Umgang mit ihm: Haec summa philosophia eius semper fuit, hoc summum desiderium in eo quoad vixit semper flagravit, ut quaereret a simplicibus, a sapientibus ac perfectis et imperfectis, qualiter posset viam apprehendere veritatis, et ad maius propositum pervenire.
982 Die Ausführung hierzu gibt die 45. Rede der Mittleren Sammlung. – Über die Lebensführung, die gegenwärtiges Wehe und künftiges Wohl bringt, hat bei uns Meister ECKHART am schönsten gesprochen, im Traktat über die Abgeschiedenheit, ed. PFEIFFER p. 492, wo er sagt: »Es gibt nichts Galligeres als Leiden und nichts Honigsameres als Gelittenhaben.« Vollständig übersetzt ist diese Abhandlung, als ein rechtes Musterstück aus ECKHART, in meiner Inneren Verwandtschaft buddhistischer und christlicher Lehren, Leipzig 1891, S. 77-91. Sinnig erfahren spricht auch HEINRICH SEUSE über jene Lebensführung: »Es tut nichts weher«, sagt er, »als sich selbst überwinden: es tut aber nichts wohler, als sich selbst überwunden haben. Und so gehn denn heutigen Tages manche Menschen dahin, blicken über den dornigen Hag, und gehn um den Graben ihre langen Tage herum, getrauen sich nicht vorzudringen durch die Dornen einer freien Verwegenheit, daß sie kämen hin auf die schönen, weiten, blumigen Heiden geistlicher Schönheit. Sie loben die Frucht und hätten sie gerne; aber die Arbeit verdrießt sie: und die Arbeit, die sie da fliehn, die folgt ihnen anderswo«, ed. BIHLMEYER, Stuttgart 1907, S. 431f.
983 paññakkhandho mit S, wie desgleichen im Anguttaranikāyo, ed. Siam, vol. I p. 158.
984 So auch Mittlere Sammlung 1025.
985 Vergl. die 842. Anm. Über den kammakkhayo, die Tatenversiegung, findet sich im Mahābhāratam XIII 338 der Spruch:
Gleichwie die Lampe, wenn das Öl
Versiegt, alsbald zur Neige geht:
So muß das Schicksal, wenn die Tat
Versiegt, alsbald zur Neige gehn.
Hierzu noch eine Upanischadenstelle, und als Grundlage ein Lehrsatz der Jainās, in Anm. 1009, erster Absatz Ende, erweisbar. – Die Selbstbestimmung des Menschen und seines Tuns ist im Anguttaranikāyo, Chakkanipāto No. 63, ed. Siam. p. 128 (PTS 415), so ausgesprochen: »Aus dem Denken, sag' ich, ihr Mönche, geht die Tat hervor: nachdem man gedacht hat vollbringt man die Tat in Werken, Worten und Gedanken.« Alles kommt auf die Gesinnung an, in der eine Tat geschieht; unbeabsichtigte Übeltat kommt dem Täter so wenig zu wie unbeabsichtigte Wohltat, Mittlere Sammlung 409-411. Ein Frevel, aus verderbter Gesinnung begangen, kann vieltausendjährige Folge haben, wie bei Dūsī, ebenda 367; und ungeheure Missetaten können durch glühende Läuterung alsbald zunichte werden, wie bei Angulimālo, S. 663. Das erste Aufleuchten dieser Erkenntnis wird im Bṛhadāraṇyakam III 2 Ende nach einem Gespräch von Yājñavalkyas dem Ārtabhāgas gegenüber noch als rahasyam, Geheimnis, betrachtet, als ein aracanum et silendum: davon redet man nicht vor den Leuten, nur der Weise vertraut es dem Weisen an: puṇyo vai puṇyena karmaṇā bhavati, pāpaḥ pāpena iti, »heil, wahrlich, wird man durch heilsame Tat, übel durch üble«. Der Satz – bei außerordentlicher Tiefe scheint er zuerst gar seicht zu sein, wie es einem beim Blick auf den Grund eines Alpensees ergeht – ist nach und nach die bekannteste Subsumtion, [937] die selbstverständliche Voraussetzung indischen Denkens geworden; und das ganze Jātakam ist nichts anderes als seine volkstümliche Ausgestaltung. Er speist diese unvergleichliche, reichste Legendensammlung der Welt als ihre unterirdische Quelle, strömt immer wieder und oft wortgetreu empor, auch als die zuständige Mahnung des Pārā aryas, eines vedischen Führers, der nach dem Zeugnis der letzten Rede der Mittleren Sammlung (1083f.) ein Zeitgenosse Gotamos war. »Das ist das Meisterwort«, heißt es z.B. Jātakam No. 222 und 353, »das Pārāsariyo gesagt hat:
Nichts Übles sollst du wirken aus,
Was dann dir leid wär' als getan:
Was irgend auch der Mensch vollbringt,
Erfährt er wieder an sich selbst.
Wer heilsam wirkt wird Heil gewahr,
Wer übel wirkt zieht Übel auf:
Der gleiche Same, den man sät,
Ist auch der Ernte gleiche Frucht.«
Weitere Beisteuer ist in der Mittleren Sammlung Anm. 363 gegeben, als Rahmen um den einhelligen Merkspruch GOTTFRIEDS:
Wir m zen sniden unde mæjen
Daz selbe, daz wir dar gesæjen.
Jene ewige Gerechtigkeit, wie SCHOPENHAUER das kammam nennt, ist durch die Volksweisheit im 41. Märchen GRIMMS mit dem überraschenden Abschluß gekerbt: »Der Herr Korbes muß ein recht böser Mann gewesen sein«, als der Mühlstein herabfiel und ihn totschlug. Dieselbe Begebenheit ist aber im 222. Jātakam erzählt und begründet.
986 Nachweise in der Mittleren Sammlung Anm. 503.
987 Über den Begriff der Woge, ogho, handelt das Gespräch des Meisters mit Kappo, Bruchstücke der Reden v. 1092-1095. Nicht minder bedeutend ist eine Ansprache an die Jünger, im vierten Bande des Saṃyuttakanikāyo mitgeteilt. »›Der Ozean, der Ozean‹, das, ihr Mönche«, sagt Gotamo, »ist der Ausdruck eines unerfahrenen, gewöhnlichen Menschen. Nicht das gilt, ihr Mönche, im Orden des Heiligen, als Ozean; eine gewaltige Wassermenge ist das, ihr Mönche, eine gewaltige Fülle von Wasser. Das Auge, ihr Mönche, ist der Ozean des Menschen, und aus Gestalten hebt ihm der Sturm an. Wer diesen Sturm von Gestalten überkommen kann, von dem heißt es, ihr Mönche, daß er den Ozean des Auges gekreuzt hat, mit den Wellen und Wirbeln, mit Schlünden und Raubgetier, daß er entronnen, hinübergelangt, heilig ans Ufer getreten ist. Das Ohr, ihr Mönche, ist der Ozean des Menschen, und aus Tönen hebt ihm der Sturm an. Wer diesen Sturm von Tönen überkommen kann, von dem heißt es, ihr Mönche, daß er den Ozean des Ohres gekreuzt hat, mit den Wellen und Wirbeln, mit Schlünden und Raubgetier, daß er entronnen, hinübergelangt, heilig ans Ufer getreten ist. Die Nase, ihr Mönche, die Zunge, der Leib, das Denken, ihr Mönche, ist der Ozean des Menschen und aus Gedanken hebt ihm der Sturm an. Wer diesen Sturm von Gedanken überkommen kann, von dem heißt es, ihr Mönche, daß er den Ozean des Denkens gekreuzt hat, mit den Wellen und Wirbeln, mit Schlünden und Raubgetier, daß er entronnen, hinübergelangt, heilig ans Ufer getreten ist.
[938] Wer diesen Ozean, mit Schlünden, Raubgetier,
Der Wellen furchtbar Dräuen überkommen kann,
Der weiß das Letzte, heilig angelangt am Ziel:
›Weltendig ausgegangen‹ ist er, wie man sagt.«
Nach der ed. Siam. vol. IV p. 195 dhammamayaṃ vegaṃ, sa vedagū etc. zu lesen (PTS 157). Eine verwandte Stelle in der 67. Rede der Mittleren Sammlung, wo ebenso metaphorisch die Wassergefahr von Welle und Wirbel, Krokodil und Hai genannt ist; während hier mit dem Raubgetier des Ozeans außer den an der Oberfläche wimmelnden Haifischen zumeist die Riesenpolypen oder Kraken der Tiefe begriffen sind. Ein ähnlicher Ausdruck im Mudrārākṣasam VII v. 7: bhīmaḥ kena ca naikanakramakaro dorbhyāṃ pratīrṇo 'rṇavaḥ, wer ist geschwommen durch die Flut, die voll von Ungetieren ungeheuer droht. Ferner wird bei uns IV 254 (206) der Mythos vom Höllenrachen der Unterwelt, die altindische Vorstellung vom unterseeischen Feuer, pātālam, das nach dem Volksglauben unter dem Meeresgrunde sich hinzieht, Verständigen verständlich betrachtet: »Der unerfahrene, gewöhnliche Mensch, ihr Mönche, redet also: ›Im Grunde des Ozeans ist das höllische Feuer.‹ Das aber, ihr Mönche, wird vom unerfahrenen, gewöhnlichen Menschen gesagt und ist nicht wahr und gibt es nicht: eine solche Bezeichnung, ihr Mönche, kommt den körperlichen Peingefühlen zu: die sind das höllische Feuer. Wird, ihr Mönche, der unerfahrene, gewöhnliche Mensch von körperlicher Pein betroffen, so wird er traurig, beklommen, er klagt, er schlägt sich stöhnend die Brust, gerät in Verzweiflung. Den heißt man, ihr Mönche, einen unerfahrenen, gewöhnlichen Menschen, der sich über das höllische Feuer nicht erhoben, die Furt nicht gefunden hat. Wird aber, ihr Mönche, der erfahrene, heilige Jünger von körperlicher Pein betroffen, so wird er nicht traurig, nicht beklommen, er klagt nicht, schlägt sich nicht stöhnend die Brust, gerät nicht in Verzweiflung. Den heißt man, ihr Mönche, einen erfahrenen, heiligen Jünger, der sich über das höllische Feuer erhoben, die Furt gefunden hat.« Wer nun so das unterseeische Feuer und alle Wasser des Ozeans vollkommen kreuzen konnte, von dem gilt dann jener Stempel, der ebenda III 80 (90) gegeben ist: man heißt ihn, in Kürze gesagt »einen Mönch, der weder aufschichtet noch abschichtet, abgeschichtet dasteht; der weder wegzieht noch anhangt, weggezogen dasteht; der weder abwickelt noch aufwickelt, abgewickelt dasteht; der weder abräumt noch zuräumt, abgeräumt dasteht.« Vergl. die Vorstufe, Mitte der Anm. 767. Gegen Ende des vierten Buches der Chāndogyopaniṣat wird dem jungen Upakosalas von seinem Meister Satyakāmas der heilige Pfad, brahmapathas, ähnlich gewiesen: wer auf dem dahinwandelt kehrt in diesen menschlichen Wirbel nicht mehr zurück. Später reiht sich noch an die vetā vataropaniṣat I v. 5, mit den gleichen Wellen und Wirbeln im Sturme des Leidens. Sankt BERNHARD hat unsere beiden Gleichnisse vom Ozean und vom Höllenrachen der Unterwelt auf eine wunderbar entsprechende Weise aneinandergeschlungen, zu Beginn seiner Schrift über das Bewußtsein. »Das Bewußtsein des Menschen«, sagt er, »ist eine vielfache Hölle. Denn gleichwie die Tiefe der Hölle nicht erschöpft werden kann, so kann das Herz des Menschen nicht leer werden von seinen Gedanken. Das Bewußtsein des Menschen ist wie die hohe weite See mit ihrem Gewürm ohne Zahl«: Conscientia hominis abyssus multa. Sicut enim profundum abyssi exhauriri non potest, ita cor hominis evacuari non potest a cogitationibus suis. Conscientia hominis est quasi mare magnum et spatiosum, ubi reptilia quorum non est numerus. Liber de conscientia, ad quendam religiosum Ordinis Cisterciensis, ed. Par. 1621 fol. 1106 E. Hundert Jahre später hat ANTONIUS von Padua dieselbe [939] Metapher in einer seiner Reden angewandt, aber nach außen gekehrt: Moraliter mare est mundus. Nota sicut in mari sunt infinita monstra, sie mundus producit multa monstra, ed. DE LA HAYE 1739 fol. 45b. Die Erfahrung ist gleich, ist da wie dort eine und dieselbe mit der des Frankfurters in der Deutschen Theologie, Kap. 49: »wäre nicht eigener Wille, so wäre auch keine Hölle und auch kein böser Geist.« – Zum unterseeischen Feuer sei beiläufig noch vermerkt, daß EMPEDOKLES, der außerordentlich viel aus Indien über Ägypten bezogen haben muß, auch diese ungewöhnliche Vorstellung wiedergibt, wenn er sagt Πολλα δ'ενερϑ' ύδεος πυρα καιεται, »Viele doch sind unterm Wasser Feuer entflammt«: trotz dem Ätna ist es der pātālaviṣayaḥ, wie er so im Rāmāyaṇam wiederholt erscheint. Das kann keine zufällige Übereinstimmung sein: allzu reichlich sind die Fragmente des großen Agrigentiners, wo er bis zu durchleuchtenden Einzelzügen altindische Vorstellungen und Gedanken einflicht; siehe die Belege in den Bruchstücken der Reden Anm. 502 Ende. Es wird also Jahrhunderte vor ALEXANDER schon mancherlei Hörensagen nach Westen gedrungen, auf sizilischen und unteritalischen Pflanzstätten sinnig empfangen worden sein. COLEBROOKE, bis heute noch der scharfsinnigste aller Indologen, hatte das bereits 1827 erkannt. Im letzten seiner meisterhaften Aufsätze über die Philosophie der Hindus ist er zu dem Ergebnis gekommen, daß es gerade die vorplatonischen, nicht die späteren, griechischen Denker sind, die sich als die Schüler indischer Meister bewähren: Miscellaneous Essays, Ende des 1. Bandes. Die herrliche Blütenfülle der sogenannten Vorsokratiker wäre also ohne indische Pflege nie erschienen. Was nun insbesondere den, von Gotamo freilich abgelehnten, eigentümlichen Volksglauben anlangt, daß unter dem Meer das höllische Feuer brenne, so hat dieser mehr als zwanzig Jahrhunderte überdauert, ist z.B. noch im RABELAIS zu finden, der hier wie oft bei anderen Fällen wiederum gern indische Kunde vermittelt. Denn er spricht von den »plainctz, souspirs, effroys et lamentations en toute la machine de l'uniuers, cieulx, terre, mer, enfers«, Pantagruel IV 28. Es ist das bekannte purāṇische Weltbild: erst die Himmel, in der Mitte die Erde, dann das Meer, darunter die Höllen, und zwar diese wie jene in der Mehrzahl.
Das oben nach dem Saṃyuttakanikāyo gezeigte Gleichnis und Verhältnis zwischen Meer und Mensch ist, in anmutiger Form, von BABRIOS behandelt. Ein Landmann, erzählt er uns, sah ein Schiff im Kampf mit den Wogen dem Untergang nah. »O Wellenflut«, sagte er, »daß man doch nie dich beführe, dich unbarmherziges Element, den Feind der Menschen.« Das vernahm aber die See, und weibliche Stimme annehmend sprach sie: »Nicht sollst du mich lästern. Denn nicht ich bin euch Anlaß davon: die Winde sind's, unter all ihnen lieg' ich zumitten. Fern von diesen wenn du mich siehst und befährst, wirst du mich sanfter noch heißen als deine Erde«, ed. SCHNEIDEWIN No. 71. Und damit sind wir wieder zur γαληνῃ ἡσυχιᾳ τε εν τῃ ψυχῃ des PLATON gekommen, oder zu unserer »inneren Meeresstille«, Mittlere Sammlung 382 usw. Die Stürme aber, von denen eingangs dieser Anmerkung die Rede ist, die den Menschen rütteln und reißen als Sturm von Gestalten, Sturm von Tönen, Düften, Säften, Tastungen, Sturm von Gedanken, diese Stürme hat TASSO in seinem Dialog, benannt nach dem neapolitanischen Philosophen PORZIO, ungefähr Mitte der Unterredung auf gleiche Weise gekennzeichnet: sono quasi
Venti contrarj alla vita serena.
Worauf er PORZIO gar fein bemerken läßt: Ed alcuna volta la tranquillità della mente è simile a quella del monte Olimpo, nella sommità del quale, come si dice, le nevi e le pioggie non sogliono cadere per alcuna stagione. Aus so fern voneinander abgelegenen [940] Zeiten und Ländern auch all diese Blätter herstammen, sie sind sämtlich den Ästen und Zweigen unserer gemeinsamen Weltesche entsprossen, sind nur von dem einen Saft und Lebensgeist erzeugt und durchdrungen; und wenn die Wurzeln tief in die indische Erde hinabreichen, die Wipfel wehen über die ganze Welt dahin, sie raunen uns überall ihre sanfte Botschaft: warte nur, balde ruhest du auch. Das ist die indo-europäische Konkordanz. Als Gegenstück dazu ist in neuerer Zeit von gewissen Völkerpsychologen ein drollig behängter Maibaum aufgepflanzt worden, an dem die Erkenntnisse und Aussprüche der Vedendichter und -denker und ihre Zauber mit dem Zauber von Totem, Orenda und Orrenda australischer Menschenfresser, Melanesier und Huronen vernestelt sind: als ob Zauber und Zauber alles eins wäre, und es nur faulen Zauber gäbe. Diese kosmopolitische Professorenbiomantik nimmt in unserer Zeit die Stelle der rage d'éclaircissement der Enzyklopädisten ein, die aber unvergleichlich verständiger waren. Unter dem Schein einer logischen und prälogischen Wissenschaftlichkeit sucht sie Hindu und Neger, Prometheus und Fitzliputzli, Charis und Teufelsfratze miteinander zu verquicken. Richtig ist ja, daß alles zusammen nur eine Familie ausmacht: wobei aber von dem einen kulam, Geschlecht, nach der einen Seite der kulaputto, der Sohn aus edlem Hause, dem verwandten Clan des Hochländers usw. sich zugesellt; während auf der anderen Seite der Bastard bis zum dürftigen Taglöhner, Tintenkuli usw. herab verkümmert. Solche sondernde Anthropologie ist nun freilich nicht nach dem Gaumen der Kochkünstler vom Katheder. Die halten es lieber mit jenem polackischen Garkoch, der meinte: Knoblauch ist gut, Schokolade ist gut: wie gut wird erst sein Schokolade mit Knoblauch. Man könnte still lächelnd daran vorbeisehn, wenn nicht rühmlich ergraute Fachgelehrte an dem Ulk hin- und herbaumelten, wie z.B. OLDENBERG in seiner »Religion des Veda« und »Lehre der Upanishaden«, in welch letzterem Buche er S. 10 »namentlich auf das geistvolle Werk von L. LÉVY-BRUHL«, das neuste oblectamentum puerorum, hinweist und S. 342 Anm. 13 noch eine Masse anderer gleich schmackhafter Wälzer empfiehlt: ein reiches Büffet, dem ich noch etwa einzureihen bitte die preisgekrönte Anthropologie von BIERSCHNECK und SCHRAMPELMAYER.
988 Die allerhand Priester und Asketen, Kenner und Bekenner usw. pflegen da meistens zu sagen: »Dies nur ist Wahrheit, Unsinn anderes«, oben S. 377 und oft in der Mittleren Sammlung; vergl. Bruchstücke der Reden v. 832, 895, auch 884:
Nur eine Wahrheit, keine zweite ist es,
Um die der Kenner streitet mit dem Kenner;
Verschieden preist ein jeder seine Wahrheit:
Darum nicht künden Gleiches an Asketen.
Sie pflegen also Zueignung umgekehrt zu dem, der da sagt:
Dich nenn' ich nicht. Zwar hör' ich dich von vielen
Gar oft genannt, und jeder heißt dich sein,
Ein jedes Auge glaubt auf dich zu zielen,
Fast jedem Auge wird dein Strahl zur Pein.
Der gewitzigte Denker, im Gegensatz zu den meisten, gewöhnlichen Asketen und Priestern, will nie und nirgend seine Wahrheit, die ihm geworden ist, jemandem aufdrängen oder empfehlen, er meidet alles Behaupten. Er ist der ekasacco, der das eine was nötig ist weiß: gegenüber dem, der vielerlei Wahrheit weiß, dem bahusacco, und dem paccekasacco, dem, der allerhand einzeln gültige Wahrheiten weiß: vergl. später [941] Anm. 1038. Durch das Ablehnen dessen, was man so unter Wahrheit versteht, ist im Hochfluge Meister ECKHART bis zu jener Folgerung vorgedrungen, die er unbestochen von irgendwelchen überkommenen Ansichten derart bestimmt, ed. JOSTES p. 90: Das gemeine Verständnis nimmt alle Dinge als wahr an, und der Wille alle Dinge als gut: das ist eben nichts anderes als die Neigung des Sinnes; aber Gott ist weder gut noch wahr, wan got enist noch gut noch wor. Bei so gänzlich geläuterter, ja schon gänzlich kantischer Abschätzung der Wahrheit kommt nun wer das eine was nöthig ist weiß nach und nach dahin nur selten und wenig zu reden, sein stummes Beispiel genügt Verständigen: nichts sagend viel verheißend, es ist das lebendige Favete linguis. Er gibt seine Belehrungen durch Schweigen, sagt LAO-tse I 2, 10; das heißt, erklärt der Kommentar, er unterweist durch sein Beispiel und nicht durch Worte: nach JULIEN p. 4, 43-46, 125, 9. Er besiegelt, unzerstörbar, unvergeßbar, das kantische Wort: »Hier wie überall ist das Beispiel allmächtig und befestigt oder vernichtet die gute Lehre.« Es reiht ihn jenen Geistern an, denen unverlautender Einklang mehr gilt als verlauteter, άρμονιη γαρ αφανης φανερης κρειττων, καϑ' 'Ηρακλειτον. APOLLONIOS von Tyana, der in Indien Miterfahrene und schon pythagoreisch Ungesprächige, hat gern auch an der stillen Beredsamkeit ein ihm gemäß erscheinendes Muster genommen, als er auf die Bitte eines Jüngers, von seiner großen Weisheit doch zu vermelden, sagte: Ουπω εσιωπησα, Ich habe noch nicht ausgeschwiegen, Vita lib. I cap. 11. Auf ihn und indische Typen paßt vorzüglich was NONNOS sagt, Dionysiaca VII 18: Die Wimpern waren zum Wort, die Hand zum Ausdruck, die Finger zur Sprache geworden, Νευματα μουϑον εχων, παλαμην στομα, δακτυλα φωνην. AGATHON, einer der eremitischen Väter zur Zeit des ANTONIOS und des ersten MAKARIOS in der Thebaïs, hat im bewußten Gegensatz zu DEMOSTHENES drei Jahre lang einen Stein im Munde getragen um die Kunst des Schweigens zu er lernen: MACARII Aegyptii Epist. ed. FLOSS p. 150. Merkwürdige Gestalten hierzu findet man in Bakkulo, Mittlere Sammlung No. 124, und in Gangātīriyo, der innerhalb zweier Jahre einmal einen Satz geredet hat, Lieder der Mönche v. 127f.; auch in Valliyo, ib. v. 167f., der schweigend dahinzieht wie der Ganges zum Meer (ein monagangam gleich dem tūṣṇīṃgangam im Scholion zu Pāṇinis II 1 21, nb). Die Brahmavidyopaniṣat hat am Ende den Spruch:
Yasmin saṃlīyate abdas
tat paraṃ brahma gīyate.
In wem verlauten ist verstummt
Hebt an zu singen höchstes Heil.
Es entwickelt sich in seiner stummen Einigung und Verinnerlichung die himmlische Hörkraft, dibbā sotadhātu, das himmlische Gehör, dibbasotam, das unsere Texte stets als Vorstation auf der Entdeckungsreise, als Mittelstufe zu den letzten Ergebnissen des Heiligen darstellen, wie Mittlere Sammlung 576, dann in unserer 2. Rede S. 53 und oft. So aber weist auch JAKOB BÖHME auf den stillen Jünger hin, in dem das ewige Hören, Sehn und Sprechen offenbar wird: Der Weg zu Christo VI 3; in der Anmerkung 227 der Lieder der Nonnen ist der kurze Abschnitt ganz gegeben. SEUSE, der herrliche Kämpfer, wollte nichts wissen vom Reden über die Wahrheit. »Da kommen sie denn«, sagt er, »und sprechen: ›Eia, Herre, sage uns von der höchsten Wahrheit!‹ Waffen, dem Worte bin ich so recht unhold. Pilatus fragte unseren Herrn Jesum Christum, was die Wahrheit wäre, und Christus schwieg.« Nach innen gewandt: »in dem verborgenen, überunbekannten, überglänzenden, allerhöchsten Giebel, da hört man [942] mit stillsprechendem Schweigen Wunder, Wunder.« S. 514 u. 190 der Ausgabe BIHLMEYERS, Stuttgart 1907. MOLINOS hat das erste Buch seines Geistlichen Führers mit dem Kapitel über das innere Schweigen, del silenzio interno, beschlossen. Drei Arten von Schweigen gibt es, sagt er. Das erste an Worten, das zweite an Wünschen, und das dritte an Gedanken. Das erste ist sehr gut, besser das zweite, und am besten das dritte. Beim ersten erwirbt man die Tugend, beim zweiten erlangt man die Ruhe, beim dritten die innere Sammlung. Wer weder spricht, noch wünscht, und auch nicht mehr denkt, der gelangt zum echten und vollkommenen Stillschweigen. Da wird dann die innere göttliche Stimme vernommen. – Hübsch erzählt gelegentlich AGRIPPA VON NETTESHEYM: Ein einfältiger und ungelehrter Mensch, simplex et idiota, habe einen in den Wissenschaften ungemein bewanderten, wohlerprobten Philosophen mit wenigen Worten besiegt, paucis verbis devicisse, obzwar dieser selbst den profundesten Gelehrten und Bischöfen am Konzil von Nikäa trotz all ihrer unablässigen und gar eindringlichen Disputationen unüberwindbar und unbekehrbar geblieben war. Als der Philosoph dann von seinen Freunden gefragt wurde, wie er sich denn jenem Tropf unterwerfen mochte, er, der so viele hochweise Kirchenväter übertrumpft hatte, sagte er: den Bischöfen habe er leicht für Worte wiederum Worte gegeben; jenem Einfältigen aber, der nicht aus menschlicher Weisheit sondern aus dem Geiste sprach, habe er nicht widerstehn können: De incertitudine et vanitate scientiarum, Kölner Ausgabe 1584, Kap. 102 Ende. Weitere Beziehungen der Art in den Acta Sanctorum, Jan. t. II 147-148, im Leben des PAULUS SIMPLICISSIMUS, des schweigsamen Antonianers der Thebaïs. Das gilt aber nicht bloß für das höhere geistige Leben, es gilt sogar mitten im gewöhnlichen Weltgetriebe: auch da ist der wirklich große Betätiger fast immer im Bunde der großen Schweiger, hat wie WILHELM VON ORANIEN den Wahlspruch: Saevis tranquillus in undis. Einen denkwürdigen »Beweis« für diesen Mannescharakter, der sich je nachdem ebenso unverbrüchlich schweigsam als überraschend beredsam bewähren kann, gibt SCHILLER in der Geschichte des Abfalls der vereinigten Niederlande, 1. Buch vorletztes Kapitel, wo das unbegrenzte Vertrauen KARLS v. zu dem jungen Manne zeigt, »daß er als Knabe schon angefangen haben mußte den ruhmvollen Beinamen des Verschwiegenen zu verdienen.« Eines der schönsten Bilder hat Don ANTONIO DE MENDOZA mit dem funkelnden Schweigen des Diamanten gegeben: alma sin voz, silencio de diamante, in GRACIANS Agudeza y arte de ingenio, Discurso XIII. Andere Hinweise noch in Anm. 202; reichlicher in den Bruchstücken der Reden, Anm. 723, wo bis nach China und Japan der Bund der Zen-ṣū, der Orden der wortelosen Schauung, vermerkt ist. Längst vorher hatte schon LAO-tse sein Vermächtnis also eröffnet: »Die Spur, die durch Worte bezeichnet werden kann, ist nicht die ewige Spur; der Name, der genannt werden kann, ist nicht der ewige Name«, Tao-te-king, ed. JULIEN, Paris 1842, I 1, 1. Ungefähr um dieselbe Zeit, im 6. Jahrhundert vor Christus, waren die vedischen Denker zum gleichen Ergebnis gelangt, noch erhalten in den treu erinnerten Stellen der Maitrāyaṇīyās, nach ihrer Upanischad VI v. 22, auch in der Brahmabindu v. 17 und dann weiter herab bis zur Tripurātāpinyupaniṣat V v. 17, und es ist von da her der Smṛti wie dem Purāṇam vertraut geworden: das brahma oder höchste Heil ist doppelter Art: ein lautbares Heiltum, abdabrahma, und ein Heiltum darüber hinaus, voce melius, paraṃ ca yat; im lautbaren brahma gebadet geht man ein zum höchsten brahma. CLEMENS ALEXANDRINUS mußte wohl davon wissen, denn er überliefert: Es gibt zwei Urbilder der Wahrheit, eins sind die Namen und eins die Dinge: δυο εισιν ιδεαι της αληϑειας, τα τε ονοματα και τα πραγματα, Stromata VI fol. 689 D der Kölner Ausgabe 1688. – Der Begriff sīlabbataparāmāso, [943] sich klammern an Tugendwerk, ist umfassend dargestellt in den Bruchstücken der Reden: siehe dort das Register I s.v. Tugendwerk; auch Anmerkung 231. Unser oben im Text gebrauchter Ausdruck »Knoten des Körpers«, kāyagantho, für Begier usw., ist eine Metonymie oder lakṣaṇā, die aus den alten Upanischaden übernommen wurde, nach der Chāndogyā VII Ende: sarvagranthīnāṃ vipramokṣaḥ, »Auflösung aller Knoten«, Kāṭhakā VI v. 15: yadā sarve prabhidyante hṛdayasyeha granthayaḥ, »wann alle Knoten des Herzens hier zerfallen«, Muṇḍakā II 2 v. 8: bhidyate hṛdayagranthiḥ, »es zerfällt der Herzensknoten«. Bei manchen Büßern und Asketen, die sich als von allen Fesseln befreit erklären, ist der schöne alte Begriff veräußerlicht worden. Die Ājīvikās oder Freilebenden und die Jainās oder Sieger nennen sich mit Vorliebe Nirgranthās, Fessellose, wörtlich: Knotenlose, weil sie ganz unbekleidet einhergehn, Nacktwandler sind, nagnāṭās, den Himmelskreis zum Gewande haben, digvāsasas; von Halāyudhas treffend bemerkt in der Abhidhānaratnamālā ed. AUFRECHT II 190: na gnāṭo digvāsā jainaḥ ājīvo nirgranthaḥ kathyate. Bei uns oben ist nun aber der kāyagantho oder Knoten des Körpers durchaus nur so wie in jenen früheren Upanischaden, also innerlich, geistig verstanden: und damit ist die klägliche Zucht ohne Anstand, wie sie die Nackten Büßer, die Fessellosen, die Freien Brüder, die Jainās als bemitleidenswerte Schwärmer betreiben, wiederum nach Art der Edlen stillschweigend abgelehnt. Vergl. noch Anm. 748. Beiläufig: der Ausdruck kāyagantho, »Knoten des Körpers«, für Begier usw., klingt uns wohl etwas befremdlich; er zeigt aber die gemeinte feste Verknüpfung so kräftig an, als wie etwa wenn die sterbende Cleopatra zur Natter spricht:
With thy sharp teeth this knot intrinsicate
Of life at once untie.
Dichter und Denker haben beide eine vollkommen sinnliche Anschauung vermittelt.
989 Die gleiche Einteilung der Wesen je nach der Art ihrer Entstehung, wie sie Sāriputto hier gibt, gemäß der 12. Rede der Mittleren Sammlung, S. 83, ist noch im 5. Jahrhundert nach Gotamo beibehalten, sorgsam wiederholt auf der Weihinschrift rings um die Reliquienurne, die in einem der Kuppelmale bei Khawat, im Bezirk von Wardak in Afghanistan, aufgefunden wurde. Damit ist die genaue Kenntnis unserer Texte, selbst in so feinen einzelnen Bestimmungen, bis weit hinauf nach Nordwesten für diese Zeit sichergestellt. Es war da am Grunde des Kuppelmals ein Aschenrest vom Leibe Gotamos in einer bronzenen Votivurne beigesetzt worden, als Zeichen der Verehrung und zum Heile des »großen Königs und Oberkönigs Hoveṣkas (Huviṣkas)« usw., mit dem Wunsche, daß diese Stiftung »allen Wesen zum Wohle gereichen möge«, und zwar »den aus der Feuchte entstandenen, den aus dem Ei geborenen, den aus dem Leibe gezeugten und den unkörperhaft erscheinenden.« In diesen »viererlei Schooßen« ist denn allerdings jede mögliche Daseinsart beschlossen. Die Inschrift wurde neulich von PARGITER in der Epigraphia Indica vorzüglich faksimiliert und besprochen, XI 202-219. Zu berichtigen ist nur aphatiga, auf Zeile 3, S. 211: denn der Abklatsch zeigt unzweifelhaft opao, und zu Beginn des Wortes wird nicht a sondern o zu lesen sein; also opatiga, d.i. oppattiko, uppatitko, eine Variante zu unserem opapātiko, da ja uppatti und upapatti einander gleich gebraucht werden. Der aṇḍajayoni entspricht aṃḍajo, der jalābujao jalayuga und der saṃsedajao adra-aṃtarao. Alle vier Begriffe sind hiermit tadellos überliefert und bestätigt. Ein gleiches Schema schon nach der Bahvṛica ruti in der Aitareyopaniṣat V 3 und in der merkwürdigen kleinen Bahvṛcopaniṣat, Bombayer 108 Upanischaden p. 853a, desgl. im Vedāntasāras 130: arīrāṇi tu jarāyujāṇḍajasvedajodbhijjākhyāni. Die medizinische Wissenschaft hat diese Einteilung [944] beibehalten, Su rutasaṃhitā I 22 jarāyuja-aṇḍaja-svedaja-udbhijjao: in den letzten vegetalen Begriff war auch da jenes nach unserem Schema nur geistig geltende opapātiko, aupapātikaḥ, eingegangen, obzwar es die Smṛti ebenso nicht anders als geistig und geistlich kennt, nach Manus II 147f., utpādayati yasmiṃ saḥ, womit noch Vāsiṣṭhadharma āstram II 5 zu vergleichen ist. Für oppattiko, uppattiko, als opapātikayonijo, aus dem Schoß der Erscheinung hervorgegangen, kann man demnach sehr wohl sagen: geistige Geburt, oder wie sich König Hoveṣkas ausdrückt: unkörperhaft erscheinend. Damit sind nun aber jene Wesen ferner brahmischer Sphären gemeint, deren Geburt anders als nach den drei genannten irdischen Umständen sich ereignet, eben auf die vierte und letzte noch mögliche Art einer unkörperlichen Entstehung, die nach allgemein indischer Annahme ihren eigenen Gesetzen folgt. Jene überirdischen Gestalten, die auf solche Weise zur Erscheinung gelangen, nennt daher Yājñavalkyas Götter von Geburt, ājānadevās, in der Bṛhadāraṇyakā IV 3, 35: sie sind in die höheren Kreise hinzugeboren, unterhalb der eingebornen Götter, nämlich der Sonnengeister usw. WEBER hatte sie schon nach der Vājasaneyisaṃhitā 31, 17 etc. richtig erklärt als diejenigen Sterblichen, »welche im Götterhimmel wiedergeboren werden und daselbst so lange verweilen, bis ihre Zeit abgelaufen ist und sie wieder herab müssen«, Indische Studien II 227f. Es gibt aber auch solche, die nicht mehr zurückkehren, von dort aus auf ewig entfahren, die von jenseit aus, nach Überwindung auch jener Welt, restlos erlöschen, opapātikā tattha parinibbāyino anāvadittidhammā tasmā lokā: s. Anm. 623. Die opapātikayoni, der Schoß der Erscheinung, ist also nur ein anderer Ausdruck für das ājānadevatvam, die göttliche Kindschaft, und ist diesem altvedischen Begriffe ganz gleich. Himmlische Naturgeschichte der Art ist bekanntlich auch christlichen Mythologikern nicht verborgen geblieben. Die höchste Versinnlichung findet sie da im Gottessohn; und über dessen geisthafte Abstammung spricht wieder am schönsten Meister ECKHART, ed. PFEIFFER p. 407, wenn er sagt, es »ist der Herr Jesus gar eines hohen Adels: denn er hat einen Vater im Himmel ohne Mutter, und hat auf Erden eine Mutter ohne Vater; und darum ist sein Adel so wunderlich, daß ihn keines Menschen Sinn begreifen mag.« Ein geistiger Göttersohn einer derartigen aber weit älteren Linie ist bei uns z.B. Sanankumāro, der Ewige Jüngling, Mittlere Sammlung 393, und oben S. 325, 345, im Kreise der Dreiunddreißig Götter auch Gopako, dessen Entwicklung ausführlich erzählt wird, ebenda 369-371, und viele andere noch. – Wie aber die von König Hoveṣkas bezeugte Reliquienverehrung in einem feineren Sinne zu verstehn, geistig zu deuten sei wie seine ganze Botschaft, das lehren die schönen Gedanken in unserer 16. Rede, 281 und 295f., nebst der Anm. 497. Im groben Verstande dagegen nimmt das Volk freilich auch in Indien bei der Reliquie – es sind meist winzige Reste und Kügelchen aus der Knochenasche – eine gewissermaßen natürliche Fortwirkung an: so etwa wie bei einem getrockneten Baumblatt oder Heilkraut die einst darin lebendigen Eigenschaften und Kräfte virtuell immer noch weiterwirken. Beide Arten der Verehrung kommen übrigens zuletzt in dem Satz überein, den AGRIPPA nach den Platonikern angibt: id quod immortale est, mirabilia operari non cessat, De occulta philosophia I cap. 21: De virtutibus rerum quae insunt ipsis in vita tantum, et quae remanent in illis etiam post interitum, Lyoner Ausgabe 1550, p. 48. Beiläufig bemerkt ist es auffallend, daß jene Reliquien, in alter Zeit stets nur in Gefäßen aus Bronze, Stein, Trachyt, Kristall beigesetzt wurden, nie in solchen aus Gold und Juwelen, wie man doch erwarten sollte. Immer sind es edelgeformte kleine Urnen aus unzerstörbaren gewöhnlichen Rohstoffen, in Piprāvā, Niglīva, Takha ilā, Sopārā, Bhaṭṭiproḷu und überall: siehe meine Zusammenfassung »Die ältesten indischen Votivurnen« in der Österreichischen [945] Monatsschrift für den Orient, 40. Jahrg. S. 94f., auch Anm. 285, 471, 492, 514. Dafür lassen sich zwei Gründe angeben, ein äußerer: man wollte, sehr klug, etwa künftiger Raubgier keinen Anlaß bieten; und ein innerer: das Andenken des Erhabenen sollte nicht obenhin prunkend und gleißend, nur schlicht und unaufdringlich behandelt werden. Darum wurden jene Phiolen und Reliquienschreine aus dauerhaftem aber gewöhnlichem Material hergestellt, und darum haben sie auch wirklich die Völkerstürme der Jahrtausende überstanden und sind uns erhalten geblieben, mit ihrer wertvollen inschriftlichen Kunde und Bestätigung, als die zuverlässigsten geschichtlichen Denkmale der Inder. Da mögen wir kostbaren Tand und Flitter gern entbehren und nach der unscheinbaren Schale greifen, die der Forschung höheren Lohn verheißt und gewährt; da hat der Liebhaber, wie Bassanio nach den maurischen und spanischen Fürsten, den Schatz herausgefunden, mit dem bescheidenen Kästchen so die rechte Wahl getroffen:
but thou, thou meagre lead,
Which rather threat'nest, than doth promise aught,
Thy plainness moves me more than eloquence,
And here choose I: joy be the consequence!
990 Eine verwandte Ausführung hierzu in der 9. Rede S. 138-143.
991 Vergl. Mittlere Sammlung 320-322.
992 Vorgeführt in der Mittleren Sammlung, 51. Rede, 367f. Den Unterschied zwischen dem, der sich quält, und dem, der sich wohlfühlt, zeigen auch die klassischen Begriffe der Enkrateia und der Sophrosyne: jene ist eine schmerzliche Enthaltsamkeit, diese eine ruhige Besonnenheit. Der Enthaltsame empfindet noch heftig die Leidenschaften, während sie der Besonnene glücklich beschwichtigt hat, ηρεμαιας εχει τας επιϑυμιας, nach SUIDAS s.v. εγκρατεια σωφροσυνης διαφερει, ed. Cambridge 1705, I fol. 672.
993 Mit S etc. samaṇesu samaṇasukhumālo. – Der erste Asket gleicht dem ältesten Sohn eines gesalbten Kriegerfürsten: als Kämpfer schreitet er rüstig, sicher zum Ziel. Der zweite Asket hat die Wahnversiegung erreicht und die acht Freiungen leibhaftig erfahren. Der dritte Asket ist lediglich in der Wahnversiegung bestanden. Der vierte Asket ist bei den Asketen unter allen Umständen und Verhältnissen immer derselbe und gleiche, selig wahnerloschen in sich gekehrt: Anguttaranikāyo vol. II p. 86-88; der dritte Asket, als weiße Lotusrose, erscheint aber dort an zweiter Stelle, und der zweite, als rote Lotusrose, an dritter. Über diesen letzteren Jünger, reich wie eine rote Lotusrose, padumo, die an Fülle rosenfarbener Blätter besonders prächtig entwickelte Art, finden sich am Ende des Blumenkapitels im Wahrheitpfad die Strophen:
Gleichwie auf einem Haufen Mist,
Geschichtet an dem Straßenrand,
Ein Lotushaupt erstehen mag,
Wohlriechend, herrlich anzuschaun:
So strahlt aus wirrer Welt hervor,
Weit über alles Blindenvolk,
In weisheitklarer Heiligkeit
Ein Jünger des erwachten Herrn.
Den Lotus schlechthin veranschaulicht Gotamo im Saṃyuttakanikāyo vol. III p. 140: »Gleichwie etwa, ihr Mönche, eine blaue Lotusrose oder eine rote Lotusrose oder eine [946] weiße Lotusrose im Wasser entstanden ist, im Wasser sich entwickelt hat und über das Wasser emporsteigend dasteht, unbenetzt von Wasser: ebenso nun auch, ihr Mönche, hat der Vollendete sich in der Welt entwickelt und ragt über die Welt gekommen empor, unbenetzt von der Welt.« Ähnlich der Gruß, den der Pilger Sabhiyo dem Erhabenen entbietet, Bruchstücke der Reden v. 547:
Gleichwie der Lotus, licht erblüht,
Von Wasser nicht benetzt mehr ist,
So bist von böse, bist von gut,
Von beiden bist du nicht benetzt.
Im Gedenken an solche gelegentliche Äußerungen war die Lotusrose recht bald in weiteren Kreisen zum Symbol des Meisters geworden: jedenfalls schon seit den Lotusstempeln auf den Ziegeln aus der Zeit Asokos, von denen umschlossen das Kristallgefäß mit den Aschenresten Gotamos am Grunde der Kuppelmale eingemauert wurde; siehe Die letzten Tage1 p. XX T. IV und die nähere Erläuterung hierzu in der Anm. 492. Das von Gotamo selbst gewählte Symbol oder Wappen ist aber der Feigenbaum, der erwachsene, starke, volljährige, der, wo immer auch angeschnitten, keine Milch mehr träufelt: Saṃyuttakanikāyo vol. IV p. 160f., im Auszug mitgeteilt zu den Bruchstücken der Reden Anm. 5; ein Bild zu dem Worte, das HERAKLIT um dieselbe Zeit gesagt hat: »Die trockene Seele ist die weiseste und edelste«, der Mensch nämlich, aus dem kein Gefühl mehr quillt und trieft, den kein Gefühl mehr befeuchtigt, der nicht mehr wie Weiber und Kinder, bei Wohl oder Weh gleich tränt und träufelt, der Mensch ohne Pathos, ohne Orgasmus nach oben wie nach unten, ανϑρωπος ανευ οργης auch als das letzte Ideal des PLATON. Späterhin hat mehr und mehr das Symbol der Lotusrose das des Feigenbaums, der in der ältesten Periode der buddhistischen Skulptur immer gegeben wird, so in Barāhat wie in Sāñci und auch weiter noch lange, überwuchert und ersetzt und ist dann im nördlichen Asien zu ausschließlicher Geltung gelangt. In Nepāl, Tibet, China, Japan ist nur der Lotus, von den feinsten Allegorien bis zu den plumpen Oṃ maṇi padme huṃ-Rollen herab, heraldisch und volkstümlich bewahrt worden; ähnlich wie, andere Zeichen verdrängend, das Nandipadam, die Fußspur des Stiers als Wappen ivas, auch seit altersher bis heute in Indien es geblieben ist. Vergl. hierzu Anm. 540 die entsprechende Tafel Sitikeḍus; welcher Name, beiläufig erwähnt, auf den donatorischen Inschriften am Kuppelmal in Sāñci durch den Ort Sidakaḍā oder Sidakāḍā bestätigt ist, Epigraphia Indica II 397f. No. 31 bis 35: gleichwie durch das Dorf Payāsi im Umkreis von Sāvatthī, nach der Inschrift auf einer Kupfertafel vom Jetavanavihāro, Epigraphia Indica XI 24 Zeile 12, unser Pāyāsi der 23. Rede. – Ein Gegenstück zur Symbolik der rein und hoch emporragenden Lotusrose ist in unseren Ländern die Lilie geworden: über die allerdings meist nur süßlich gefaselt wird, während doch Sankt BERNHARD ganz indisch über sie gesprochen, ja eine lange Abhandlung darüber geschrieben hat. Ihr vorzügliches Merkmal des geraden, überragenden Wuchses legt er so aus: »Es ist nun der Stamm der Lilie zu betrachten, an dem wir dreierlei beobachten: die Geradheit, die Stärke, die Länge (rectitudo, fortitudo, longitudo). Da ist denn der Stamm der Lilie, aus der Wurzel entsprossen, der rechte Entschluß, der aus der rechten Besinnung hervorgeht. Denn so du Rechtes besonnen hast, und das in dir erstarkt ist wie die Wurzel in der Erde, so folgt notwendig, daß du das, was der Besinnung gemäß ist, zu des rechten Handelns Verwirklichung bringst: und da hast du denn alsbald den Stamm der Lilie, [947] nämlich des Rechten, das ist der rechte Entschluß, der aus der rechten Wurzel und Besinnung emporsteigt«: Opera ed. 1621 fol. 1194, cap. XX.
994 Die praktische Festigung dieser Regelsätze wird im Saṃyuttakanikāyo vol. IV p. 320ff. so gezeigt: »Lebendiges umzubringen hat der Erhabene auf mancherlei Art abgeraten und verwiesen, hat gesagt: ›Vom Töten des Lebendigen haltet euch fern.‹ Aber ich habe doch Lebendiges umgebracht, insofern oder insofern. Das war nicht recht, das war nicht gut. Wenn ich nun auch darüber mir Vorwürfe machte, ich könnte diese schlechte Tat nicht ungeschehen machen.« So erwägend und überlegend gibt man eben das Töten des Lebendigen auf und steht künftighin davon ab. Also kann man über jene schlechte Tat hinwegkommen. – Auf gleiche Weise werden dann die anderen Regelsätze behandelt, und es wird immer gezeigt, daß Reue und Vorwürfe nichts helfen würden, unfruchtbar blieben, eine schlechte Tat nicht ungeschehn machen könnten: vielmehr nur die richtige Erwägung und Überlegung, künftighin davon abzustehn. So kann man über die schlechten Handlungen hinwegkommen; bis man endlich, nach und nach, zu einem Ergebnis gelangt, wo bei immer besser geübter und gepflegter Säuberung und Herzensablösung alle Schlacken und Fesseln abfallen und nichts Kleinliches, nichts Beschränktes mehr übrig bleibt. Überall in allem sich wiedererkennend durchstrahlt dann der Jünger die ganze Welt mit unbewegtem Gemüte, mit weitem, tiefem, unbeschränktem, von Grimm und Groll geklärtem, ohne Zwang, ohne Anstrengung, seiner Sache gewiß geworden, gleichwie etwa ein kräftiger Trompeter gar mühelos nach den vier Seiten posaunen kann. Das ist die Bestätigung, der bewährte Erfolg jener, oben kurz angegebenen, fünf Regelsätze. Und nicht zum wenigsten aus solchen Gründen heißt es von der Lehre Gotamos: »Wohl kundgetan ist vom Erhabenen die Satzung, die ersichtliche, zeitlose, anregende, einladende, den Verständigen von selbst verständlich.«
995 Die Ausführung hierzu in der 15. Rede der Mittleren Sammlung, S. 107-116.
996 Vergl. unsere 14. Rede S. 214-216. Es sind die höchsten, letzten Götterbereiche oder Himmelskreise, wo das Dasein bis zu einem verschwindend kleinen Rest gebracht, fast schon verflüchtigt ist, ohne Gestalt, ohne Gebilde, jenseit des »misshapen chaos of well-seeming forms«, wie Romeo gar scharfsinnig das Reich der Lust nennt: also verhältnismäßig am wenigsten leidvolle Sphären. Darum heißt es a.a.O.: »Es gibt keine Stätte der Wesen, wo das Leben erträglich erschiene, die mir auf dieser langen Fahrt irgendwo je vorgekommen wäre, es sei denn bei den Reinen Göttern«; wozu noch in der Mittleren Sammlung S. 92 die Ergänzung folgt: »Und sollt' ich auch nur unter Reinen Göttern leben: ich mag in diese Welt nicht wiederkehren.« Denn dem Asketen erscheint jedes noch mögliche Dasein als übelartig, »gleichwie auch nur ein Restchen Kot oder Eiter immer noch übelriecht«, Anguttaranikāyo I No. 18: also wo immer sich Dasein regt, ist es eben auch schon faul; kein verblümelnder Ausdruck wie etwa im Wanderergesange »Dort, wo du nicht bist, dort ist das Glück«, oder wie das Akrostichon, nach welchem die WELT aus Weh, Elend, Leiden und Tod besteht; was zwar nicht etymologisch aus der Grundbedeutung wer alt »Menschenalter« zu rechtfertigen, aber überall semasiologisch richtig ist, supra grammaticos steht als ein Atipāṇinīyam und Mahāvākyam, letztes Scholion zum Mahābhāṣyam. Darum sagt der buddhistisch erfahrene Dichter, von dem gar manche Sentenz im Subhāṣitārṇavas aufbewahrt ist, eingedenk der aus dem Kreislauf auch über die höchsten Seligen Welten doch sicher nur wechselnd verlockend wiedererzeugten Lebensnotwendigkeit, deren Not eben gerade so nie gewendet sondern stets nur erneut wird:
[948] Svargaṃ dhig astu: punāragamanaṃ karoti,
Dem Himmel fluch' ich: Immerwiederkehr bewirkt er.
Hier ist die Erkenntnis zu Ende gedacht, die bei uns den Dichter erst wundersam ergreift, wenn er wie ein Inder der Vorzeit zu singen anhebt:
Des Menschen Seele
Gleicht dem Wasser:
Vom Himmel kommt es,
Zum Himmel steigt es,
Und wieder nieder
Zur Erde muß es,
Ewig wechselnd.
Vielleicht ist da sogar ein historischer Zusammenhang denkbar, durch Vermittlung des Pythagoreers OKELLOS, der das zweite Kapitel seines Buches: »Über die Natur des Alls« genau so ausleitet: Το δε εξ αυ φοτερων αυτων, του μεν αει ϑεοντος ϑειου, του δε αει μεταβαλλοντος γενητου, κοσμος αρα εστιν, Was aber aus den beiden besteht, aus dem immer göttlich Kreisenden, aus dem immer wechselnd Gewordenen, ist eben die Welt. – In einen schönen Merkspruch gefaßt ist jener Gedankengang im Dhammapadam v. 168f., wo auf die Sage von der unermeßlichen und doch unbefriedigenden Macht des Erd- und Himmelbeherrschers Mandhātā angespielt wird (vergl. Anm. 1058 am Ende); zu welcher Stelle ich in meiner Übersetzung, Wahrheitpfad Anm. 187, auf den überraschend ähnlichen Ausdruck einer solchen Gesinnung bei CARDANUS hingewiesen habe, der vor dem freiwilligen Abschluß seines reichen Lebens einem Freunde versichert hat: »So unglücklich ist der Zustand dieses unseres Lebens, daß nichtsein besser wäre als dasein. Heilig schwöre ich dir, OCTAVIANUS VON CUSA, ich würd' es nicht annehmen, wenn etwa irgendein Gott mir die Macht verliehe nach dem Tode wiederum in den Schoß eines Weibes einzugehn und neugeboren zu werden zum herrlichsten Leben – zum herrlichsten, sag' ich.« CARDANUS hat da zunächst SENECAS Wort an MARCIA (cap. 22) paraphrasiert: Keiner würde das Leben annehmen, wäre es nicht unwissentlich gegeben, nisi daretur inscientibus; tiefer aber liegt ihm dabei wohl der Abschied des SOKRATES im Gehör, er zieht mit ihm die Summe der Apologie, die SCHOPENHAUER in seinem Hauptwerk (Kap. 46 gegen Ende) vorzüglich an jener Stelle erkannt hat, »wo PLATO diesen weisesten der Sterblichen sagen läßt, daß der Tod, selbst wenn er uns auf immer das Bewußtseyn raubte, ein wundervoller Gewinn seyn würde, da ein tiefer, traumloser Schlaf jedem Tage, auch des beglücktesten Lebens, vorzuziehen sey.« Noch bedeutender scheint mir aber dies dargelegt durch die Abschätzung, die KANT vorträgt, in der Schlußanmerkung zu § 83 der Kritik der Urteilskraft: »Was das Leben für uns für einen Werth habe, wenn dieser bloß nach dem geschätzt wird, was man genießt (dem natürlichen Zwecke der Summe aller Neigungen, der Glückseligkeit), ist leicht zu entscheiden. Er sinkt unter Null; denn wer wollte wol das Leben unter denselben Bedingungen, oder auch nach einem neuen, selbst entworfenen (doch dem Naturlaufe gemäßen) Plane, der aber auch bloß auf Genuß gestellt wäre, aufs Neue antreten?« Die ablehnende Antwort wird hier freilich durchaus nicht allgemein ausfallen, sondern nur von solchen erfolgen, die bei der Umwertung der Lebensansicht Erwägungen anstellen wie etwa LUTHERS Gegner und Freund des ERASMUS, der Rektor an der Sorbonne [949] und endlich vatikanische Linguist bei LEO x, der Kardinal ALEANDER, der sich auf seiner selbstverfaßten Grabschrift so zu erkennen gibt:
Κατϑανον ουκ αεκων, ότι παυσομαι ων επιμαρτυς
Πολλων, ὡνπερ ιδειν αλγιον ην ϑανατου.
Nicht starb ich ungern hinweg, da ich Zeuge nie wiederum sein muß
Vielem, das nur zu sehn schmerzlicher war als der Tod.
Kurz GOETHE: »Wir leiden alle am Leben«, Sprüche in Prosa V 60; kürzer noch der Spruch der Weisen, den Kālidāsas anführt, Raghuvaṃ am VIII 87: vikṛtir jīvitam, »Mißwende ist Leben«, wofür der Holländer urkräftig »wanschepsel« sagt, Wahngebild = Scheusal, Unbild. Es ist ein Monogramm für PLATONS τουτο το παϑος, το ϑαυμαζειν, Theaitetos p. 155, den Krampf des Erstaunens, das Herzklopfen der Verwunderung über die Welt; gleichwie wiederum einmal KANT bei der teleologischen Naturerklärung obenhin scherzhaft, eigentlich aber mit furchtbarem Ernste von der »niederschlagenden Bewunderung« spricht, die der Anatom bei der Betrachtung der zwecklosen Zweckmäßigkeit einer Mißgeburt fühlt, Kritik der Urteilskraft § 81. Die Abkehr von einem Leben, dessen schief geratene Art und Entfaltung durch die Erfahrung offenbar wird, kommt bei uns recht zugehörig zum Ausdruck in einer längeren Parabel der 23. Rede, S. 402f, wo Abgeschiedene als selige Geister in himmlischen Jahrmillionenbereichen kreisen und sich an das einstige klägliche Dasein nur so zu erinnern vermöchten wie etwa einer, der in eine Senkgrube gefallen war, dann herausgezogen, abgespült, gebadet, gesalbt, geschmückt und in weiße Gewänder gehüllt wurde, in jenen abscheulichen Jauchepfuhl oder Dreckhaufen der Häuslichkeit wiederum unterzutauchen gewiß nicht mehr wünschen kann; ganz entsprechend wie die Geister in der Anatomie des FRIEDRICH RUYSCH, in LEOPARDIS Dialog, zu Beginn eines neuen Platonischen Jahres im Chore singen und schweben und auf ihren weiten gereinigten Sphären der einstigen Mottenwelt nur wie einer schrecklichen Larve, eines wirren Traumes und Alpdrucks noch gedenken, vor dem winzigen wunden Punkte, der Leben genannt war, mit der fast schon unbewußtbaren Frage zurückbeben:
Che fu quel punto acerbo
Che di vita ebbe nome?
Wie nun hier das Schaudern vor dem siedenden Gewimmel im »Fingerhut voll Leben«, nach SCHILLERS Wort zu KÖRNER, trefflich parabolisiert wird, so ist die auch alle noch so hohen Himmel verachtende Anschauung und Gedankenrichtung eines der wichtigsten Merkmale der gotamidischen Satzung, ihr Postulat der Vernunft. Der Meister gibt es den Jüngern gegenüber oft und oft zu erkennen, vielleicht am besten in der kurzen Ansprache Anguttaranikāyo III No. 18, ed. Siam. p. 144f.: »Sollten euch, ihr Mönche, die Pilger anderer Orden etwa fragen: ›Wird, Brüder, beim Asketen Gotamo heiliges Leben geführt um in himmlische Reiche emporzugelangen?‹, würde euch Mönche über eine solche Frage da nicht Entsetzen, Grauen und Abscheu ankommen?« – »Gewiß, o Herr.« – »So faßt euch Mönche denn freilich vor himmlischem Leben Entsetzen an, Grauen an, Abscheu an, es faßt euch vor himmlischer Schönheit, himmlischer Wonne, himmlischer Macht, himmlischer Herrlichkeit Entsetzen an, Grauen an, Abscheu an: geschweige wie euch Mönche gar erst vor üblem Wandel in Werken, Worten und Gedanken Entsetzen, Grauen und Abscheu ankommen wird.« Aussprüche wie dieser mußten, wenn sie vedischen Priestern zu Ohren [950] kamen, natürlich Anstoß und Widerspruch erregen, daher denn gesagt wurde »Ein Verneiner ist der Asket Gotamo«, »Ein Kernbeißer ist der Asket Gotamo«, Mittlere Sammlung 164, 538, Anguttaranikāyo vol. IV p. 175, 183, V 190: Urteile der orthodoxen Priesterkaste, die sich genau so auch im nördlichen Kanon erhalten haben, durch das Sanskrit und Tibetische noch wörtlich in das Mongolische übergegangen, z.B. im Uligerün Dalai verächtlich nachgesprochen, in einer Unterredung berühmter Meister und Altmeister: »Der Vertilger der guten Werke Gotamo«, nach 1. J. SCHMIDTS Forschungen im Gebiete der Völker Mittelasiens etc., St. Petersburg 1824, S. 269. Vergl. auch Anm. 617 die Verdächtigung von seiten der Vedāntisten und Mīmāṃsisten ( aṃkaras, Kumārilas), Gotamo sei ein unsinniger Verführer und verruchter Verderber der Menschheit. Auch da wie überall war eben Schimpfen leichter gewesen als Verständnis gewinnen. Die lieben Herren Priester, Religionsprofessoren und Philosophieprofitenten in Benāres, wo Gotamo bekanntlich zuerst seine Lehre dargelegt hat, mußten ja Haltung bewahren, Stellung nehmen, sie waren ex officio dazu veranlaßt. Und da ist es denn auch dort nicht anders gewesen wie bei dem Streite des einst berühmten Theologen VOET gegen die »phantastische Philosophie«, des »Atheisten« DESCARTES: wobei, nach dem damaligen Bericht, urbi et orbi Zeter und Mordio geschrien wurde über »groote ende swaere oneenigheden, ergernisse ende scheuringe, dat eenige gequalificeerde personen seer schandelijck ende tegen de waerheydt werden geblameert.« Das ist die Sache: sie wollen eben nicht blamiert werden, die verschiedenen Parteien und Fraktionen; und LEOPARDI entschuldigt sie gut und gern, »le varie fazioni, o comunque si convenga chiamarle, in cui sono divisi oggi, come sempre furono, quelli che fanno professione di filosofare: ciascuna delle quali nega ordinariamente la debita lode e stima a quei delle altre; non solo per volontà, ma per avere l'intelletto occupato da altri principii.« Kurz: die Herren waren eifrig beflissen auch ihrerseits zu bestätigen was unser WICKRAM in seinem »Irr reitenden Pilger« nicht übel so angibt:
Ihr wißt, ein uralt Sprichwort ist:
So näher Rom, so böser Christ.
Vom Sonnenhelden, vom Meister, der der Sonne gleicht, wie Gotamo von den Jüngern genannt wird, konnten jene immer nur gerade so viel begreifen wie es Mādhavācāryas in seiner Widerlegung der buddhistischen Lehren und Ansichten gleichnisweise recht ehrlich bemerkt. Obzwar nämlich, sagt er, der Meister nur einer gewesen ist, hat er doch mancherlei Nachfolger und Ausleger gehabt: es ist so als wenn gesagt wird ›Die Sonne ist untergegangen‹, und alsbald nun ein Buhle, ein Dieb, ein Vedenschüler usw. je nach seiner Art es verstehn und sich zum Abenteuer, zum Diebstahl, zur Andacht usw. anschicken wird, Sarvadar anasaṃgrahas II am Anfang. Selbst ein so überaus bekannter Begriff wie nibbānam, nirvāṇam, von vānam Wunsch mit der Negation, also Wunschlosigkeit, Erlöschung (s. Mittlere Sammlung Anm. 343), mußte sich im tamulischen Indien auf den Kopf stellen lassen: denn dort ist vānam, als Wunschesfülle, das gewöhnliche Wort für Himmel geworden, während nirvāṇam, als negierend, Elend bedeutet. Der Wechsel der sprachlichen Begriffe hatte hier einen Umsturz des Wortinhalts bewirkt. All dem zufolge wird niemand erstaunen, wenn man es längst schon wie heute wieder bei uns verstanden hat Gotamos Denkmal sich doch besser nutzbar zu machen; man hat die alten unbrauchbaren Quadern des Lehrgebäudes zerkleinert um wohnliche Räume daraus errichten zu können, recht wie, in GRACIANS Agudeza LXII, BARTOLOMÉ LEONARDO es beschreibt:
[951] Con mármoles de nobles inscripciones,
Teatro un tiempo y aras, en Sagunto
Fabrican oy tabernas y mesones.
Und da wird eben in dieser herrlichen Welt, um auf unser eingangs gegebenes Gleichnis zurückzukommen, einem jeden zunächst sein Restchen Dasein gar nicht übelriechend bedünken, in der Joie de vivre oder Freude zu stinken, wie es NIETZSCHE nach ZOLA sehr gut nannte. Denn: stercus cuique suum bene olet, wußte und weiß man am Ganges wie am Tiber und Ebro, am Quai de la Seine wie am Ufer der Spree.
997 Vergl. Anm. 35, wo die vedischen Vorbilder aus der ruti und Smṛti zu finden sind.
998 Mit S etc., wie auch Majjhimanikāyo I 102-103, seyyasukhaṃ passasukhaṃ middhasukham.
999 Hierzu die Hauptstelle aus dem Saṃyuttakanikāyo vol. V p. 229f. (PTS XLVIII 44); übersetzt in den Bruchstücken der Reden Anm. 853. Eine Einteilung dieser fünf Sinneskräfte oder fünf Fähigkeiten, pañc' indriyāni, ist vol. V p. 206 (PTS XLVIII 8) vorher getroffen: »Fünf gibt es, ihr Mönche, der Fähigkeiten: und welche fünf? Fähige Zuversicht, fähige Kraft, fähige Einsicht, fähige Innigkeit, fähige Weisheit. Wo ist aber, ihr Mönche, fähige Zuversicht wahrzunehmen? Bei den vier Gliedern der Hörerschaft; da ist fähige Zuversicht wahrzunehmen. Wo ist aber, ihr Mönche, fähige Kraft wahrzunehmen? Bei den vier gewaltigen Kämpfen; da ist fähige Kraft wahrzunehmen. Wo ist aber, ihr Mönche, fähige Einsicht wahrzunehmen? Bei den vier Pfeilern der Einsicht; da ist fähige Einsicht wahrzunehmen. Wo ist aber, ihr Mönche, fähige Innigkeit wahrzunehmen? Bei den vier Schauungen; da ist fähige Innigkeit wahrzunehmen. Wo ist aber, ihr Mönche, fähige Weisheit wahrzunehmen? Bei den vier heiligen Wahrheiten; da ist fähige Weisheit wahrzunehmen. Das sind, ihre Mönche, die fünf Fähigkeiten.«
1000 Die Lehre von der Auflösung der Persönlichkeit wird in der Mittleren Sammlung wiederholt vorgetragen, namentlich in der 109. Rede, S. 832. Andere wichtige Nachweise nebst Erklärung und Etymologie in den Bruchstücken der Reden, Anm. 1119 u. 231. In Verbindung damit steht die Lehre vom Verlieren der Selbstentwicklung, bis zum letzten Grade in der 9. Rede durchgeführt, 138-143, als Entäußerung von aller natürlichen, eigentümlichen Beschränkung usw. Kurz und bündig ist beides im Saṃyuttakanikāyo behandelt. »Wie muß wohl, o Herr«, fragt ein Mönch, »die Kenntnis, wie das Verständnis sein, damit man die Ansicht von der Persönlichkeit, die Ansicht vom Selbst aufgeben kann?« – »Das Auge, Mönch«, erwidert der Meister, »muß man als leidig erkennen, verstehn, als wesenlos erkennen, verstehn, damit man die Ansicht von der Persönlichkeit, die Ansicht vom Selbst aufgeben kann; die Formen, das Sehbewußtsein, die Sehberührung und was da irgend durch Sehberührung, Hörberührung, Riechberührung, Schmeckberührung, Tastberührung, Denkberührung bedingt hervorgehn mag und als wohl oder weh oder weder weh noch wohl empfunden wird, auch das muß man als leidig erkennen, verstehn, als wesenlos erkennen, verstehn, damit man die Ansicht von der Persönlichkeit, die Ansicht vom Selbst aufgeben kann. So muß da, Mönch, die Kenntnis, so das Verständnis sein, damit man die Ansicht von der Persönlichkeit, die Ansicht vom Selbst aufgeben kann.« Bd. IV S. 184f. (PTS 147f.) Das aber heißt, wie Sāriputto oben sagt, der Persönlichkeit entronnen sein. Persönlichkeit, sakkāyo, und Erlöschung, nibbānam, sind im Anguttaranikāyo VI No. 85, einander gegenüber dargestellt, je nachdem man »dem Gemeinen [952] zugetan ist und froh der Persönlichkeit«, oder »dem Erlesenen zugetan ist und froh der Erlöschung.« Die Auflösung der Persönlichkeit kann im Dasein nur dem gelingen, der die höchsten Fähigkeiten in sich vollkommen entwickelt und ausgebildet und daher jede umschränkende Hemmung und Verwicklung, die ihn zu einer bestimmten Person machte, von sich abgestreift hat: so eben hat er die unpersönliche Freiheit verwirklicht, die ganze Natur überwunden. Das ist die Allmacht des Menschen, das ist summum jus ohne summa injuria. Zugleich hat er – sublime ridiculum – den höchsten Begriff der juristischen Person leibhaftig veranschaulicht: er allein ist ja wirklich zur universitas personarum geworden. So gehört er denn gewiß nicht zu denen, die sich damit begnügen müssen die kümmerlichen Flammen aus ihrem Aschenhäufchen herauszublasen: er ist vielmehr, nach der überaus herrlichen Ergänzung, die ROUSSEAU gibt, »ce génie qui réveille à volonté tous les sentiments; et il n'y a d'autre art en cette partie, que d'allumer en son propre cœur le feu qu'on veut porter dans celui des autres«, Dictionnaire de musique s.v. accent 1) gegen Ende. Als vollendete Person, als Meister aller Akzente, sehn wir aber zumal Gotamo vor uns, wie er jedem einzelnen, ob der nun Krieger oder Priester, Bürger oder Asket oder wer immer sei, als die gerade ihm entsprechende Persönlichkeit erscheint: denn er vereinigt alle zusammen in sich. Vergl. Bruchstücke der Reden Anm. 463, insbesondere oben S. 258, Mittlere Sammlung 82f. die Darstellung der acht Versammlungen, sowie S. 278 das Wort des Meisters: »Ich weiß wohl, Aggivessano: wenn ich da einer Schar von vielen hunderten die Lehre verkündet habe, so meint einer um den anderen von mir: ›Nur für mich hat der Asket Gotamo die Lehre verkündet!‹ Doch ist das nicht also zu verstehn, Aggivessano, weil ja der Vollendete den anderen die Lehre zur Aufklärung verkündet. Aber wenn eine solche Darlegung zu Ende ist, Aggivessano, dann richte ich auch das einzelne Gemüt eines jeden Friedesuchenden auf, bring' es zur Ruhe, einige es, füge es zusammen. Und so halte ich es allezeit, allezeit.« Das Geheimnis dieser Wirkung auf die Menschen ist offenbar genug. Es ist die zu höchst entwickelte Fähigkeit den Charakter eines jeden sich durchsichtig zu vergegenwärtigen, analog der unfehlbaren Personifikationskraft des unpersönlichen SHAKESPEARE: der vollkommene Künstler und der vollkommene Heilige steht über der Welt auf der gleichen Stufe anschauender Erkenntnis. Oder nach jener universitas personarum, wie sie auch in den Pandekten Meister ECKHARTS erklärt wird: »Was ist die Vermögenheit des Wesens? Die Vermögenheit des Wesens ist, daß es sonder Persönlichkeit ist«, S. 15 der Textsammlung von JOSTES, Collectanea Friburgensia, fascic. IV 1895. Am ausführlichsten hat PLOTIN dieses paradoxe Verhältnis dargelegt, am Ende des 5. Buchs der 6. Enneas, wo er den Satz begründet: Alles hat wer alles aufgibt. Unübertrefflich wie er sagt: αυξεις τοινυν σεαυτον αφεις τα αλλα, και παρεστι σοι το παν αφεντι, was MARSILIUS FICINUS so wiedergibt: tunc itaque te ipsum auges quando dimittis alia, tunc et universum tibi adest caetera dimittenti, ed. Basilea 1580 fol. 671 A. Es ist die Erkenntnis daß die Selbstherrlichkeit in Selbstverneinung besteht: ή γαρ αυταρκεια εν αυταρνειας εστι, schrieb POSTEL an MASIUS am Ende seines Briefes vom 4. März 1568. Kein anderer Grund war es, der PASCAL zuletzt und nach ihm die Jansenisten so pedantisch bewog, den Gebrauch von je und moi stets durch das unpersönliche on zu ersetzen: par ce que la piété chrétienne anéantit le moi humain. PASCAL, eine mächtige Person sonder Persönlichkeit, war damit auf seinem Wege zur Bestätigung der gotamidischen Lehre gekommen: was auch irgend in der Welt besteht ist anattā, das heißt nicht-ich, nichtig, unselbst, uneigen, wesenlos; wie es oben dargestellt ist. Ein zugehöriges Wort PASCALS über das Zustandekommen der Persönlichkeit war schon zur 16. Rede anzuführen, [953] Anm. 409. Auf einer sehr heiteren Seite hatte übrigens einst DIOGENES diese persönlich-unpersönliche Erfahrung ohne jeglichen Hinterweltgedanken in den Kettenschluß gebracht: Alles gehört den Göttern; Freunde sind aber den Weisen die Götter; gemeinsam ist was Freunde haben: alles gehört also den Weisen. DIOG. LAERT VI 72. Setzt man für den Plural den Singular, so hat man da das reine Nazarenertum vorangezeigt. In neuer Zeit hat von diesem Einzigen und seinem Eigentum STIRNER einen wüsten Traum geträumt. Doch die alte, unvertrübte Ansicht vom Wirken ohne Persönlichkeit, das nur je und je an einer vollendeten Person zur Erscheinung kommen kann, ist vielleicht am besten in einem Bericht über LAO-tse versinnlicht. Als KUNG-FU-tse einst den Meister aufgesucht und mit ihm gesprochen hatte, kehrte er zu seinen Jüngern zurück und sagte: »Ich weiß, daß die Vögel fliegen, daß die Fische schwimmen, daß die Vierfüßer laufen. Die, welche laufen, kann man mit dem Seil fangen; die, welche schwimmen, mit dem Angel; die, welche fliegen, mit dem Pfeil. Aber der Drache, der sich zum Himmel erhebt, von Winden und Wolken getragen, wie der zu fassen sei weiß ich nicht. Ich habe heute Meister LAO gesehn: er ist wie der Drache.« JULIEN, LAO-tse, Paris 1842, p., XX. Und scherzhaft im Ernste hat GOETHE hier mitten ins Ziel getroffen, Zahme Xenien VI 39:
Der Professor ist eine Person,
Gott ist keine.
Diesem scherzhaften Ausdruck liegt aber nicht mehr und nicht weniger als das augustinische Dogma zugrunde: Deus indiscretus est, personae discretae sunt, aus der Epistola 119, 4 zitiert im Thesaurus Linguae Latinae vol. V s.v. discerno 1306, 64. Vergl. noch oben Anm. 978.
Unsere sprachgeschichtliche Entwicklung des Begriffs der Persönlichkeit oder der sakkāyadiṭṭhi geht auf persona zurück, nämlich die Maske des Schauspielers, die Rolle, die er mimt, während er selbst, attā, dabei gar nicht in Betracht kommt: er stellt einen Körper vor, sakkāyarūpam, κατα προσωπον, ist also eine imago, und daher eigentlich imaginatio. Er ist der māyākāro oder Illusionist, der dem Menschen im Bewußtsein den Zauber der Persönlichkeit vorgaukelt, bis man dahinterkommt, daß es eine Delusion, ein Trick, eitel Trug ist: Saṃyuttakanikāyo vol. III p. 142, übersetzt in meiner Buddhistischen Anthologie S. 192; oder wie nach der Sāṃkhyakārikā die Natur als Tänzerin Prakṛti sich in allen möglichen Evolutionen und Personifikationen vor dem Weltgeist Puruṣas produziert und verneigt und dann abgeht, v. 59, und die Komödie der weltlichen und göttlichen Personen ist aus. Vom Schauspiel und Scheinbild her ist also da wie dort die hochangesehne Fiktion der Person und Persönlichkeit entstanden. Im modernen französischen Sprachgebrauch ist das Verhältnis insofern zu einer Farce geworden als »personne« sowohl jemand als niemand bedeutet, die Negation fiel ab.
1001 S gibt von deseti an sankhittam. – Vergl. Mittlere Sammlung S. 927.
1002 Der zur Einigung taugliche Eindruck, der hier angedeutet wird, kann [954] gründlich nach unserer 22. Rede, 385f., verstanden werden. Vergl. auch den kräftigen Stempel in den Liedern der Mönche, v. 599:
Ein weißer Wurm, geringelt kraus,
Der dort im Beinhaus hin und wider kroch,
Hat eilig Einsicht mir verliehn,
Des Leibes Ekel innig offenbart.
Es sind das Eindrücke, wirksam wie jene Inschrift »at Godstowe, neare to Oxford towne« (cf. PERCYS Reliques I 5 No. 7), wo der Wanderer auf dem Leichenstein unter der Rosenhecke liest:
Hic jacet in tumba Rosa mundi, non rosa munda,
Non redolet, sed olet, quae redolere solet.
Das Grabmal als Denkmal, wie PETRARCA es anschaut als eine uneinnehmbare Festung, wo das Reich dem Gewürm zukommt, nicht dem Geschick: Inexpugnabilis arx selpulcrum: illic regnum verminibus, non fortunae. De remediis utriusque fortunae, lib. I dial. XIV. Der witzige BENSERADE aber hatte, als sein allmächtiger Gönner gestorben war, über dem Memento der Fäulnis des Todes sich und die Eitelkeit der Welt zum besten gehabt mit dem epicheirematischen Epitaph:
Cy-gist, oui gist, par la mort-bleu,
Le Cardinal de Richelieu;
Et ce qui cause mon ennuy,
Ma pension avecque luy.
1003 In diese sechsfache Sechsheit ist alle Daseinsart und Daseinsmöglichkeit einbegriffen. Sāriputto gibt hier nur die Schlagworte zur berühmten Rede des Meisters, die diese Dinge Stück um Stück insgesamt zur Besichtigung vorweist: es ist die 148. der Mittleren Sammlung, 1065-1071, und sie hat als bezeichnenden Titel eben den Namen »Sechsfache Sechsheit« erhalten. Im Saṃyuttakanikāyo wird diese Art der Betrachtung und Untersuchung in einem ganzen Buche durchgeführt, im Saḷāyatanavaggo oder dem Abschnitt vom Sechsfachen Reich. Als Beispiel der dort gepflegten Methode und reinen Kritik der Vernunft seien zunächst zwei kurze Stücke, die bloße Stempel abgeben, vorgelegt. Gotamo spricht: »Alles will ich euch zeigen, ihr Mönche, das mögt ihr verstehn. Was ist also, ihr Mönche, alles? Das Auge ist es und die Formen, das Ohr und die Töne, die Nase und die Düfte, die Zunge und die Säfte, der Leib und die Tastungen, das Denken und die Dinge: das heißt man, ihr Mönche, alles. Wer, ihr Mönche, etwa behaupten wollte: ›Ich werde solch ein alles zurückweisen und ein alles von anderer Art aufstellen‹, und er würde eben über den Gegenstand seiner Behauptung befragt werden, so könnte er keinen Bescheid geben, müßte vielmehr in Verlegenheit geraten: und dies warum? Weil so etwas, ihr Mönche, nicht zu finden ist. – Zweiheit will ich euch zeigen, ihr Mönche, das mögt ihr verstehn. Was ist also, ihr Mönche, Zweiheit? Das Auge ist es und die Formen, das Ohr und die Töne, die Nase und die Düfte, die Zunge und die Säfte, der Leib und die Tastungen, das Denken und die Dinge: das heißt man, ihr Mönche, Zweiheit. Wer, ihr Mönche, etwa behaupten wollte: ›Ich werde solch eine Zweiheit zurückweisen und eine Zweiheit von anderer Art aufstellen‹, und er würde eben über den Gegenstand seiner Behauptung befragt werden, so könnte er keinen Bescheid geben, müßte vielmehr in Verlegenheit geraten: und dies warum? Weil so etwas, ihr Mönche, nicht zu finden ist.« (Bd. IV S. 18f. u. [955] 83 der siam. Ausgabe. In der Pāli Text Society IV 15 u. 67 nur mit Vorsicht zu gebrauchen, bei den zahlreichen Versehn und Fehlern wie kinci statt kiñ ca, ca statt ceva etc.) Wie nun dies alles und diese Zweiheit bestehn oder auch nicht bestehn kann, wird dann ferner gezeigt. Und es wird dargelegt, wie es einzig der Wille ist, chando, durch den das Ganze der Verbindung zustande kommt, und daher die Lebenserscheinung mit ihrem ganzen sauberen Weltspuk durchaus nur bedingten Bestand hat. »Wenn das Auge und die Formen, das Ohr und die Töne, die Nase und die Düfte, die Zunge und die Säfte, der Leib und die Tastungen, das Denken und die Dinge den Menschen bänden, dann gäbe es hier kein heiliges Leben zur vollkommenen Leidensversiegung; da nun aber nicht das Auge und die Formen, das Ohr und die Töne, die Nase und die Düfte, die Zunge und die Säfte, der Leib und die Tastungen, das Denken und die Dinge den Menschen binden, es vielmehr der Willensreiz ist, chandarāgo, der aus je beiden hervorgeht: darum gibt es hier ein heiliges Leben zur vollkommenen Leidensversiegung; Auge und Formen, Ohr und Töne, Nase und Düfte, Zunge und Säfte, Leib und Tastungen, Denken und Dinge bestehn, Wille danach besteht nicht, entbunden davon ist das Herz. Wenn ein schwarzer und ein weißer Ochse zusammengespannt sind, hält nicht der schwarze den weißen oder der weiße den schwarzen, das Joch hält sie beide zusammen. Man hat wohl das Auge, man sieht mit dem Auge die Form, aber Willensreiz besteht nicht mehr dabei, gänzlich entbunden ist das Herz. Man hat wohl das Ohr, man hört mit dem Ohr die Töne, aber Willensreiz besteht nicht mehr dabei, gänzlich entbunden ist das Herz. Man hat wohl die Nase, die Zunge, den Leib, hat das Denken, man erkennt mit dem Denken die Dinge, aber Willensreiz besteht nicht mehr dabei, gänzlich entbunden ist das Herz. Daher ist das eben je nach dem Umstand zu beurteilen, insofern nicht das Auge durch die Formen gefesselt wird, und auch nicht die Formen durch das Auge; nicht das Ohr durch die Töne – nicht das Denken durch die Dinge gefesselt wird, und auch nicht die Dinge durch das Denken: sondern was da aus je beiden als Willensreiz hervorgeht, das ist da Fessel.« (Bd. IV S. 201ff., PTS 162ff.) So wird es dem Jünger mehr und mehr klar, daß Anfang und Ende der Welt im Menschen selbst gelegen und nicht außen zu suchen sei. Wer als befangener Mensch den Traum der Wandelwelt gültig zu berechnen sich müht, dem wird der gemeinwertige Begriff von Anfang und Ende immer unausdenkbar bleiben, anamataggo (s. Lieder der Mönche Anm. 405): während der Wahnversiegte, der das Werk gewirkt hat, allerdings sicher weiß, daß, wie er sagt, »diese Welt nicht mehr ist«, Abschluß der Rede von der Sechsfachen Sechsheit, Mittlere Sammlung 1071. Dieser Gedankengang, der über die letzten und schwierigsten Gipfel des Denkvermögens hinführt, ist dann von Gotamo noch in einen trefflich bezeichnenden Merkspruch zusammengefaßt, auf den kürzesten Ausdruck gebracht worden, im Saṃyuttakanikāyo zweimal überliefert. Er lautet das erste Mal: »Wo es kein geborenwerden und altern, kein sterben und vergehn und entstehn gibt, dies Ende der Welt, sag' ich, kann durch kein Wandern erforscht, erschaut, erreicht werden; und doch sag' ich, daß ohne das Ende der Welt zu finden dem Leiden kein Ende gemacht werden kann: aber in eben diesem klaftergroßen Leibe da, dem wahrnehmen und denken anhaftet, lass' ich die Welt verstanden sein, die Weltentwicklung, die Weltauflösung und den zur Weltauflösung führenden Pfad.« Das andere Mal heißt es: »Durch kein Wandern, sag' ich, kann das Ende der Welt erforscht, erschaut, erreicht werden: und doch sag' ich, daß ohne das Ende der Welt zu finden dem Leiden kein Ende gemacht werden kann.« Und diese zweite, möglichst knappe Fassung, die der Meister den Jüngern als Stempel gegeben hat, wird nun alsbald von Ānando vor [956] den Ordensbrüdern erklärt, wozu dann Gotamo seine Billigung bekundet. Ānando aber führt aus: »Wodurch man, ihr Brüder, in der Welt weltbewußt wird, weltbedünkend, das heißt man im Orden des Heiligen ›Welt‹. Durch was aber, ihr Brüder, kann man in der Welt weltbewußt werden, weltbedünkend? Durch das Auge, ihr Brüder, kann man in der Welt weltbewußt werden, weltbedünkend; durch das Ohr, durch die Nase, durch die Zunge, durch den Leib, ihr Brüder, kann man in der Welt weltbewußt werden, weltbedünkend; durch das Denken, ihr Brüder, kann man in der Welt weltbewußt werden, weltbedünkend. Wodurch man, ihr Brüder, in der Welt weltbewußt wird, weltbedünkend, das heißt man im Orden des Heiligen ›Welt‹.« (Bd. I S. 84f., PTS 61f.; Bd. IV S. 114ff., PTS 93ff.; auch im Anguttaranikāyo überliefert, Navakanipāto No. 38, Catukkanipāto No. 45, cf. Chakkanipāto No. 61 zum Tissametteyyapañho in den Bruchstücken der Reden, v. 1040-1042, als Abschluß.) Das dürften so die wichtigsten Stellen sein, die oben Sāriputto bei seinem kurzen Hinweis auf die sechsfache Sechsheit mit im Sinn haben und andeuten mochte. – Man kann hier nebenbei wohl merken, wie die Erkenntnislehre Gotamos die tiefen Ergebnisse unserer abendländischen Denkerfürsten längst schon vorausgewußt hatte: nur beiläufig und mehr außenhin auch ein Zeugnis jener unermüdlichen Arbeit mit den Werkzeugen einer unvergleichlichen Verstandesschärfe. Solche Arbeit ist jedoch einzig zu asketischer Erkenntnis vollbracht worden und nicht etwa um spitzfindige Untersuchungen zu pflegen und sich ihrer zu erfreuen: denn das sechsfache Gebiet ist vom Übel und daher nicht zum Ergetzen da. Wie Korn auf der Tenne von Dreschflegeln bearbeitet wird, so wird der gewöhnliche, unerfahrene Mensch von den bald angenehmen bald unangenehmen Empfindungen der sechs Sinne durchdroschen: und wenn er überdies noch an sein künftiges Wiederdasein denkt – »das metaphysische Bedürfnis des Menschen« – wird er nur um so mehr noch zum siebentenmal niedergepeitscht: Saṃyuttakanikāyo Bd. IV S. 248f.; vergl. Bruchstücke der Reden v. 1111 nebst Anm. Und es ist unendlich schwer, und wäre doch nur unglaublich leicht, die Genesung zu finden. Denn alles hängt vom Vermeinen ab. »Vermeinen läßt vom Tode gebunden sein, Nichtvermeinen läßt vom Bösen befreit sein. ›Ich bin‹ ist ein Vermeinen, ›Ich bin nicht‹ ist ein Vermeinen, ›Ich werde sein‹ ist ein Vermeinen, ›Ich werde nicht sein‹ ist ein Vermeinen, usw. Vermeinen aber ist krank sein, Vermeinen ist wund sein, Vermeinen ist weh sein. Darum habt ihr da, Mönche, ein Gemüt zu erwerben, das nichts mehr von Vermeinen weiß: also habt ihr Mönche euch wohl zu üben«: a.a.O. Bd. IV S. 250, Bruchstücke der Reden Anm. 588, Mittlere Sammlung 1031. Von einem solchen Jünger gilt der Spruch, den Sāriputto sagt, Lieder der Mönche 1003:
Ich freue mich des Sterbens nicht,
Ich freue mich des Lebens nicht:
Geduldig wart' ich ab die Zeit,
Gleichwie der Söldner seinen Lohn.
Ein alter Spanier hat dies in verkürzter Form wörtlich wiedergegeben, bei GRACIAN, Agudeza, Discurso XLIII:
Y por ultima alfin precisa suerte,
El no temer, ni desear la muerte.
Trefflich hatten die Griechen den gelassenen Übergang vom Leben zum Tode durch manche metaphorische Wendungen angezeigt, wie z.B. εξηλϑεν, εξεβη, ετελεσϑη: er ist hinausgekommen, hinausgelangt, er hat es zu Ende gebracht. Dann klingt noch [957] ein anderer Ton hier mit an, der begleitende römische, mit der tiefen Stimme der Sicherheit, ganz ohne Pathos: vita defungi, vitam degere, i.e. de-agere, vom Leben loskommen, das Leben hinbringen, d.i. abtun: von SCHOPENHAUER belobt, Parerga I Aphor. Kap. V A 1, 2. Absatz, und II § 156: »Das Leben ist ein Pensum zum Abarbeiten: in diesem Sinne ist defunctus ein schöner Ausdruck.« CAESAR hat den CRITOGNATUS ebendiese große Erfahrung so bewähren lassen: Qui se ultro morti offerant, facilius reperiuntur, quam qui dolorem patienter ferant: De bello Gallico VII 77. Der hochgefeierte tapfere Skalde König LODBROG von Dänemark, der gefangen und von seinen Feinden zum Tode durch giftige Schlangen verurteilt ist, singt noch vor seinem Ende: Ridens moriar, nach der Wiedergabe in der Litteratura Runica von OLAF WORM, zitiert in BLAIRS Dissertation on the Poems of Ossian, Appendix i.f. Niedersächsische Weisheit sagt: »Dei is arm, dei sick den Dod wünscht; äwest dei is noch vel armer, dei bang vör em is«, RAABE, Plattdeutsches Volksbuch, Wismar 1854 S. 75. Derlei Wertung kommt, richtig abgewogen, bei noch so großer Verschiedenheit von Ort, Zeit und Person, auf die Bilanz des PLOTINOS hinaus, die er dem PORPHYRIOS gibt, als dieser freiwillig sterben will, indem er ihm gleichmütig auszuharren empfiehlt, am Ende von LEOPARDIS Dialog: denn »das Leben ist ein Ding von so geringem Belang, daß dem Menschen, was ihn selbst betrifft, nicht viel darangelegen zu sein braucht, ob er es bewahren oder fahren lassen soll.« Mit Sāriputto und dem letzten Griechen stimmt es auch zusammen im Abgesang von Cymbeline IV 2:
Fear no more the heat o' the sun,
Nor the furious winter's rages;
Thou thy worldly task hast done,
Home art gone, and ta'en thy wages:
– – – – – – – – – – – – – – – – – –
Quiet consummation have:
And renowned be thy grave.
All dies ist aber recht wohl angedeutet im Verse eines unbekannten Dichters, erhalten in GRACIANS Agudeza, Discurso XXIV:
Ven muerte tan escondida,
Que no te sienta venir,
Porque, el plazer del morir
No me buelva à dar la vida.
Heimlich geht der Tod dir neben,
Und du hörst nicht seinen Gang,
Bin da sterbeselig bang
Nur nicht wieder aufzuleben.
1004 Vergl. Mittlere Sammlung 801f. Die Übung in den Pflichten und der Dienstbereitschaft wird im Anguttaranikāyo IV No. 245 (PTS 243) so besprochen: »Da hab' ich, ihr Mönche, den Jüngern die Pflichten zur Förderung des Wandels dargelegt, Unzufriedene zufriedenzustellen, Zufriedene immer noch mehr zu erfreuen: so daß man, ihr Mönche, diese Pflichten, wie sie von mir den Jüngern je und je zur Förderung des Wandels dargelegt werden, dabei je und je ungebrochen, unverletzt, ungemustert, ungesprenkelt beobachten, ihnen beharrlich nachkommen kann, Schritt um Schritt. Weiter sodann, ihr Mönche, hab' ich den Jüngern die Pflichten des Urasketentums [958] dargelegt, um das Leiden ganz und gar versiegen zu lassen: so daß man, ihr Mönche, diese Pflichten, wie sie von mir den Jüngern je und je um das Leiden ganz und gar versiegen zu lassen dargelegt werden, dabei je und je ungebrochen, unverletzt, ungemustert, ungesprenkelt beobachten, ihnen beharrlich nachkommen kann, Schritt um Schritt. So wird, ihr Mönche, die Übung gefördert.«
1005 Im Zusammenhang dargestellt in der 140. Rede der Mittleren Sammlung S. 1025; dazu gehört auch die 137. Rede, 1005-1007, mit den dort gezeigten sechsunddreißig Fesselpfaden. Sankt BERNHARD hat eine gleiche Arbeit vollbracht und alle Angehungen, die den Menschen ankommen, im Traktat über die Grundlegung der »Sieben Säulen des inneren Hauses« – ein Bauwerk, das unseren vier Pfeilern der Einsicht gegenübersteht – an der letzten Säule Halt geboten. Da wird der Geist des Menschen fähig sich völlig zu sammeln, an der Columna septima oder Illuminata ratio wird er einig. Und der Zisterzienser kommt mit der Erfahrung Sāriputtos überein: Omnes illicitas voluptatis affectiones et vagas memoriae cogitationes, cordis dispersiones, animi fluctuationes, spiritus evagationes et mentis distractiones in unum colligit, atque in illo felicitatis fonte totum suum desiderium figit. Si vero aliquem motum ad id quod non debet vel quomodo non debet moveri senserit, non consentiat, sed illico resistat. Molesta est lucta, sed fructuosa: quia si habet poenam, habebit et coronam. Non nocet sensus ubi non est consensus; imo quod resistentem fatigat, vincentem coronat. De interiori domo etc., ed. Par. 1621, fol. 1069 cap. XIX.
1006 Hierzu die 104. Rede der Mittleren Sammlung.
1007 Hauptstelle dieses Gipfels der Lehre Gotamos ist Mittlere Sammlung S. 1031. Vergl. dann auch Bruchstücke der Reden v. 916; verwandte Stellen in Anmerkung 356. Auf einem anderen Wege hat PLATON diese letzte Spitze der Betrachtung erklommen, wo der Blick alles aus dem Dünkel der Ichheit Gewordene, nur wie Nebel flüchtig Bestehende, als wesenlos durchschaut; sehr gut von SEXTUS EMPIRICUS (VI. Math. 57) in nuce gegeben: »Was man als entstehend erkannt hat, entsteht, aber niemals ist es.« Auch kann man getrost sagen, daß die ganze ungeheuere Arbeit KANTS in einem gleichen Ziele aufgeht: den Paralogismus der Personalität rein theoretisch nachzuweisen. Er gibt da, im Zentrum seiner Lehre, sogar ein Gleichnis, das trotz der ihm eigentümlichen Begriffsentwicklung vollkommen gotamidisch anspricht. »Eine elastische Kugel«, sagt er, »die auf eine gleiche in gerader Richtung stößt, theilt dieser ihre ganze Bewegung, mithin ihren ganzen Zustand (wenn man bloß auf die Stellen im Raume sieht), mit. Nehmet nun nach der Analogie mit dergleichen Körpern Substanzen an, deren die eine der andern Vorstellungen sammt deren Bewußtsein einflößete, so wird sich eine ganze Reihe derselben denken lassen, deren die erste ihren Zustand sammt dessen Bewußtsein der zweiten, diese ihren eigenen Zustand sammt dem der vorigen Substanz der dritten, und diese eben so die Zustände aller vorigen sammt ihrem eigenen und deren Bewußtsein mittheilete. Die letzte Substanz würde also aller Zustände der vor ihr veränderten Substanzen sich als ihrer eigenen bewußt sein, weil jene zusammt dem Bewußtsein in sie übertragen worden, und dem unerachtet würde sie doch nicht eben dieselbe Person in allen diesen Zuständen gewesen sein.« Die Bestätigung aber einer solchen Spekulation und Theorie vom unaufhörlichen Wandel und Wechsel einer wirklich nur eingebildeten Persönlichkeit wird oben, bei Sāriputto, durch eine Praxis dargetan, »wo der Gedanke ›Ich bin‹ vergangen ist und man dieser da zu sein nicht mehr merkt«: was man eben des ›Ich bin‹-Dünkels Zerstörung heißt. – Über die Pflege und Ausbildung der zuerst entwickelten vier Gemüterlösungen ist im Anguttaranikāyo X No. 208 (ed. Siam. p. 267f.) noch kurz [959] gesagt: »Geübt werden aber muß da, ihr Mönche, diese Gemüterlösung, in Liebe, in Erbarmen, in Freude, in Gleichmut, vom Weibe gleichwie vom Manne. Das Weib, ihr Mönche, gleichwie der Mann kann diesen Körper nicht alsogleich geschmeidig machen: das Herz beherrschen kann da der Sterbliche. Man wird klar darüber: ›Was ich auch je zuvor mit diesem tatentsprossenen Körper Schlechtes getan, all das muß hier empfunden werden, es kann nichts danebengehn.‹ Also geübt, ihr Mönche, mag die Gemüterlösung in Liebe, in Erbarmen, in Freude, in Gleichmut zur Nichtwiederkehr führen, wenn so ein Mönch nicht schon hienieden zur letzten Erlösung durchgedrungen ist.« In derselben Reihenfolge sind diese Gemüterlösungen, die vier heiligen Warten oder Weilungen, brahmavihārā, im Yogasūtram I 33 aufgezählt, so übernommen: Maitrīkaruṇāmuditopekṣāṇāṃ sukhaduḥkhapuṇyāpuṇyaviṣayāṇāṃ bhāvanāta cittaprasādanam: »Liebe, Erbarmen, Freude und Gleichmut über alles Wohl und Weh, Verdienst und Verschulden hinausüben läßt das Gemüt klar werden.« Eine vedische Vorstufe ist bei Āpastambas zu finden, Dharmasūtram I 8, 23, 1; weitere Beziehungen in der Anm. 549. – Die Befreiung auch von den heimlichsten und feinsten Stacheln des Zweifels und der Ungewißheit als Abschluß der Entrinnung, die Sāriputto nach ihren sechs Arten im Text oben angibt, ist der Zustand vollkommener Sicherheit und Fraglosigkeit. Wer den verwirklicht hat, ist »ein fraglos Freier geworden, hat siegend alles Ängsten überwunden«, Lieder der Mönche v. 8. Menschen, die es so weit gebracht haben, gehören nach der Einteilung SEUSES zu jenen fünften, die sich über die vier Arten der Frager emporgearbeitet haben: »Die fünften, die fragen nicht mehr, das sind vollkommene Leute, die sind über das Fragen hinweggekommen. Aber wo findet man sie? In diesen Leuten ist kein Verwundern mehr: denn Augustinus und Aristoteles sagen, daß Fragen komme von Verwundern. In diesen ist kein Verwundern mehr: denn die Wahrheit hat sie durchgangen.« BIHLMEYER 510.
1008 Mit S etc. anussatānuttariyam.
1009 Ist zugleich eine Abwehr der Lehre der Jainās, nach welcher der Mensch die Folgen schlechter Taten nur Stück um Stück leidvoll abbüßen könne: Anguttaranikāyo IV No. 195, ed. Siam. p. 274-279, als bekannter Lehrsatz wieder im Araṇykāṇḍam des Rāmāyaṇam vorgetragen, IX 31: na sukhāllabhate sukham, »nicht durch Wohlsein wird Wohlsein erlangt«; ebendiese jinistische Ansicht wird besonders ausführlich, mit großartigem Einblick und Umblick, in der 101. Rede der Mittleren Sammlung widerlegt. Durch eingehende Prüfung der hier von anderen Seiten überlieferten Hauptstellen wird die dunkle Schicksalslehre der Jainās bei den Zeitgenossen richtig beleuchtet und einigermaßen verständlich; wogegen BÜHLER es noch als unvereinbar gehalten hat mit den Ansichten Nāthaputtos, »daß Tugend wie Sünde, Glück wie Unglück den Menschen vom Schicksal unabänderlich bestimmt sei und durch die Befolgung des heiligen Gesetzes nichts an ihrer Bestimmung geändert werden könne«, Über die indische Secte der Jaina, Wien 1887, S. 24. Auch im Westen ist ja die Kehrseite jener in Indien wie überall verbreiteten Halbwahrheit, mit der Umschrift »Das Leben ist ein Schicksal«, oder wie der Lusitanier noch stärker meint »Tudo é sorte no mundo«, von den allerhand Weltergrüblern immer mit Vorliebe betrachtet worden, und es sind tausende von Abhandlungen darüber geschrieben. Doch kann man da nur, wie PERSIUS, lächeln und fragen: »Wer liest das noch? Etwa zwei, oder keiner.« Es schert sich heute wirklich niemand mehr darum was die Herren als prädestinatorisch und prädamnatorisch, antelapsarisch und infralapsarisch und so fort ohne Grazie zu deuten versucht haben: um darauf, nach ihrer praktischen Vernunft, wie KANT rügt, »überschwängliche Anmaaßungen mit Theorien des Übersinnlichen, wovon [960] man kein Ende absieht, zu gründen, dadurch aber die Theologie zur Zauberlaterne von Hirngespenstern zu machen«. Sei es nun so und so und wieder auch anders und anders gewesen: der Mensch liebt es jederzeit sich mit ausgetüfteltem Gedankenspuk über sein Leben und das Dasein hinwegzutäuschen. Muß er nicht
mit der Welt verkehren?
Das Leere lernen, Leeres lehren?
Er vermag nur selten einmal sich mit der Wirklichkeit abzufinden, kann sich nur äußerst schwer, wie MATTHIAS CLAUDIUS in einem seiner Lieder sagt, damit bescheiden lernen,
daß wir hier ein Land bewohnen,
Wo der Rost das Eisen frißt,
Wo durchhin, um Hütten wie um Thronen,
Alles brechlich ist;
Wo wir hin aufs Ungewisse wandeln,
Und in Nacht und Nebel gehn,
Nur nach Wahn und Schein und Täuschung handeln,
Und das Licht nicht sehn;
Wo im Dunkeln wir uns freun und weinen,
Und rund um uns, rund umher,
Alles, alles, mag es noch so scheinen,
Eitel ist und leer. –
Man muß jedoch den Jainās zugestehn, daß sie im ācāro oder Lebenswandel, in der Praktik, auf die es ja schließlich allein ankommt, dem Asketentum Gotamos recht nahe gefolgt sind, wie das der Ausgang ihres Āyāraṃgasuttam lehrt, vergl. Bruchstücke der Reden Anm. 779; wo durchaus derselbe Ton erklingt, als Hauptstimme auch wieder den Chor des Wandsbecker Boten mächtig anführt und zu Ende geleitet:
Diesseit und jenseit, gleichbestanden beiderseit,
Von jeder Fessel wer sich gänzlich abgelöst,
Der ist an nichts gehangen, nirgend eingepflanzt:
Dem Dasein, das der Rost zerfrißt, entgeht er frei.
Von gleicher Art ist der Lehrsatz Nāthaputtos, der in der 101. Rede der Mittleren Sammlung von seinen Jüngern erklärt wird: »durch Tatenversiegung Leidenversiegung«, kammakkhayā dukkhakkhayo. Dieser Ausdruck scheint von Nāthaputto eingeführt und von Gotamo übernommen zu sein. Er ist selten, sonst nur vereinzelt, offenbar als asketisches Erbstück, wie in der vetā vataropaniṣat VI v. 4 und im Mahābhāra tam XIII 338 zu finden. Später hat Hemacandras, der gelehrteste Jinist, im Karmakṣayajātistavas, dem 3. Abschnitt seines Vītarāgastotram, 15 Merksprüche darüber verfaßt.
Wie nach der Seite der Erkenntnis jene klare Besonnenheit, von der oben im Texte Sāriputto spricht, zu betrachten sei, und wie man dabei jede bloße Metaphysik und Spekulation als geistige Sandbänke loten und umschiffen lernt, zeigt die allumfassende Meisterrede im Anguttaranikāyo, Tikanipāto No. 62 (PTS No. 61), ed. Siam. p. 222-229. Drei gibt es, sagt Gotamo, der Hafenplätze, über die man sich mit Kennern zu befragen, auszuforschen, zu unterrichten pflegt; ist man aber hingelangt, so verharrt man in Untätigkeit: und welche drei? Manche Asketen und Priester sagen und lehren, daß [961] alles was der Mensch an Wohl und Weh oder weder Weh noch Wohl erfährt eine Folge seiner früheren Taten sei. Andere wieder behaupten, alles geschehe nach dem Plan eines Schöpfers. Und wieder andere: was immer der Mensch erlebt, es ist alles ein Spiel des Zufalls, unbegründet, unbedingt. Jenen Weltweisen, die das Leben des Menschen als sein vorhergewirktes Werk erklären, erwidert nun Gotamo, daß sie dann zu Mördern, Dieben, Lügnern, Gehässigen, Verblendeten usw. infolge ihrer früheren Taten werden könnten. Wenn sie sich da nun ernstlich auf die früheren Taten zurückbeziehn, dann gibt es für sie keinen Willen und keinen Kampf: ›Das ist zu tun, und das ist zu lassen.‹ Und da man sich so auf kein Tun und kein Lassen wahrhaft und sicher stützen kann, kommt es mit Leuten, die sich nicht zu besinnen und nicht zu behüten verstehn, zu keiner sich selbst betrachtenden, Asketen geziemenden Unterredung. Ganz auf die gleiche Weise werden sodann die anderen Gelehrten abgewiesen, die da vermeinen, alles geschehe nach dem Plan eines Schöpfers, oder alles sei bloß ein Spiel des Zufalls. Denn auch hier träfe immer zu, daß es dann keinen Willen und keinen Kampf gäbe: ›Das ist zu tun, und das ist zu lassen.‹ Und da man sich so auf eigenes Tun und Lassen nicht wahrhaft und sicher stützen kann, ist mit verwirrten und haltlosen Leuten nichts auszurichten. Das ist die Abweisung, die den Lehren jener Asketen und Priester gegeben wird. Denn es sind drei Hafenplätze, über die man sich mit Kennern zu befragen, auszuforschen, zu unterrichten pflegt; ist man aber hingelangt, so verharrt man in Untätigkeit. Da hab' ich denn, ihr Mönche, eine Satzung dargelegt, die man nicht abweisen, nicht bemakeln, nicht bemängeln kann, gegen die sich kein verständiger Asket oder Priester auflehnen kann: und was für eine Satzung ist das? Sechsfache Artung gibt es: Art zur Erde, Art des Wassers, Art des Feuers, Art der Luft, Art des Raumes, Art des Bewußtseins. Sechsfache Berührung: Gesicht ist Berührung, Gehör ist Berührung, Geruch ist Berührung, Geschmack ist Berührung, Getast ist Berührung, Gedenken ist Berührung. Achtzehn geistige Angehungen: hat man mit dem Gesichte eine Form erblickt, so geht man die erfreulich bestehende Form an, geht die unerfreulich bestehende Form an, geht die gleichgültig bestehende Form an. Hat man mit dem Gehöre einen Ton gehört, hat man mit dem Geruche einen Duft gerochen, hat man mit dem Geschmacke einen Saft geschmeckt, hat man mit dem Getaste eine Tastung getastet, hat man mit dem Gedenken ein Ding erkannt, so geht man das erfreulich bestehende Ding an, geht das unerfreulich bestehende Ding an, geht das gleichgültig bestehende Ding an. Vier heilige Wahrheiten: sechsfacher Artung anhangend kommt es zur Empfängnis, ist es dazu gekommen wird Bild und Begriff, durch Bild und Begriff bedingt ist sechsfaches Reich, durch sechsfaches Reich bedingt ist Berührung, durch Berührung bedingt ist Gefühl; wer aber fühlend geworden ist, ihr Mönche, dem künd' ich an ›Das ist das Leiden‹, künd' ich an ›Das ist die Leidensentwicklung‹, künd' ich an ›Das ist die Leidensauflösung‹, künd' ich an ›Das ist der zur Leidensauflösung führende Pfad‹. Hieran schließt sich nun die bekannte Darstellung, unserer 22. Rede gemäß, S. 390-396. In jene drei Hafenplätze, titthāyatanāni, hatte aber Gotamo sämtliche anderen noch möglichen einbezogen. Zu seiner Zeit waren insbesondere sechs titthakarā oder tīrthankarās, darunter auch der Freie Bruder Nāthaputto, als Häupter der Schulen berühmt: Ordensväter, bekannte, gefeierte Bahnbrecher, die viel bei den Leuten galten, Meister, die ihren Jüngern die Rettung über den saṃsāro oder das Meer der Wandelwelt und die sichere Landung im Hafen der Ewigkeit verhießen. Doch gab es noch unzählige andere tīrthās oder Gelegenheiten zur Überfuhr, wie es unsere 16. Rede 287 mit andeutet, späterhin das Mahābhāratam III 4091 etc. beglaubigt und heute noch an einer der abergläubigsten [962] östlichen Wallfahrten der Tempel des Koṭitīrthe varas, des »Herrn der Zehnmillionen Überfahrten«, bei Bhuvane var, nördlich Jagannāth, den Pilgerscharen bezeugt; »andersfährtige Pilger«, aññatitthiyā paribbājakā, wurden sie von Gotamo und seinen Jüngern genannt, nicht tadelnd, nur kennzeichnend, immer wie oben in unserer 28. und 29. Rede, S. 499, 508-513 usw. Der alte Volksgott aber dort auf seinem Altar, der denkt sich seit Jahrtausenden: Quot capita tot sensus. Und PERSIUS lächelt ihm zu:
Mille hominum species et rerum discolor usus.
Die Satzung Gotamos ist nun freilich dagegen, wie wir oben gesehn haben, auf eine äußerst bescheidene Norm gebracht: und zugleich vollkommen frei von Geheimsinn und Hinterweltkunde, sie beschränkt sich auf die jedem Verständigen zugänglichen Tatsachen. So schafft sie den festgefügten Stapel, sagt Telakāni in den Liedern der Mönche 764-766, von Pfeiler zu Pfeiler steigt man auf, erblickt das Schiff und erfindet die beste Überfuhr, tittham uttamam. Schiff, nāvā, ist da nur dichterischer Ausdruck für kullo, das eigentlich gemeinte Floß der Lehre: s. Anm. 842. In jenen Schulen der Philosophen und Weltergründer läuft die Weisheit ja stets mehr oder weniger dahin aus: »I have had a most rare vision«, nach Bottom's dream, so genannt »because it hath no bottom – past the wit of man to say what dream it was.« Sie philosophieren mit großem Eifer und Ernst eben in der Art des »methought I was, and methought I had, – but man is but a patched fool, if he will offer to say what methought I had. The eye of man hath not heard, the ear of man hath not seen; man's hand is not able to taste, his tongue to conceive, nor his heart to report, what my dream was.« Entgegen solchem träumerischem Vermeinen wird am Ende der 101. Rede der Mittleren Sammlung nicht nur der bestimmte Fall der Jainās sondern zugleich jede nur mögliche Art von Hirngespinst dahin gebracht, wo ein »methought I was, and methought I had« sich erledigt. Wenn die Wesen, heißt es da, durch vorhergewirktes Werk Wohl und Weh erfahren, dann hat der Vollendete ehedem gute Tat getan, da er sich jetzt wahnlos wohlfühlt. Wenn die Wesen nach dem Plan eines Schöpfers, oder durch Fügung des Zufalls, oder ihrer Geburt nach, oder durch eigene Anstrengung hier im Leben Wohl und Weh erfahren: dann war es ein gütiger Schöpfer, oder ein glücklicher Zufall, oder eine günstige Geburt, oder die eigene Anstrengung hier im Leben ist gelungen, da der Vollendete sich jetzt wahnlos wohlfühlt. Ob also die Wesen durch vorhergewirktes Werk und so weiter, oder durch ihre Anstrengung hier im Leben Wohl und Weh erfahren oder nicht: der Vollendete hat es recht getroffen. Derselbe Gedankengang ist noch auf andere Weise den Jainās gegenüber im zweiten Abschnitt der 14. Rede sehr anmutend ausgeführt, Mittlere Sammlung S. 105-107. KANT hat dieses Ergebnis mit wunderbarem Tiefblick so dargestellt, daß das Wohlbefinden oder die Glückseligkeit keineswegs ein Zweck der Natur in Ansehung des Menschen sei; weit gefehlt, daß sie ein Endzweck der Schöpfung sein sollte. Das Wohlbefinden oder die Glückseligkeit kann nichts anderes sein als die Übereinstimmung des Menschen mit seiner eigenen inneren moralischen Gesetzgebung. »Dies beweiset: daß die Glückseligkeit nur bedingter Zweck, der Mensch also nur als moralisches Wesen, Endzweck der Schöpfung sein könne; was aber seinen Zustand betrifft, Glückseligkeit nur als Folge, nach Maßgabe der Übereinstimmung mit jenem Zwecke, als dem Zwecke seines Daseins, in Verbindung stehe«: Ende der Schlußanmerkung zu § 84 der Kritik der Urteilskraft. Als eine andersartige schöne Bestätigung kann uns auch gelten wie Sokrates den Gegenstand im Euthyphron, p. 9f., erläutert: daß nämlich etwas nicht weil es leidig ist leidet, sondern weil es leidet leidig ist, ουδ' ότι πασχον εστι πασχει, αλλ' ότι πασχει πασχον[963] εστιν. Wer nun, wie Gotamo, das Selbst, attā, als nirgend auffindbar erklärt, daher alles als wandelbar, leidig, nichtig abweist, kann wirklich zu wahnlosem Wohlbefinden gelangen, ja es kann gar nicht anders ausgehn: weil er die Möglichkeit des Leidens in sich getilgt hat, ist er über jede Leidigkeit hinweggekommen, fraglos und wahnlos schon bei Lebzeiten zu einem leidlosen Wesen geworden; »wo kein Leid mehr statthat«, nach ECKHART. »Darum, wenn du dazu kommst, daß du weder Leid noch Beschwer haben magst um irgendetwas, und daß dir alle Dinge eine lautere Freude sind, so ist das Kind in der Wahrheit geboren«, ed. PFEIFFER p. 42. Ein Sinnbild dazu, nach außen betrachtet, ist des BENVENUTO CELLINI Atlas, der den Himmel als eine Kristallkugel auf dem Rücken trägt, und zu Füßen die Inschrift: Summa tulisse iuvat.
1010 Es ist hier ein einiges Sittengesetz als für alle Kasten und Stämme gültig aufgestellt: in vielen Reden Gotamos prachtvoll veranschaulicht, zumal in der 96. der Mittleren Sammlung, 738-743. Vergl. auch Anguttaranikāyo V No. 196 das vorletzte Traumgesicht des Erwachsamen: viererlei Vögel von verschiedener Farbe kommen aus den vier Weltgegenden herangeflogen, lassen sich zu Füßen des künftigen Meisters nieder und sind da alsbald ganz gleichmäßig weiß geworden; eben wie dann Krieger, Priester, Bürger und Bauern, wenn sie aus dem Hause in die Hauslosigkeit ziehn werden, im Orden des Vollendeten alle gleichmäßig die höchste Freiheit zu erwirken vermögen. Hiermit war schon der Begriff der Freiheit zureichend bestimmt worden. Gotamos Lehre, seine Satzung ist jedem offen, jedem zugänglich. Denn der Mensch
ist frei,
Und würd' er in Ketten geboren,
Laßt euch nicht irren des Pöbels Geschrei,
Nicht den Mißbrauch rasender Toren!
– – – – – – – – – – – – – – – – – –
Und die Tugend, sie ist kein leerer Schall,
Der Mensch kann sie üben im Leben,
Und sollt' er auch straucheln überall,
Er kann nach der göttlichen streben, usw.
Diese Freiheit des Menschen, als das ewige Gesetz in uns, hat auch der gerade hier so oft mißverstandene KANT durch ein ebenso schlichtes als überzeugendes Beispiel erläutert. Wenn der Landesfürst jemandem, unter Androhung unverzüglicher Todesstrafe, »zumuthete, ein falsches Zeugniß wider einen ehrlichen Mann, den er gerne unter scheinbaren Vorwänden verderben möchte, abzulegen, ob er da, so groß auch seine Liebe zum Leben sein mag, sie wohl zu überwinden für möglich halte. Ob er es thun würde, oder nicht, wird er vielleicht sich nicht getrauen zu versichern; daß es ihm aber möglich sei, muß er ohne Bedenken einräumen. Er urtheilet also, daß er etwas kann, darum weil er sich bewußt ist, daß er es soll, und erkennt in sich die Freiheit, die ihm sonst ohne das moralische Gesetz unbekannt geblieben wäre.« Kritik der praktischen Vernunft I 1 § 6 Ende. Das eben »ist die Idee der Freiheit, deren Realität, als einer besondern Art von Causalität (von welcher der Begriff in theoretischem Betracht überschwenglich sein würde), sich durch praktische Gesetze der reinen Vernunft und, diesen gemäß, in wirklichen Handlungen, mithin in der Erfahrung darthun läßt.« Kritik der Urteilskraft § 91 No. 2 Ende. Mehr als eine solche Möglichkeit der Freiheit, deren wirkliches Vorkommen sich in der Erfahrung dartun läßt, hat aber weder Gotamo noch KANT oder SCHILLER je darlegen oder behaupten wollen. [964] Sie allein ist uneingeschränkt, das heißt frei von Ketten; sie genügt, da die ganze zeitlose Lehre der Edlen in ihr schon enthalten ist, gültig für alle Kasten und Stämme. Vergl. noch Bruchstücke der Reden Anm. 1421 den Dank des Paria; wie auch wohl das hierhergehörige 41. Kapitel des FRANCKFORTERS, wo er sagt: »Und ê das [der mensch] unrecht wolte tûn, er wolt ê sterben, und das alles umb nicht denne der gerechtikeit zu liebe. Und dem wirt gerechtikeit zu lône und si lônet im mit ir selber, und dâ wirt und ist ein gerecht mensch«, ed. PFEIFFER4 164f.
1011 Zur durchdringenden, schneidenden Schärfe der Wahrnehmung cf. den Ausdruck vom schneidigen Wissen, scharfen Wissen, Mittlere Sammlung, eingangs der 111. Rede, S. 841. Die schneidende Schärfe, darauf kommt es an, nicht auf die Dauer des Nachdenkens, nicht auf die Quantität, auf die Qualität: wer sich die kürzeste Frist zu leben wünscht, solange nur etwa als man einen Bissen Speise kaut und schluckt, oder als man einmal ein- und ausatmet, dabei der Weisung des Meisters eingedenk, der hat viel getan; das ist der unermüdliche Mönch, scharf hat er den Tod durchdacht zur Wahnversiegung: Anguttaranikāyo VI No. 19. Es ist das die Kraft des Denkers, so machtvoll, daß man sie zauberhaft genannt hat. Diese Ansicht beruht auf der vedischen Vorstellung von mantras oder mantram. Das ist eigentlich nur ein einziger Gedanke, aber so groß, so gewaltig, daß er den, der ihn richtig denkt, unwiderstehlich zum Ziel führt. Zwar wird die gesamte Vedenkunde mantram geheißen: doch ist sie schon ganz und gar in der einen Silbe Om gegeben, die alles enthält und umfaßt, etad evākṣaraṃ trayī vidyā, »ebendieser Laut ist das Dreivedentum«, lehrt die uralte Überlieferung des Jaiminis im Upaniṣadbrāhmaṇam I 18, 10. Daher gilt bei Vedenmeistern dieser vollkommen verstandene Ton a-u-m = om als der mantras oder Denkspruch der höchsten Potenz, wörtlich: Denkschutz; weil mantras erklärt wird mananena trāyate, mantraḥ, »durch Denken schützt er, der Denkschutz«, noch bei Nārāyaṇas zur Rāmapūrvatāpanīyopaniṣat I 12: mananāntrāṇanānmantraḥ, »weil man denkt und sich schützt, Denkschutz«, d.i. Denkspruch. Solche hochmystische Lehre ist in der ältesten Upanischad, Chāndogyā II 23 Ende, »Das Om nur ist die ganze Welt«, bis zu den jüngsten, wie Yogacūḍāmaṇi v. 87, »Das Om ist jenes höchste Licht«, als das letzte Geheimnis vorgetragen, wird auch in der Smṛti so betrachtet, z.B. Mahābhāratam XII 269, 35, »Om ist der Weisheit Inbegriff«. Solchen Scharfsinn aber und solche Geheimkunst von Silbe und Wort hat Gotamo abgelehnt, siehe Bruchstücke der Reden v. 258 bis 269. Bei ihm ist das eine allmächtige mantram nichts anderes als der Todesgedanke. Bei ihm ist der Seherspruch des LUCANUS, IX 581/3, Wort um Wort erfüllt:
Sortilegis egeant dubii, semperque futuris
Casibus ancipites: me non oracula certum
Sed mors certa facit, pavido fortique cadendum est.
Es ist die meditatio mortis assidua, in ossibus ipsis ac medullis, von der auch PETRARCA gesprochen hat, bei Eröffnung des ersten Dialogs de contemptu mundi, quem Secretum suum inscripsit. Es ist das am Ende der Doctrina des heiligen BERNHARD angegebene Allheilmittel: Singulare autem contra omnia mala remedium est mortis memoria, ed. Par. 1621 fol. 1750. Davon hat um dieselbe Zeit HELOISE geschrieben in ihren Briefen an ABAELARD, deren Inhalt POPE, gegen Schluß seiner meisterhaften Dichtung, in das Denkwort faßt: »O Death all eloquent!«; was dann BÜRGER in seiner Übertragung so wiedergibt: »Tod, o Tod, du Redner ohne Gleichen.« Ein Erlebnis der Art, wo eine kurze Frage über den Tod als Panazee wirkt, ist in den Liedern der Nonnen berichtet, v. 51-53. Sāriputto nun war derjenige von den Jüngern, der [965] sich durch schneidiges Wissen, scharfes Wissen besonders auszeichnete; während wieder andere auf andere Weise geschätzt waren, wie z.B. Moggallāno um sein Geschick zu den Schauungen, oder Puṇṇo Mantāṇiputto um seine Kenntnis und Darlegung gewisser kurzgefaßter Meisterworte oder Stempel der Lehre. Solche Charakteristik der einzelnen Gestalten ist, gewiß nach den wirklichen Verhältnissen, in unseren Urkunden nicht selten zu finden. Sogar in den breiten Volksschichten ist ein Bewußtsein davon erhalten geblieben, Jahrhunderte hindurch. Noch HIUEN-TSIANG berichtet, daß er auf seiner Pilgerfahrt um 634 in Mathurā (an der Yamunā, heute Mattra, südlich Delhi) auch kleinere Kuppelmale gesehn habe, die dort zur Erinnerung an hervorragende Jünger errichtet waren, besucht und bekränzt wurden: Sāriputto sei verehrt worden wegen seiner durchdringenden Weisheit, also entsprechend der 111. Rede der Mittleren Sammlung; Moggallāno wegen seiner Schausamkeit, nach dem Mogallānasaṃyuttam, vergl. auch Lieder der Mönche v. 1172; Puṇṇo Mantāṇiputto wegen seiner Kenntnis der Meisterworte, wie das die 24. und zumal die 145. Rede der Mittleren Sammlung zeigt; und weiter noch andere, je und je nach ihrer Art: CUNNINGHAM, Archaeological Survey of India, vol. I pag. 231-235, wo die heute noch vorhandenen Ziegel- und Steinreste von neun alten kleineren Kuppelmalen beschrieben sind. Zwei davon sind gegen Norden gelegen und noch immer unter ihren einst vielsagenden buddhistischen Namen bekannt, sieben südlich der Stadt und längst vom Volke auf göttliche Geister und vedische Seher bezogen. Am westlichen Hügel der Kankālī Tīlā ist dagegen die reichste Fundgrube jinistischer Denkmäler entdeckt worden, mit deren Standbildern usw. man bisher über hundert Inschriften, die bis in das erste Jahrhundert nach Asoko zurückreichen, seit FÜHRERS Ausgrabungen (1890) wiedergefunden hat, und die also bezeugen, daß in Mathurā die Sakyaputtiyā oder Jünger des Sakyerasketen und die Nāthaputtiyā oder Jünger Nāthaputtos gleichzeitig in hohem Ansehn standen. BÜHLER gibt 77 Tafeln der Inschriften, Epigraphia Indica vol. I p. 371-397, vol. II ρ. 195-212, und LÜDERS die gesamte Liste unter No. 16-149 im Appendix zu vol. X, Kalkutta 1912.
1012 Nachweise in Anmerkung 588.
1013 Nach der 110. Rede der Mittleren Sammlung wiederholt. Über das »viel wissen« ebenda das Ende der 12. Rede: wenn einer auch hundert Jahre lebte, mit den höchsten Geisteskräften begabt, und rastlos Frage um Frage stellte, und keine Frage zum zweitenmal, er käme so nie ans Ziel, könnte die Lehre nie auserkunden, es wäre des Fragens und Erklärens kein Ende, und er stürbe darüber hinweg. Diese Art von Gelehrsamkeit hatte auch Gotamo als Arzt verachtet, ein Heilkundiger wie HIPPOKRATES, der hundert Jahre später den Aphorismus prägte: Ό βιος βραχυς, ή δε τεχνη μακρη, vita brevis, ars longa, die Kunst ist lang, und kurz ist unser Leben. Denn der arme süchtige Mensch muß wohl, bevor er nur den halben Weg dahinschleichend erreicht, ins Gras beißen. Mit dem multum ist daher, wie beim jüngeren PLINIUS, non multa gemeint; ein Motto, das zwar SCHOPENHAUER gewählt hat, das jedoch besser für SAN FRANCESCO paßt, auf den es CELANO auch wirklich bezieht, in der Vita secunda cap. CXIX: quaerit non corticem sed medullam, non testam sed nucleum, non multa sed multum, summum et stabile bonum: so zeichnet er ihn nach dem Leben. Qui multa sequitur nihil integre consequenter, hatte Sankt BERNHARD erkannt. Sogar POPE sagt es uns, im Essay on Man gleich zu Beginn:
since life can little more supply
Than just to look about us, and to die.
[966] Was ist also das Vielwissen? Ein viel wissen. Da kommt einmal ein Jünger zu Gotamo heran und bringt die Frage vor: »›Man weiß viel und ist ein Kenner der Lehre‹, so heißt es, o Herr: inwiefern denn aber, o Herr, weiß man viel und ist ein Kenner der Lehre?« Der Meister lobt die Frage als eine wohlzutreffende und gibt die Antwort: »Viele Dinge hab' ich, o Mönch, gezeigt: mag nun aber ein Mönch auch nur bei einem vierzeiligen Spruche den Sinn verstehn, die Lehre verstehn und der Lehre lehrgemäß nachfolgen, so kann man schon von ihm sagen, daß er viel weiß und ein Kenner der Lehre ist«, Anguttaranikāyo, Catukkanipāto No. 186, ed. Siam. p. 248f. Der Asket hat anderes und wichtigeres zu tun als pallavapāṇḍityam oder Polymathie zu pflegen, de rebus omnibus et quibusdam aliis zu wissen und zu reden, wie etwa unsereins. Ihm kommt der Titel zu, der auf PASCALS Grabstein zu lesen ist: Doctus, non Doctor. Und er kann noch den höheren Titel gewinnen, den sich FRANZ VON ASSISI beigelegt hat: Professor paupertatis. Alles zu wissen ziemt ihm wohl: es ist aber nicht das Alleswissen oder die παντεπιστημη des ARISTOTELES, es ist das alles verstanden haben, παντα πυϑεσϑαι, des PARMENIDES. Auch der ägyptische MAKARIOS hat es verbürgt und gesagt: Εξ ἑνος δε ὑποδειγματος συννοησον μοι παντα, Aus nur einer Andeutung ist mir alles verständlich geworden, ed. FLOSS 1850 p. 222; oder wie RABELAIS diese alte Überlieferung wiedergibt: A bon entendeur ne faut qu'une parolle, Pantagruel V 7 i.f. Der recht Vertraute, recht Gewitzigte braucht ja, nach Gotamos Welt- und Menschenkunde, nicht einmal die ganze Ordensregel zu kennen, mit ihren hundertfünfzig einzelnen Verordnungen und Bestimmungen, und kann doch ein vollkommener Jünger sein, zum Wahnversiegten werden, Anguttaranikāyo, Tikanipāto No. 85-89 (PTS 83-87), ed. Siam. p. 299-306: »Mehr als hundertfünfzig, ihr Mönche, der Ordensregeln sind es, die halbmonatlich vorgetragen werden, wo sich da heilsuchende edle Söhne befleißigen. Drei Regeln gibt es, ihr Mönche, worin dieses Ganze beschlossen ist: und welche drei? Hohe Tugend üben, hohen Sinn üben, hohe Weisheit üben. Das sind, ihr Mönche, drei Regeln, worin dieses Ganze beschlossen ist.« Diese Sparsamkeit der Mittel, die sich auf das Beste beschränkt, ist von Gotamo wiederholt gezeigt worden: so z.B. dem ehrwürdigen Bhaddāli gegenüber, Mittlere Sammlung 480; desgleichen in einem Gespräch mit dem großen Kassapo, Saṃyuttakanikāyo ed. Siam. vol. II ρ. 201-203 (PTS 223-225). Der kommt eines Tages zum Erhabenen hin um die Frage zu stellen: »Was ist wohl, o Herr, der Anlaß, was ist der Umstand, daß es früher weniger Ordensregeln gab, aber mehr der Mönche gewiß bestanden? Und was ist wiederum, o Herr, der Anlaß, was ist der Umstand, daß es heute mehr der Ordensregeln gibt, aber weniger Mönche gewiß bestehn?« Der Meister antwortet: »Also ist es eben, Kassapo, wann die Leute sich verschlechtern, wann die rechte Lehre untergeht, daß es mehr der Ordensregeln gibt, aber weniger Mönche gewiß bestehn. Nicht eher, Kassapo, wird der rechten Lehre Untergang offenbar, bis nicht ein Scheinbild der rechten Lehre in der Welt aufgeht; sobald aber, Kassapo, ein Scheinbild der rechten Lehre in der Welt aufgeht, dann wird der rechten Lehre Untergang offenbar. Gleichwie etwa, Kassapo, nicht eher des Goldes Untergang offenbar wird, bis nicht ein Scheinbild des Goldes in der Welt aufgeht: sobald aber, Kassapo, ein Scheinbild des Goldes in der Welt aufgeht, dann wird des Goldes Untergang offenbar: ebenso nun auch, Kassapo, wird nicht eher der rechten Lehre Untergang offenbar, bis nicht ein Scheinbild der rechten Lehre in der Welt aufgeht; sobald aber, Kassapo, ein Scheinbild der rechten Lehre in der Welt aufgeht, dann wird der rechten Lehre Untergang offenbar. – Nicht kann da, Kassapo, Art der Erde, Art des Wassers, Art des Feuers, Art des Windes die rechte Lehre zum Untergang bringen: aber hier eben kommen [967] sie auf, die eitlen Menschen, die diese rechte Lehre zum Untergang bringen.« Solche Warnungen zeigen klar, daß Gotamo die Kasuistik des Vinayo vorausgesehn und unbezweifelbar abgelehnt hatte. Er wußte gar wohl: je schlechter der Orden, desto mehr der Regeln. Auch er hatte die Erfahrung gemacht, die CAESAR bei SALLUST ausspricht: omnia mala exempla ex bonis initiis orta sunt, alle schlechten Beispiele kommen aus guten Anfängen her; mit dem Revers im TACITUS: das verderbteste Gemeinwesen hat die meisten Gesetze, corruptissima re publica plurimae leges. EPIKTET hatte seine ganze Weltkunde in zwei Worte gefaßt und gesagt: Wenn einer die beiden im Herzen hat und ihnen treulich gehorcht, so kann er wohl nicht mehr irren und wird das beruhigteste Leben führen. Die zwei Worte, die er so empfahl, waren aber: ανεχου και απεχου, sustine et abstine, halt' aus und halt' ein. GELLIUS, Noct. Attic. Hb. XVII cap. 19. Stoische Apathie, Bequemlichkeit? Aber FRANZ VON ASSISI hat einen Ordensbruder, der ihm Zuspruch aus der Heiligen Schrift anraten zu sollen vermeinte, mit der urchristlichen Antwort und Abwehr beschwichtigt: Es fehlt mir nichts mehr: ich weiß Christum arm und gekreuzigt. CELANO, Vita secunda cap. XLVIII. Unser JOHANNES WESSEL, ein Freund FRANCESCOS DELLA ROVERE, des nachmaligen Papstes der Sistina, zugleich einer der glänzendsten Humanisten, Vorläufer LUTHERS und Lux mundi genannt, hatte sich dieses Wort des Armseligen von Assisi so innig bewahrt, daß es ihm in der Sterbestunde einfiel, und er all seine hochgelehrten und hochberühmten Abhandlungen und Untersuchungen, die dann LUTHER dreißig Jahre später heraus gab, als leeres Gerede hinter sich warf, mit dem Abschied: Nichts weiß ich als Jesum, und den gekreuzigt. BAYLE, Dictionaire s.v. WESSELUS, Anmerkung H. Das aber war es auch gewesen, was der große herrliche MAKARIOS mit seiner, oben näher bezeichneten, Andeutung gemeint hatte. Hierzu noch Mittlere Sammlung Anm. 337 und Bruchstücke der Reden v. 714, wo der Pilger Nāḷako, nach einem bedeutsamen kurzen Gespräch über die Lehre, zu Gotamo sagt:
Die Fülle reicher Regelkunst
Erfind' ich beim Asketen nicht,
Nicht kommt man zwiefach an sein Ziel:
Hier ist es einfach ausgedacht.
1014 Vergl. oben die 29. Rede, S. 507.
1015 »Durch die Abkehr vom Willen wird Unsterblichkeit verwirklicht«, sagt Gotamo: chandassa pahānāya amataṃ sacchikataṃ hoti, Saṃyuttakanikāyo vol. V p. 195 (PTS 181); was vergänglich, leidig, nichtig, wesenlos ist, mit Reiz versetzt, davon wird der Mönch den Willen abkehren, III 68-70 (76-79). Darum empfiehlt auch Sāriputto den Jüngern, sie sollen, wenn sie gefragt werden, was ihr Meister verkündet, antworten: »Die Entwöhnung vom Willensreiz, ihr Brüder, verkündet unser Meister«, chandarāgavinayakkhāyī kho no āvuso satthā, ib. III 7. Der Wille als Herrscher über die Wünsche ist Selbstüberwinder; »eben durch den Willen wird der Wille überwunden: denn ist durch den Willen die Heiligkeit erreicht, so ist der Wille danach gestillt«, Mittlere Sammlung Anm. 102. SEUSE hat dieses Verhältnis ebenso tief gesehn, ebenso kurz gezeigt, gegen Ende des Gesprächs im 5. Abschnitt des Büchleins der Wahrheit, wo das Ziel des Menschen angegeben wird als Eingehn in das Nichts, d.i. SEUSES Gott. Da heißt es: »Eine Frage. Ob der Wille in dem Nichts zergeht? Antwort. Ja, nach seinem Wollen. Denn so frei auch der Wille ist, so ist er allererst frei geworden, wenn er nicht mehr zu wollen braucht.« Wie aber das zustande kommt, und hier allein die Diallele zurecht besteht, wird vom ehrwürdigen Ānando im Gespräch mit[968] einem priesterlichen Gelehrten sehr einfach durch ein anschauliches und überzeugendes Gleichnis gezeigt. Der Bericht findet sich im letzten Bande des Saṃyuttakanikāyo 272f. (PTS 271) und lautet also: »Das hab' ich gehört. Zu einer Zeit weilte der ehrwürdige Ānando bei Kosambī, in der Gartenstiftung. Da ist denn Uṇṇābho der Priester zum ehrwürdigen Ānando herangekommen. Dort angelangt hat er dem ehrwürdigen Ānando höflichen Gruß dargeboten, freundliche, denkwürdige Worte gewechselt und beiseite Platz genommen. Beiseite sitzend wandte sich dann Uṇṇābho der Priester also an den ehrwürdigen Ānando: ›Zu welchem Zwecke wird denn wohl, Herr Ānando, beim Asketen Gotamo heiliges Leben geführt‹ – ›Zur Abkehr vom Willen wird, Priester, beim Erhabenen heiliges Leben geführt.‹ – ›Gibt es aber auch, Herr Ānando, einen Weg, gibt es einen Pfad, um sich von jenem Willen abkehren zu können‹ – ›Es gibt wohl, Priester, einen Weg, es gibt einen Pfad, um sich von jenem Willen abkehren zu können.‹ – ›Was ist das aber, Herr Ānando, für ein Weg, was ist das für ein Pfad, wo man sich von jenem Willen abkehren könnte?‹ – ›Da kann, Priester, ein Mönch das durch Innigkeit, Ausdauer und Sammlung des Willens erworbene Machtgebiet gewinnen, das durch Innigkeit, Ausdauer und Sammlung der Kraft erworbene Machtgebiet gewinnen, das durch Innigkeit, Ausdauer und Sammlung des Gemütes erworbene Machtgebiet gewinnen, das durch Innigkeit, Ausdauer und Sammlung des Prüfens erworbene Machtgebiet gewinnen. Das eben ist, Priester, der Weg, das ist der Pfad, wo man sich von jenem Willen abkehren kann.‹ – ›Ist es also, Herr Ānando, dann haben wir eine unendliche Linie und keinen Abschluß: denn daß einer sich eben durch den Willen vom Willen abkehren könnte, das gibt es nicht.‹ – ›Da darf ich wohl, Priester, eben hierüber eine Frage an dich richten: wie es dir gutdünkt magst du sie beantworten. Was meinst du wohl, Priester: hattest du vorher den Willen nach dem Garten zu gehn, und ist, nachdem du hergekommen, der Wille danach beschwichtigt?‹ – ›Gewiß, Herr.‹ – ›Hattest du vorher die Kraft nach dem Garten zu gehn, und ist, nachdem du hergekommen, die Kraft dazu beschwichtigt‹ – ›Gewiß, Herr.‹ – ›Hattest du vorher das Gemüt nach dem Garten zu gehn, und ist, nachdem du hergekommen, das Gemüt dazu beschwichtigt‹ – ›Gewiß, Herr.‹ – Hattest du vorher das Prüfen nach dem Garten zu gehn, und ist, nachdem du hergekommen, das Prüfen dazu beschwichtigt? – ›Gewiß, Herr.‹ – ›Ebenso nun auch, Priester, wenn da ein Mönch heilig geworden ist, ein Wahnversieger, Endiger, der das Werk gewirkt, die Last abgelegt, das Heil sich errungen, die Daseinsfesseln vernichtet, sich durch vollkommene Erkenntnis erlöst hat, so ist ihm was vorher Wille war heilig zu werden, nach erlangter Heiligung als Wille danach beschwichtigt; was vorher Kraft war heilig zu werden, nach erlangter Heiligung als Kraft dazu beschwichtigt; was vorher Gemüt war heilig zu werden, nach erlangter Heiligung als Gemüt dazu beschwichtigt; was vorher Prüfen war heilig zu werden, nach erlangter Heiligung als Prüfen dazu beschwichtigt. Was meinst du wohl, Priester: verhält es sich also, haben wir dann einen Abschluß und keine unendliche Linie‹ – ›Ja freilich, Herr Ānando: bei solchem Verhältnisse haben wir einen Abschluß und keine unendliche Linie. Vortrefflich, Herr Ānando, vortrefflich, Herr Ānando! Als Anhänger möge mich Herr Ānando betrachten, von heute an zeitlebens getreu.‹« Mit dem hier gegebenen Bericht ist nun noch die wichtige Zusammenfassung der verwandten Stellen über ebendiesen Willen, chando, zu vergleichen, die zu v. 865 in den Bruchstücken der Reden beigebracht wurde; weiterhin auch ebenda v. 1037 u. 1114. Die Übereinstimmung SCHOPENHAUERS, die jedoch nur bis zu einem gewissen Grade reicht und dann scharf abbricht, ist oben Anm. 419 dargetan. Denn wenn SCHOPENHAUER als bloßer [969] Theoretiker und mit seiner mehr oder weniger doch nur weltmännischen Erfahrung auf das allzu beschränkte, allzu bequeme Velle non discitur sich ein halbdutzendmal beruft und sich daran schon genügen läßt, so mag dieses Wort vom gewöhnlichen Menschendurchschnitt immerhin gelten: für den rüstigen Kämpfer, der über den Alltag hinausstrebt, hatte aber SENECA, im vorangehenden (80.) Brief an LUCILIUS, den viel tiefer erkannten, in solchem Falle durchaus zutreffenden, rein buddhistisch gedachten Merkspruch geprägt: Quid tibi opus est ut sis bonus? Velle. Ebendiese wahrhafte Erkenntnis ist es, die auch Sanct BERNHARD auf das stärkste bekräftigt hat, in seiner Schrift »Über den Aufbau des inneren Hauses«: Sieben Säulen, sagt er, sind da zu errichten, und die erste Säule ist die bona voluntas. Prima igitur columna prior erigatur, die erste Säule soll denn zuerst errichtet werden. Voluntas hominis est potestas dei, der Wille des Menschen ist die Macht Gottes. Voluntas hominis est, quia velle in voluntate hominis est, der Wille ist des Menschen, weil das Wollen im Willen des Menschen ist; et ideo totum meritum in voluntate est, und darum ist alles Verdienst im Willen. Voluntas tamen bona non est, si non operatur quod potest, der Wille ist aber nicht gut, wenn er nicht schafft was er kann. Das ist der Aufbau der ersten Säule, primae columnae, quae est bona voluntas. Primum est principale donum bona voluntas esse cognoscitur: per quam imago similitudinis dei in nobis reparatur. Primum est, quia a bona voluntate bonum omne inchoatur, das erste ist es, weil vom guten Willen alles Gute anfängt; principale est, quoniam bona voluntate nihil hominibus utilius datur, das vornehmste ist es, weil es nichts gibt was den Menschen nützlicher wäre als der gute Wille. De interiori domo, id est conscientia aedificanda, caput VIII, ed. 1621 fol. 1065. Vergl. noch oben Anm. 965 vorletzter Absatz Ende, auch Anm. 959, gegen Ende u. 1010. – Sehr leicht verständlich und einleuchtend, sozusagen volkstümlich, ist das Verhältnis des Willens beim Menschen in einem Gespräch behandelt, das im Saṃyuttakanikāyo aufbewahrt ist, ed. Siam. vol. IV p. 400-404, PTS 327-330. Es wird da vermeldet, wie der Amtsrichter einer kleinen Stadt in die Umgebung aufs Land geht, dahin wo Gotamo auf der Wanderschaft gerade weilt. Als er den Mönch dort bemerkt, kommt er heran, verbeugt sich und nimmt beiseite Platz. Nun richtet er alsbald die Bitte an den Meister, ihn gütig aufklären zu wollen, wie Leiden entsteht und wie es vergeht. Also angegangen erwidert Gotamo, daß eine Aufklärung über das Entstehn und Vergehn des Leidens im Hinblick auf die Vergangenheit oder auf die Zukunft ihm etwa Zweifel und Bedenken erregen könnte. Daher wolle er ihm, so wie sie eben jetzt beisammen sitzen, das Entstehn und Vergehn des Leidens erklären: er möge auf seine Worte nur gehörig achtgeben. Jener Amtsrichter ist damit gern einverstanden, und Gotamo fragt ihn nun, ob es an seinem Orte Leute gebe, deren Tod oder Gefangennahme, Schaden oder Schande ihm Kummer, Jammer und Schmerz, Gram und Verzweiflung bereiten würden? Der Mann bejaht die Frage, und er bejaht auch die fernere Frage, ob es an seinem Orte auch Leute gebe, bei denen er dergleichen nicht weiter empfinden würde. Was ist aber, fragt ihn nun Gotamo, der Anlaß, was ist der Grund, daß er bei den einen Leuten so und bei den anderen Leuten anders empfindet? Zu den einen, antwortet der ehrliche Mann, verlangt ihn der Wille, und zu den an deren verlangt er ihn nicht. Das ist eine Sache, sagt hierauf Gotamo, die man augenblicklich einsehn und verstehn kann; hast du die gefaßt und ergründet, so kannst du nach Vergangenheit wie nach Zukunft hin den Schluß ziehn: Was auch irgend in vergangener Zeit an Leiden sich entwickelt hat, alles das war im Willen gewurzelt, aus dem Willen entstammt: denn der Wille ist die Wurzel des Leidens; und was auch irgend in künftiger Zeit an Leiden sich entwickeln wird, alles das wird [970] im Willen gewurzelt, aus dem Willen entstammt sein: denn der Wille ist die Wurzel des Leidens. – Da ist jetzt der Besucher dort wundersam entzückt von dem treffenden Meisterwort. Innig ergriffen bestätigt er es gleich näher aus seiner eigenen Erfahrung und erzählt, wie sehr er an seinem Sohne hängt; der lebt an einem anderen Orte, und wenn er von Zeit zu Zeit einen Boten hinschickt um sich nach ihm zu erkundigen, so ist er bis zur Rückkunft immer in Angst, ob es dem Knaben noch wohlergehe, und er dächte gar sterben zu müssen, wenn dem etwas geschähe; und so ist er auch der Mutter des Knaben, seiner vielgeliebten Gattin, zärtlich zugetan und könnte ihren Verlust kaum ertragen; wie furchtbar wäre sein Kummer und Schmerz, sein Gram und seine Verzweiflung, wenn diesen teueren Wesen etwa ein Übel oder ein Unglück zustieße. Eben darum aber, schließt nun Gotamo das Gespräch, ist das den Um ständen gemäß zu verstehn: Was irgend an Leiden sich entwickelt, alles das ist im Willen gewurzelt, aus dem Willen entstammt: denn der Wille ist die Wurzel des Leidens.
Den schon erfahrenen Jüngern gegenüber hat der Meister sich freilich noch feiner ausgesprochen, ibid. V p. 14f. (PTS 12f. fehlerhaft): »Da ist der Wille ungestillt, die Erwägungen sind ungestillt, die Wahrnehmung ist ungestillt: dadurch bedingt aber ist Empfinden; da ist der Wille gestillt, die Erwägungen sind gestillt, die Wahrnehmung ist gestillt: und auch dadurch bedingt ist Empfinden. Das Unerreichte zu erreichen kann man sich mühn (atthi vāyāmaṃ); ist aber dieser Zustand erreicht, so ist auch dadurch bedingt Empfinden.« – Meister ECKHART sagt: Aller Gestürme Unfriede kommt einzig vom eigenen Willen, man merk' es oder merk' es nicht: ed. PFEIFFER p. 571. Der Wille ist der Schöpfer: PLATONS Ζευς δι' οὑ ζωμεν, der Lebendige, durch den wir leben; ζωης παρεκτικος, der Entzünder des Lebens, der Zeus, der den Gezeugten zwingt zu weinen über all das Unheil, das ihn ankommt, im Kresphontes des EURIPIDES,
ὁ δε κελευων
τον φυντα ϑρηνειν εις ὁσ' ερχεται κακα.
1016 Mittlere Sammlung 391: »er hat Einsicht, ist mit höchster Geistesgegenwart begabt: was da einst getan, einst gesagt wurde, daran denkt er, daran erinnert er sich.«
1017 Siehe 16. Rede S. 245, 266.
1018 Einzeln erklärt in der 70. Rede der Mittleren Sammlung, 511-513. Der Anguttaranikāyo III No. 21 gibt noch ein Gespräch der Jünger untereinander und dann vor dem Meister, wobei sich die Begriffe entwickeln, daß beim Körperzeugen die Einigung vorwiegt, beim Aufgeklärten die Weisheit und beim Gläubigerlösten der Glaube, das ist die Zuversicht zur Lehre. Man kann aber hierbei nicht wohl, sagt abschließend Gotamo, einen von diesen Menschen für edler und weiter vorgeschritten erachten als den anderen: denn jeder von ihnen mag, je nach seiner Art, schon bei Lebzeiten das letzte Ziel zu erreichen imstande sein, oder mag auch erst späterhin dazu gelangen. Wir haben da eine Verschiedenheit der geistlichen Anlagen der Jünger zu merken, derart wie sie auch bei SEUSE klar aufgezeigt wird, Großes Briefbuch No. XXI: Einer läuft mit großer Strengheit, einer eilt mit lauterer Abgeschiedenheit, [971] einer fliegt mit schausamer Hoheit, ein jeder wie ihm gemäß ist: ihre Weise ist ungleich, und haben doch ein Ende.
1019 Hierzu der Mittleren Sammlung 64. und 148. Rede, S. 469 und 1069-1071. Nach Anguttaranikāyo VI No. 76 schließen sich an den Dünkel noch folgende fünf zu überwindende Dinge an: Geringschätzung, Überschätzung, Überhebung, Stumpfheit, Niedergeschlagenheit: »das sind, ihr Mönche, sechs Dinge, die man verloren haben muß um die Heiligkeit verwirklichen zu können.« Die Anwandlung des Nichtwissens oder Unwissens ist zu Eingang der großartigen 61. Rede im Dasakanipāto des Anguttaranikāyo derart gezeigt: »Der Anbeginn des Nichtwissens, ihr Mönche, kann nicht erkannt werden: ›Von damals zurück hat es kein Nichtwissen gegeben, aber nachher hat es sich entwickelt‹: so etwa, ihr Mönche, verhält es sich nicht, sondern es kann nur erkannt werden: ›Dadurch bedingt ist Nichtwissen.‹ Denn das Nichtwissen, sag' ich, ihr Mönche, muß Nahrung haben, es kann ohne Nahrung nicht bestehn: und was ist die Nahrung des Nichtwissens?« Wunscheswille, Gehässigkeit, Trägheit usw., übler Wandel, Unbesonnenheit, nichts beachten und sich um nichts kümmern, wobei immer eines die Nahrung des anderen ist und als letzten Nährboden schlechte Gesellschaft hat. So wird das Nichtwissen genährt und aufgezogen. So aber kann auch nur durch Nahrung die Freiheit des Wissens zustandekommen, kann sich nicht ohne Nahrung entwickeln; edle Gesellschaft ist der Nährboden, edler Satzung Gehör geben zeitigt das weitere Wachstum, achtsam, klar besonnen werden, die Sinne wohl bewahren, reinen Wandel pflegen, die vier Pfeiler der Einsicht erobern, die sieben Erweckungen verwirklichen lernen: das läßt am Ende die Freiheit des Wissens aufgehn. – Den Umgang mit Edlen oder mit Schlechten als den Nährboden des Menschen anzusehn ist ebenso die Grundlage der griechischen Weltbetrachtung gewesen: von STOBAIOS kurz beschrieben als ότι χρη περι πολλου ποιεισϑαι τας των σοφων συνουσιας, εκκλινειν δε τους φαυλους και απαιδευτους, »daß man vielbeflissen sein muß mit den Weisen beisammen zu sein, auszuweichen aber den Gemeinen und Unkundigen«, Ecl. lib. II cap. 14. Sagte doch Eteokles, in den Sieben gegen Theben:
Εν παντι πραγει δ' εσϑ' ὁμιλιας κακης
κακιον ουδεν.
Inder wie Griechen hatten dieses wichtige Gesetz der Anpassung erkannt, hatten die Erfahrung erworben, wo das Nichtwissen an der Wurzel zu fassen sei, wie kräftig die Macht des Gärtners, des Lenkers, des Führers zu wirken vermöge, und daß zumeist aller Fortschritt von ihm abhängt, und es eben darauf ankommt, die rechte Wahl zwischen gut und böse getroffen zu haben. Dies mag recht trivial klingen, ist aber wahr; so wahr wie SENECAS Bekräftigung, Mitte des 94. Briefes: Nulla res magis animis honesta induit dubiosque et in pravum inclinabiles revocat ad rectum quam bonorum virorum conversatio. Da ist die Wahl gegeben zur Verehrung der Helden, sogar nach der weltmännisch wohlerprobten Maxime DE LA ROCHEFOUCAULDS: Il y a des héros en mal comme en bien. Vergl. noch oben Anm. 959 den letzten Absatz.
1020 Die genaue Ausführung und Erklärung dieser sieben Ordensregeln ist der Gegenstand der 104. Rede der Mittleren Sammlung, 802-805. Wie dort gehört auch hier die yebhuyyasikā vor: den sativinayo. Eine Richtschnur, nach der der Mönch sein Betragen der Außenwelt und ihren zahllosen Mißhelligkeiten gegenüber sich und den anderen heilsam regeln kann, stellt SEUSE in seiner Lebensbeschreibung am Ende des 14. Kapitels aus vier gleichartigen Grundsätzen zusammen: Wenn man ihn zu der [972] Pforte ruft, so befleißige er sich dieser vier Dinge: zuerst, einen jeglichen Menschen gütig zu empfangen; sodann, sich kurz zu fassen; das dritte, Trost ihm zu lassen; das vierte, unangehangen wiedereinzukehren.
1021 Diese acht Arten von Menschen sind oft dargestellt, so in der 16. Rede S. 247; weitere Nachweise in Anmerkung 390.
1022 Siehe Mittlere Sammlung S. 883, den Eingang der 118. Rede.
1023 Wie bei schwerer Erkrankung einem mit der Lehre Wohlvertrauten zuzusprechen sei, ist im Saṃyuttakanikāyo, gegen Ende des vorletzten Buches, ausgeführt, ed. Siam. vol. V p. 392-394 (PTS 408-410). Zum verständigen Freunde, der schwerkrank darniederliegt, tritt der verständige Freund heran und fragt ihn: ›Hat der Ehrwürdige Verlangen nach Vater und Mutter?‹ Wenn er da nun etwa sagt: ›Ich habe Verlangen nach Vater und Mutter‹, so ist ihm darauf zu erwidern: ›Der Ehrwürdige ist, wie auch ich es bin, ein sterblicher Mensch. Ob nun gleich der Ehrwürdige nach Vater und Mutter Verlangen hegen oder nicht hegen mag, er muß gleichwohl sterben. Gut wär' dem Ehrwürdigen was da sein Verlangen nach Vater und Mutter ist aufzugeben.‹ Sagt er nun dann: ›Was mein Verlangen nach Vater und Mutter war, ich hab' es aufgegeben‹, so soll man ihn weiter bereden: ›Und wünscht der Ehrwürdige nach Weib und Kind noch zu sehn?‹ Antwortet er darauf: ›Ich möchte nach Weib und Kind noch sehn‹, so hätte man ihm zu sagen: ›Der Ehrwürdige ist, wie auch ich es bin, ein sterblicher Mensch. Ob nun gleich der Ehrwürdige nach Weib und Kind noch sehn oder nicht sehn mag, er muß gleichwohl sterben. Gut wär' dem Ehrwürdigen was da sein Verlangen nach Weib und Kind ist aufzugeben.‹ Kann er dann beistimmen: ›Was mein Verlangen nach Weib und Kind war, ich hab' es aufgegeben‹, so soll man ihn weiter bereden von irdischer Sehnsucht abzulassen und das Gemüt nach den höheren und köstlicheren himmlischen Wonnen zu richten, nach dem Reiche der Vier großen Könige, und so immer weiter zu den Schattengöttern, den Dreiunddreißig Göttern, den Seligen Göttern, zu den Göttern unbeschränkter Freude, den Göttern jenseit unbeschränkter Freude, bis zur brahmischen Sphäre. Sagt er nun dann: ›Von den Göttern jenseit unbeschränkter Freude hab' ich das Gemüt abgezogen, habe es der brahmischen Sphäre zugewandt‹, so soll man ihn weiter bereden: ›Auch die brahmische Sphäre ist, Ehrwürdiger, vergänglich, nicht ewig, ist persönlich verwoben. Gut wär' dem Ehrwürdigen von der brahmischen Sphäre das Gemüt abzukehren und es zur Auflösung der Person zu bringen.‹ Kann er dann sagen: ›Von der brahmischen Sphäre hab' ich das Gemüt abgewandt und habe es zur Auflösung der Person gebracht‹, so ist zwischen einem also gemüterlösten Menschen und einem Mönche, der seit hundert Jahren den Wahn versiegt hätte, keinerlei Unterschied mehr zu finden, und zwar Erlösung gegenüber Erlösung. – Von einem bestimmten Fall dieser Art weiß die 97. Rede der Mittleren Sammlung zu berichten und, ebenda in der 143., beim Tode Anāthapiṇḍikos; dann aber, tiefer und klarer als irgendwo dargestellt, in der 144., wie Channo freiwillig aus dem Leben scheidet, als einer, who wilfully seeks his own salvation, nach dem unübertrefflichen Ausdruck im Hamlet V 1, 1. Genau besehn ist eben nach indischer und überhaupt klassischer Anschauung ein solches Sterben bei vollständig naturgemäßer Auflösung der Person nichts anderes als den Wahn versiegen, den Traum wegziehn, das Fieber auskühlen lassen, ein sich heilen von der Krankheit des Lebens, »se guérir de la vie« sagt auch ROUSSEAU, Héloise III No. 21; während es nach christlichen Begriffen und Meinungen allerdings weniger eine Euthanasie als vielmehr eine Biathanasie, nur ein glückliches Totschlagen zu nennen wäre, gemäß dem Worte VOLTAIRES, der als der erste [973] große Verehrer Hamlets den Schluß des Monologs, den er Zeile um Zeile genau übersetzt, vorher sehr geistvoll so paraphrasiert:
La mort serait trop douce en ces extrémités;
Mais le scrupule parle, et nous crie: Arrêtez;
Il défend à nos mains cet heureux homicide,
Et d'un Héros guerrier fait un Chrétien timide.
Doch muß hier billigerweise hinzugefügt werden, daß der alte echte Christ, der ja vom indischen Baum der Erkenntnis herkommt, gar wohl unserer Ansicht beipflichtet, indem er mit TERTULLIAN sagt: Nichts ist uns in dieser Welt angelegen, als uns baldmöglichst aus ihr davonzumachen. Ein Ausspruch, der denn auch nach Gebühr in die Regel der strengen christlichen Ordenstifter aufgenommen wurde, immer aufs neue wieder eingeschärft wurde; so z.B. in der Konstitution der Trappisten, in die XLV. Bemerkung zum Artikel über Krankheit, Brüsseler Ausgabe von 1702 S. 91: »Malades. Cette sainte indifference pour la vie ou pour la mort, pour la maladie ou pour la santé, qu'on prescrit aux malades de la Trappe, est un sentiment qui doit estre commun à tous les Chretiens. Nous n'avons rien à faire en ce monde, que d'en sortir promptement, Nihil nostrâ refert in hoc aevo, nisi quam celeriter de eo excedere.« Oder noch kräftiger:
Il faut s'anéantir soi-même,
Et se perdre sans nul retour.
Ein Spruch, ganz indisch gedacht und gefaßt, mit dem die GUYON ihren Abandon entier beschließt, in den Cantiques spirituels tome III No. 138, Pariser Ausgabe 1790. Eben das aber ist es, wenn der Mönch, wie der Text oben lautet, das Unverwirklichte zu verwirklichen sucht, der achte Zustand der Anspannung, den Sāriputto aufzählt.
1024 Eine verwandte Stelle im Sattakanipāto des Anguttaranikāyo, übersetzt in Anm. 744.
1025 Hierzu der Mittleren Sammlung 120. und 135. Rede.
1026 Diese acht Dinge kommen im Anguttaranikāyo zur Sprache, bei Erklärung des Begriffs von Unglück. »Ist da, ihr Mönche, einer davon betroffen worden, daß ihm Verwandte weggestorben sind, oder daß er Geld und Gut eingebüßt hat, oder von Krankheit heimgesucht wurde, so erwägt und überlegt er da nicht: ›So geartet ist diese Weltgemeinschaft, so geartet die Selbstentwicklung, daß bei so gearteter Weltgemeinschaft, bei so gearteter Selbstentwicklung immer acht weltliche Dinge die Welt abwandeln, und immer die Welt acht weltliche Dinge abwandelt: Erlangen und Nichterlangen, Ruhm und Schande, Tadel und Lob, Wohl und Wehe.‹ Weil er nun den Verlust eines Verwandten erfahren, oder das Vermögen verloren hat, oder von Krankheit getroffen ist, wird er bekümmert, schwermütig, klagt, schlägt sich stöhnend die Brust, gerät in Verzweiflung.« Wer aber dabei die so geartete Weltgemeinschaft, die so geartete Selbstentwicklung erwägt und überlegt, der wird nicht mehr traurig und beklommen, klagt nicht mehr, verzweifelt nicht mehr. »Im Unglück, ihr Mönche, wird die Stärke erprobt, und sie wird es in langer Andauer, nicht flüchtighin, und von einem, der aufmerksam, nicht unaufmerksam, der gewitzigt, nicht ungewitzigt ist.« Es sind Umstände, die man nach Umständen verstehn lernt, Catukkanipāto No. 192, ed. Siam. p. 263f. (PTS fehlerhaft.) Dazu gehört dann auch Aṭṭhakanipāto No. 6: Der unerfahrene, gewöhnliche Mensch wird von Erlangen und Nichterlangen, Ruhm und Schande, Tadel und Lob, Wohl und Weh umsponnen. Das eine entzückt [974] ihn, das andere schlägt ihn nieder. Und so wird er, bald in Entzückung bald in Bedrückung geraten, nicht frei von Geburt, Alter und Tod, von Kummer, Jammer, Schmerz, Gram und Verzweiflung, er wird nicht frei vom Leiden; während der erfahrene heilige Jünger sehr wohl bedenkt, daß all dies vergänglich, leidig, wandelbar ist, und sein Gemüt nicht mehr davon umspinnen läßt, weder entzückt noch niedergeschlagen wird: Entzückung und Bedrückung hat er gänzlich überstanden und kann so vom Leiden sich ablösen. Das ist das Besondere, das ist die Bewandtnis, das ist die Verschiedenheit zwischen dem erfahrenen Jünger und dem gewöhnlichen Menschen. Vergl. noch Anm. 1055 am Ende. Ein alter Spruch, aufbewahrt im Lābhagarahajātakam, ed. FAUSBÖLL No. 287, faßt diese Gedanken so zusammen:
Pfui sag' ich, Priester, über Ruhm
Und Reichtum, über solches Gut,
Den Wandel, der uns führt herum
Auf Pfaden, wo man unrecht tut.
Nur mit dem Napf in seiner Hand
Vom Hause wer als Pilger zieht:
Der hat erwählt den bessern Stand,
Als wer sich unrecht weitermüht.
Die oben erklärten acht Dinge, um die alles in der Welt immer wieder sich dreht, hat einst ROBERT L'ORANGE sehr erfahren auf die vorher S. 572 genannten vier Arten des Anhangens zurückbezogen: von dort her kommt es in der Tat zur gegensätzlichen Scheidung. Durch das Hangen an Lust erfährt der Genußbegehrende den Wechsel von Erlangen und Nichterlangen, durch das Hangen an Ansicht geraten Weltweise, Gelehrte, Dichter usw. in Ruhm und in Schande, durch das Hangen an Tugendwerk lassen sich Pflichtgetreue, Regelbeflissene, Rechtschaffene zu jenem Stolz verleiten, der durch Lob befriedigt und durch Tadel gekränkt wird, und durch das Hangen an Selbstbehauptung wird jeder, dem es um sein Ich zu tun ist, der sich im Dasein schlechthin zu behaupten sucht, Wohl und Weh empfinden. – Diese Einteilung ist auch bei den Jainās zu finden, doch sind dort die Titel Ruhm und Schande unter Lob und Tadel mit einbezogen, so daß nur sechs Stücke aufgezählt werden, lābhālābhe suhe (so, nicht sahe) dukkhe nindāpasaṃsā, nach dem Kommentar zum Uttarādhyayanam 23 ed. CHARPENTIER, Zeitschr. d. deutsch, morgenländ. Gesellsch. 69, 335, 23f. Der klare, bestimmte Ausdruck unserer Formel war von ihnen nicht genau beobachtet, mehr und mehr verallgemeinert worden.
1027 Vergl. 16. Rede, Mitte des 3. Berichtes.
1028 Mit S asaññīsattā, ebenso in der 1. Rede S. 23. Vergl. die Anm. 33 daselbst.
1029 Mit S samatikkamma santam etaṃ paṇītam etan ti nevasaññānāsaññāyatanūpagā. Vergl. Mittlere Sammlung 793f.
1030 Mit S dīghāyukam aññataraṃ devanikāyam upapanno hoti. Zur Sache cf. Anm. 714.
1031 Besser milakkhesu (so S p. 312) zu lesen und mit S yattha.
1032 S hat im Sodhanapattam richtig paccājāto angegeben.
1033 Vergl. oben S. 41. Mittlere Sammlung 866, passim. Mit S na 'tthi yiṭṭhaṃ. Eine Widerlegung solcher fatalistischer Gewaltlehren ist, recht gelungen, im Anguttaranikāyo, Chakkanipāto No. 38, gegeben. Irgendein Priester kommt zu Gotamo heran und stellt die Behauptung auf: »Es gibt kein eigenes Tun und Lassen.« Der Meister entgegnet ihm: »Noch nie hab' ich, Priester, einen solchen Bekenner gesehn oder gehört: [975] denn wie nur könnte wohl einer, der selber herkommt und selber weggeht, etwa behaupten: ›Es gibt kein eigenes Tun und Lassen.‹ Was meinst du wohl, Priester: gibt es eine Art von Bewegung?« – »Gewiß, Herr.« – »Und wenn es eine Art von Bewegung gibt, werden die Wesen als beweglich erkannt?« -»Ja, Herr.« – »Wenn nun, Priester, bei einer Art von Bewegung die Wesen als beweglich erkannt werden, so ist das ihr Tun und ihr Lassen. Was meinst du wohl, Priester: gibt es eine Art des Sichgehnlassens und des Sichanstrengens, eine Art von Stärke, Betätigung, Wirksamkeit?« – »Freilich, Herr.« – »Wenn nun, Priester, bei solch einer Art von Wirksamkeit die Wesen als wirksam erkannt werden, so ist das ihr Tun und ihr Lassen.« Diese Erfahrung ist das auszeichnende Merkmal der Lehre aller Vollendeten, Tikanipāto No. 138 (PTS 135): »Die da einst, ihr Mönche, in vergangenen Zeiten Heilige, vollkommen Erwachte waren, auch jene Erhabenen sind ebenso Lehrer der Tat gewesen, Lehrer des Handelns, Lehrer des Kämpfens. – Und die da einst, ihr Mönche, in künftigen Zeiten Heilige, vollkommen Erwachte sein werden, auch jene Erhabenen werden ebenso Lehrer der Tat sein, Lehrer des Handelns, Lehrer des Kämpfens. – Und auch ich, ihr Mönche, bin jetzt als Heiliger, vollkommen Erwachter ein Lehrer der Tat, Lehrer des Handelns, Lehrer des Kämpfens. Auch mich aber, ihr Mönche, weist Makkhali, der eitle Mann, mit den Worten ab: ›Es gibt keine Tat, es gibt kein Handeln, es gibt kein Kämpfen.‹ Gleichwie etwa, ihr Mönche, wenn an einem Flußgefälle ein Fangnetz gelegt wird, vielen Fischen zum Unheil und Leiden, zum Verderben und Untergang: ebenso nun auch, ihr Mönche, ist Makkhali, der eitle Mann, als eine Art Fangnetz für Menschen in der Welt erschienen, vielen Wesen zum Unheil und Leiden, zum Verderben und Untergang.« Auf die hier gekennzeichnete Lehre des Makkhali Gosālo und seiner Jünger, daß nämlich alles eitel sei und der Mensch nichts vermag und nichts bei sich ändern kann, beziehn sich die Angaben Sāriputtos oben im Text. Vom Vertrauen zu Weltweisen solchen Schlages, wenn sie mit Beweisgründen verblenden, gilt eben was SCHOPENHAUER über das Denken mit Querköpfen sagt, oder mit solchen, die sich ihren Verstand verkehrt angezogen haben: es verdirbt den Kopf; hat man aber Makkhali Gosālo und Genossen auf Hirn und Herz geprüft, dann trifft wohl am nächsten das, der gotamidischen Erkenntnis verwandte, milde Lächeln des MALEBRANCHE zu: Le monde est plein de trompeurs, je dis de trompeurs de bonne foi aussi-bien que d'autres. Man darf hier also im höchsten Sinne auf Gotamo anwenden was zum Ruhme HARVEYS dessen Grabmal zu Hampstead als vom Arzt aller Ärzte bekundet:
Qui diuturnum sanguinis motuni post tot annorum
Millia primus invenit;
Orbi salutem, sibi immortalitatem
consequutus.
Qui ortum et generationem animalium solus omnium
a pseudophilosophia liberavit.
1034 Das planmäßige Üben der Ein- und Ausatmung gilt in der indischen Asketik, und insbesondere nach der von Gotamo genau gegebenen Weisung, als Anfang und Ende des Tugendpfades, wobei der Jünger, in wohlbedachter Pflege und Ausbildung, zum höchsten und letzten Ergebnis gelangt: allmählich, von Tag zu Tag, ja allemal von Stunde zu Stunde kann er dabei immer bessernde und immer besser wirkende Förderung in sich merken, in sich erfahren, bis »auch die letzten Atemzüge bewußt ausgehn, nicht unbewußt«: Mittlere Sammlung 462. In der vierten Schauung nun [976] ist dieses Ziel erreicht worden, bei Lebzeiten schon: was freilich nach gewöhnlichen Begriffen und minderer Erfahrung unmöglich scheint: was jedoch beharrliche Übung und Ausdauer vermag, ist eben gerade hier, durch das zeitweilig erreichte Aufhören der Lungen- und Herztätigkeit bei lebendigem Leibe, auch nach außen hin sicher bestätigt. Der vollkommene Asket hat daher das Ende schon im Leben erreicht und überstanden: er ist in der ohne Hangen verbliebenen Art der Erlöschung zu erlöschen gekommen, in jene ewige Stille gelangt, die eben in unserer vierten Schauung eintritt; sein Verscheiden, sein sichtbarer Tod ist nichts anderes mehr als die unmittelbar ausgeglichene vierte Schauung. Vergl. 16. Rede S. 280 u. 291. Es ist hier in unübertrefflichem Grade wirklich vollbracht was die griechische Lebensweisheit als das Absterben des Glücklichen, το ευτυχουντα αποϑανειν gepriesen, was sie als Ziel des Denkers erwünscht hat: daß er ἑτοιμοϑανατος, todesbereit werde; wie ja auch die Seherin in der Felsengruft am Strande von Cumae nur dieselbe Weisheit als ihre höchste und letzte Erfahrung kundgibt, als sie auf die Frage der Knaben: »Sibylle, was willst du?«, antwortet: »Absterben will ich«, bei PETRONIUS cap. 48. Weiter sodann ist bemerkenswert, daß SENECA in dieser Hinsicht und in diesem Zusammenhang die Pflege der geregelten Atemübungen als wirksame Vorbereitung erkannt hat: sei es nun auf Grund eigener Erfahrung, oder aber, was wohl möglich wäre, von Kennern östlicher Asketik in Rom darin belehrt. Er gibt im 78. Brief an LUCILIUS die klar entsprechende Weisung: spiritum cuius iter ac receptaculum laborat exerceas. Physiologisch besehn kommt hier ein Verhältnis zur Geltung, wo der Blutumlauf rhythmisch beschwichtigt wird, vom Zentrum nach der Peripherie immer mehr und mehr abgetönt, regelrecht ausgeglichen wird: analog dem Falle, wo (nach BICHAT, Recherches physiologiques sur la vie et la mort I 10 i.f.) das Leben zuerst im Herzen erlischt und von da aus die gänzliche Auflösung erfolgt; im Gegensatz zum Greisentod, wo erst die Organe der Peripherie allmählich verkümmern und ersterben, versiegen und versagen, und das Zentrum des Herzens zuletzt zerfällt. Da wie dort also kommt das Herz oder perpetuum mobile zum Stillstand: dort von innen nach außen freiwillig, da von außen nach innen gezwungen. Für beide Fälle, den außerordentlichen wie den gewöhnlichen, trifft rein diagnostisch die Erklärung zu, die schon DESCARTES gegeben hat als Prosektor der Leidenschaften: »denn wir sterben, wenn das Feuer, das im Herzen ist, völlig erlischt«, morimur enim cum ignis qui in corde est plane extinguitur, De passionibus, pars II articulus 122. – Wie dies alles nun aber mit der Pflege der bedachtsamen Ein- und Ausatmung und ihrem Ruhepunkt in der vierten Schauung auf das innigste verbunden ist, erhellt ungemein deutlich aus einer Ansprache Gotamos an die Jünger, wo solche Anschauung, Übung und Erfahrung gleichsam mit einem kräftigen Stempel gekennzeichnet wird, im Mahāvāravaggo des Saṃyuttakanikāyo überliefert, Ānāpānasaṃyuttam II 1, ed. Siam. vol. V p. 317/8 (PTS V 325f.); ich gebe das ganze Stück. »Zu einer Zeit weilte der Erhabene bei Icchānangalam, im Waldgehölz, in der Nähe des Ortes. Dort nun hat der Erhabene sich an die Mönche gewandt: ›Ich wünsche, ihr Mönche, drei Monate einsam zu verbringen: niemand soll mich aufsuchen, nur wer mir von den Almosenbissen bringen mag‹ – ›Wohl, o Herr‹, sagten da gehorsam jene Mönche zum Erhabenen; und es hat nunmehr niemand den Erhabenen aufgesucht außer dem einen, der von den Almosenbissen zu bringen hatte. Nachdem nun diese drei Monate verflossen waren, hat der Erhabene sich aus der Einsamkeit zurückbegeben und an die Mönche gewandt: ›Wenn euch, ihr Mönche, andersfährtige Pilger etwa fragen sollten: »Was war das, ihr Brüder, für ein Zustand, den der Asket Gotamo während der Regenzeit am meisten gepflegt hat?«, so mögt ihr Mönche [977] auf solche Frage den andersfährtigen Pilgern diese Antwort geben: »In bedachtsamer Ein- und Ausatmung einig geworden, ihr Brüder, ist der Erhabene während der Regenzeit am meisten gewesen.«‹ Da hab' ich, ihr Mönche, bedächtig eingeatmet, bedächtig ausgeatmet. Tief einatmend weiß ich ›Ich atme tief ein‹, tief ausatmend weiß ich ›Ich atme tief aus‹; kurz einatmend weiß ich ›Ich atme kurz ein‹, kurz ausatmend weiß ich ›Ich atme kurz aus‹; ›den ganzen Körper empfindend will ich einatmen‹, ›den ganzen Körper empfindend will ich ausatmen‹, so pfleg' ich der Übung; ›diese Körperverbindung besänftigend will ich einatmen‹, ›diese Körperverbindung besänftigend will ich ausatmen‹, so pfleg' ich der Übung; ›die Auflösung wahrnehmend will ich einatmen‹, ›die Auflösung wahrnehmend will ich ausatmen‹, so pfleg' ich der Übung; ›die Entfremdung wahrnehmend will ich einatmen‹, ›die Entfremdung wahrnehmend will ich ausatmen‹, so pfleg' ich der Übung. Wo man da nun, ihr Mönche, das rechte Wort anwenden mag, etwa sagen ›heilige Warte‹, oder auch ›lautere Warte‹, oder auch ›vollendete Warte‹: bei der Einigung in bedachtsamer Ein- und Ausatmung kann man wohl das rechte Wort anwenden, etwa sagen ›heilige Warte‹, oder auch ›lautere Warte‹, oder auch ›vollendete Warte‹. Die da, ihr Mönche, kämpfende Mönche sind, mit streitendem Busen die unvergleichliche Sicherheit zu erringen trachten, die werden durch Einigung in bedachtsamer Ein- und Ausatmung, wohlgeübt und gepflegt, fähig den Wahn versiegen zu lassen. Die aber da, ihr Mönche, als Mönche heilig geworden sind, Wahnversieger, Endiger, die das Werk gewirkt, die Last abgelegt, das Heil sich errungen, die Daseinsfesseln vernichtet, sich durch vollkommene Erkenntnis erlöst haben, die finden durch Einigung in bedachtsamer Ein- und Ausatmung, wohlgeübt und gepflegt, noch bei Lebzeiten eine selige Gegenwart, bei klarem Bewußtsein. Wo man da nun, ihr Mönche, das rechte Wort anwenden mag, etwa sagen ›heilige Warte‹, oder auch ›lautere Warte‹, oder auch ›vollendete Warte‹: bei der Einigung in bedachtsamer Ein- und Ausatmung kann man wohl das rechte Wort anwenden, etwa sagen ›heilige Warte‹, oder auch ›lautere Warte‹, oder auch ›vollendete Warte.‹« Die Anfänge einer solchen Diätetik reichen weit in die Zeiten der alten Upanischaden hinauf. Nähere Beziehungen und Bestätigungen von anderer Seite sind in Anm. 691 vorgelegt. Hier sei noch hinzugefügt, daß auch Asoko diese »heiligen Warten« unserer Texte wohlgekannt hat, die ariyavihārā, auch ariyavāsā, ariyavāsāni geheißen, da er sie auf seiner Inschrift am Granitfelsen von Bairāt als die vom erhabenen Meister selbst dargelegten aliyavasāni, wie es im Dialekt dort lautet, den Mönchen und Nonnen, Anhängern und Anhängerinnen nebst anderen Lehrreden zur Kenntnis und wiederholten Übung angelegentlich empfohlen hat: und nur in der Absicht, schließt er ab, hat er das Edikt einmeißeln lassen, auf daß man dieses sein Anliegen kennenlerne, abhipetaṃ me jānaṃtu. Vergl. Lieder der Mönche Anm. 166, wo noch eine Reihe weiterer dazugehöriger Nachweise der Übereinstimmung die ser königlichen Botschaft mit unseren Texten zu finden ist.
1035 Die Auflösung jeder Vorstellbarkeit ist schwer zu verwirklichen, selbst von einem so vielerfahrenen Jünger wie Ānando kaum auszudenken ohne weitere Belehrung. Darum stellt denn auch dieser an den Meister einmal die Frage, wie das wohl möglich sei. Gotamo gibt ihm die Richtschnur: »Da ist, Ānando, ein Mönch sich bewußt: ›Das ist die Ruhe, das ist das Ziel, und zwar das Aufgehn aller Unterscheidung, die Abwehr aller Anhaftung, das Versiegen des Durstes, die Wendung, Auflösung, Erlöschung.‹ Auf solche Weise, Ānando, wär' es einem Mönche möglich eine derartige Einigung zu erfahren, daß er bei der Erde nicht mehr erdbewußt, beim Wasser nicht wasserbewußt, beim Feuer nicht feuerbewußt, beim Winde nicht windbewußt [978] wäre, daß er beim unbegrenzten Gebiet des Raums, beim unbegrenzten Gebiet des Bewußtseins, im Bereich des Nichtdaseins, an der Grenzscheide möglicher Wahrnehmung dieser Gebiete sich nicht mehr bewußt würde, diesseit nicht diesseitbewußt, jenseit nicht jenseitbewußt; und was da gesehn, gehört, gedacht, erkannt, erreicht, erforscht, im Geiste untersucht wird, auch davon wär' ihm nichts mehr bewußt: und doch wäre er bewußt.« Anguttaranikāyo, Ekādasanipāto No. 7. Ist an allem die Bewußtheit entwesen, saññā vibhūtā (ib. No. 10 i.f.), so kündet von dem Dahingelangten nur mehr der Spruch aus den Bruchstücken der Reden, v. 1076:
Verglommen ist er unvergleichbar worden,
Gedeutet irgend an, ihm gilt es nimmer:
Sind alle Dinge allgemach entwurzelt,
Ist alle Macht entwurzelt auch der Worte.
1036 Näher ausgeführt, im fortlaufenden Zusammenhange, Mittlere Sammlung 826f.; oben S. 235f.; Mittlere Sammlung 795f.; 566-568; 655f, 390f., und oft. Ein alter Spruch, im Pañcatantram erhalten, bei BÖHTLINGK (2. Aufl.) No. 2002, faßt unseren Gedankengang in den Stempel:
Kṣaṇaṃ cittaṃ kṣaṇaṃ vittaṃ,
kṣaṇaṃ jīvati mānavaḥ:
Yamasya karuṇā nāsti,
dharmasya tvaritā gatiḥ.
Rasch wechselt Andacht, rasch Genuß,
Rasch wechseln, das ist Lebensmuß:
Der Tod, er kennt Erbarmen nicht,
Es hält die Satzung bald Gericht.
Eine verwandte Erkenntnis ist am Ende von LESSINGS Faustfragment vorgetragen, wo die größte Raschheit – eine Schnelligkeit, größer als die Strahlen des Lichts und die Gedanken des Menschen und nicht in endlichen Zahlen auszudrücken – bildlich als der Übergang vom Guten zum Bösen erscheint: »Ja, der ist schnell; schneller ist nichts als der! – Als der Übergang vom Guten zum Bösen! Ich habe es erfahren, wie schnell er ist! Ich habe es erfahren!« Ebendas aber auch hat oben Sāriputto im Sinne, wenn er von dem Witz und der Weisheit spricht, die Aufgang und Untergang sieht. Gotamo selbst hat es in einen wundervollen Ausspruch gefaßt, der den Inbegriff seiner Lehre zeigt; wobei die Szene LESSINGS recht wohl fährt als Kommentar zu diesem Text, Anguttaranikāyo, Ekanipāto I 5, 8, ed. Siam. p. 10: »Nicht hab' ich, ihr Mönche, auch nur ein anderes Ding kennengelernt, das sich so schnell zu wandeln vermag als wie da, ihr Mönche, der Geist: und so sehr zwar, ihr Mönche, daß man kaum ein Gleichnis geben kann, wie schnell sich der Geist zu wandeln vermag.« Für Geist, cittam, wäre Gemüt oder Herz ebenso richtig zu sagen: das indische Wort umfaßt beide.
1037 Anblick und Vorstellung nur einer bestimmten Farbe ist ein wohlerprobtes, leicht handliches Mittel zur Sammlung des Geistes, zur Säuberung von den verschiedenartig störenden Einflüssen rings umher: so auch in der 16. Rede, 259-260, und in der Mittleren Sammlung 571-573 gezeigt. Es sind sonst meist sechs Farben angegeben: schwarz und weiß, blau und gelb, rot und grün, Mittlere Sammlung 546, und S. 405 unserer 23. Rede. Oben im Text sind sie auf vier beschränkt, weil grün schon in blau enthalten ist, schwarz aber keine geeignete Anschauung vermittelt, genau genommen [979] keine Farbe ist. Denn kaṇham, kṛṣṇam, das Wort für schwarz, ist eigentlich die Bezeichnung für dunkel, finster, und dann auch für schlecht. Daher wird, nebenbei gesagt, vom Inder die schwarze Farbe möglichst gemieden, zumal bei der Kleidung. Da ist, im alltäglichen Leben und Verkehr, weiß oder hellgelb bevorzugt, als Ausdruck einer festlichen, fröhlichen Stimmung, siehe Anm. 554; doch werden bei Gelegenheit und Anlaß, feierlichen Aufzügen, Versammlungen usw. heute wie einst auch prachtvolle rote oder blaue Gewänder getragen. Die Fürsten von Vesālī z.B., die Gotamo einen Besuch abstatten, fahren mit großem Gepränge aus der Stadt weg und haben, je nach ihrem Geschmack, »blau gewählt, blaue Farben, blaue Gewänder, blaue Geschmeide«, oder ebenso gelb oder rot oder weiß, 16. Rede S. 249 u. Anm. 393. Von diesen hellgeschmückten, in die leuchtendsten Farben gekleideten Fürsten von Vesālī, die dann Gotamo mit feinem Lächeln den Dreiunddreißig Göttern vergleicht, läßt OLDENBERG unentwegbar auch in der 6. Auflage seines »Buddha«, S. 166, die Blauen wiederum in schwarzen Kleidern ihren Besuch abstatten: was zwar im Salon des Westens der Brauch ist, wodurch man sich aber in Vesālī der verabscheuten Kaste der Leichenträger zugesellt hätte. Eine derartige Absicht jener Herren ist natürlich nicht anzunehmen, übrigens durch den Bericht widerlegt; und es hätte schon genügt zu beachten, daß auch hier nīlam nur blau sein kann, wie das Wort ja schlechthin für die Indigopflanze, den Saphir, das Kupfervitriol und andere bläulich glänzende Dinge, blauen Stahl, blaue Lotusrosen usw., immer angewandt wird. Wir haben denn auch vorher, im Text oben S. 593, bei der Darstellung des bestimmten Falls der Überwindung weltlichen Begehrens und Bekümmerns durch die Sammlung und Einigung der Aufmerksamkeit im Anblick einer rein blauen Farbe, die Hanfblüte als Beispiel, als einen Gegenstand der Betrachtung gegeben; oder auch einen »Seidenstoff, auf beiden Seiten blau gefärbt, der blau schimmert, blau scheint, blau aussieht: ebenso auch sieht man, innen ohne Formwahrnehmung, einig, außen Formen, blaue, die blau schimmern, blau scheinen, blau aussehn; solche überwindend sagt man sich ›Ich weiß es, ich seh' es‹, nimmt es also wahr: das ist der fünfte Grad der Überwindung.« Auf diese Weise geht es nun weiter auch mit den übrigen Farben, und ebenso mit den Begriffen von Erde, Wasser, Feuer, Luft, Raum und Bewußtsein. Geistige Übungen der Art sind noch in der 121. und 127. Rede der Mittleren Sammlung außerordentlich schön entwickelt, wo der Mönch aus dem Gedanken ›Dorf‹ zum Gedanken ›Wald‹ aufsteigt, dann über die ›Erde‹ hinaus zur ›Unbegrenzten Raumsphäre‹ emporgelangt, und weiter zur ›Unbegrenzten Bewußtseinsphäre‹ sich erhebt und die ›Grenzscheide möglicher Wahrnehmung‹ erreichen kann, bis zur ›geistigen Einheit ohne Vorstellung‹; oder wie er einen einzelnen mächtigen Baum als ›großartig‹ auffaßt, dann eine Gruppe solcher Bäume, ferner sodann ein Wiesenfeld ›großartig‹ ansieht, und so fort eine weitere Landschaft, ein einzelnes Königreich, eine Reihe von Königreichen, bis er endlich dazugelangt, die vom Ozean umschlossene Erde als Einheit ›großartig‹ aufzufassen. – Es versteht sich, daß die Scholastik des Buddhaghoso und der Seinen an den, im Grunde genommen recht einfach verständlichen Übungen, die der platonischen Disziplin geistesverwandt am nächsten stehn, nur ein verlockendes Brachfeld für ihre Sämereien gefunden und darauf eine Pflanzschule für allerlei Unkraut eingerichtet hat; womit dann auch bei uns manche Gelehrte sich vorzüglich beschäftigen und darüber glücklich die Hauptsache vergessen, die ursprüngliche blaue Blume gar nicht mehr sehn. Sie berufen sich wohl auch gern auf den gemeinen Menschenverstand, wie KANT sagt, »dabei es der schaalste Schwätzer mit dem gründlichsten Kopfe getrost aufnehmen und es mit ihm aushalten kann ... eine Berufung [980] auf das Urtheil der Menge; ein Zuklatschen, über das der Philosoph erröthet, der populäre Witzling aber triumphirt und trotzig thut.« Oder sie belieben auch oft, in kindlicher Unkenntnis, um was es sich eigentlich handelt, mit Schlagworten von Ohnmacht und Irrsinn um sich zu werfen; oder wenn sie ein lächerlicher Dilettantismus kitzelt und weiter treibt, so bemänteln sie sich selbstgefällig mit aufgeklaubten und angelesenen Flicken und Lappen aus den Kapiteln über Hypnose und Halluzination, Ekstase und Epilepsie, Katalepsie und Lipothymie, während andere vorsichtiger sind, pfiffige Hudler, Schlaumeier, und nur ein paar abgegriffene und ausgefranste Laiengedanken und -urteile über »pathologische Zustände visionären und ekstatischen Charakters, geistige Überreizung, todesähnliche Erstarrung, offenbar von kataleptischer Natur«, nach Müller und Schulze, mit einflechten zu müssen glauben, um nur ja dem gebildeten Publikum hübsch verständlich zu bleiben und seiner Pöbelmeinung sich anzubiedern, wie leider auch OLDENBERG, »Buddha«, 6. Aufl. S. 361-365, der sonst so hochverdiente Forscher. Man hätte sich erst einmal darüber zu besinnen, ob Gotamos Asketik etwa gleichwertig sei mit Fakirtum und Narretei, ob sie der Imbezillität und Muskelstarre zuleitet, oder ob sie vielleicht die stärkste Verwirklichung der Menschenkraft ermöglicht.
1038 Aus einer Rede im Anguttaranikāyo IV No. 38, ed. Siam. p. 53f., übernommen: »Wie aber, ihr Mönche«, fragt dort Gotamo, »hat ein Mönch die einzeln gültigen Wahrheiten abgeschüttelt?«, und gibt die Antwort: »Da hat, ihr Mönche, ein Mönch was da der gewöhnlichen Asketen und Priester gewöhnliche, einzeln gültige Wahrheiten sind, als wie etwa: ›Ewig ist die Welt‹ oder ›Zeitlich ist die Welt‹, ›Endlich ist die Welt‹ oder ›Unendlich ist die Welt‹, ›Leben und Leib ist ein und dasselbe‹ oder ›Anders ist das Leben und anders der Leib‹, ›Es besteht ein Vollendeter jenseit des Todes‹ oder ›Nicht besteht ein Vollendeter jenseit des Todes‹, ›Es besteht und besteht nicht ein Vollendeter jenseit des Todes‹ oder ›Weder besteht noch auch besteht nicht ein Vollendeter jenseit des Todes‹: alle diese Ansichten hat er abgeschüttelt, abgeworfen, abgestoßen, von sich getan, sich ihrer entledigt, sich ihrer entäußert, sich davon befreit. Also, ihr Mönche, hat der Mönch die einzeln gültigen Wahrheiten abgeschüttelt.« Die weiteren Ausführungen dieser Rede gibt Sāriputto oben wörtlich genau mit noch anderen wieder, bis auf den letzten Abschnitt: dieser ist dort unter den Begriff paṭilīno an Stelle von suvimuttapañño gebracht, »abwendig«, statt »in Weisheit wohlabgelöst« sein. Der Inhalt ist derselbe, die Fassung ist aber im Anguttaranikāyo hierbei so knapp wie möglich gehalten. Der Absatz lautet: »Wie aber, ihr Mönche, ist ein Mönch abwendig? Da hat, ihr Mönche, ein Mönch den Dünkel der Ichheit überstanden, an der Wurzel abgeschnitten, einem Palmstumpf gleichgemacht, so daß er nicht mehr keimen, nicht mehr sich entwickeln kann. Also, ihr Mönche, ist der Mönch abwendig. Ein Mönch, ihr Mönche, der die einzeln gültigen Wahrheiten abgeschüttelt, das Verlangen nach Ausroden und Anbauen beglichen, die körperliche Unterscheidung beschwichtigt hat, der wird ›abwendig‹ genannt.« Bei sonst vollkommener Gleichheit ist also ein kürzeres Merkwort gebraucht, paṭilīno. Es ist selten, kommt so nur ein oder das andere Mal noch vor im Anguttaranikāyo IX No. 42 = Saṃyuttakanikāyo ed. Siam. vol. I p. 64 (PTS 48), mit dem Ausdruck paṭilīnanisabho muni, »der abwendige ungesellte Denker«, und Suttanipāto v. 810, 852; außerdem ist das Verbum paṭilīyati noch ein paar Mal zu finden, cittam paṭilīyati, »das Gemüt wird abwendig«, Anguttaranikāyo VII No. 46, und pāṇinā paṭileṇissāmi, »ich werde mit der Hand abwehren«, Saṃyuttakanikāyo ed. Siam. vol. II p. 235 (PTS 265). Aus der ruti ist paṭilīno im ānkhāyanagṛhyasūtram zu belegen, wo es III 1, 12 heißt pratilīna āsīta, »er [981] soll abwendig sitzen«. Es ist demnach dieser seltene Ausdruck und Begriff besser zu unterscheiden von dem sehr oft gebrauchten paṭisallīṇo, paṭisallāṇam, von paṭisaṃlīyati (cf. Anm. 612), »zurückgezogen, Zurückgezogenheit«, und ihm nicht gleichzustellen, wie OLDENBERG meint, Sacred Books of the East vol. XXIX p. 92, 12n. Denn das eine Mal handelt es sich um eine tägliche Übung und Gepflogenheit des Mönchs, die Stunden der Zurückgezogenheit; während das andere den zuhöchst verwirklichten Fall von Abwendung darstellt. Die Haṭhayogapradīpikā IV 34 hat darüber den Spruch, mit dem auch Nārāyaṇas die Brahmavidyopaniṣat zu Ende führt:
Layo laya iti prāhuḥ,
kīdṛ aṃ layalakṣaṇam?
apunarvāsanotthānāl
layo, viṣayavismṛtiḥ.
›Die Wendung, Wendung‹, sagt man wohl,
Was ist der Wendung Wahrbegriff?
Wo da kein Eindruck mehr verbleibt
Ist Wendung, Weltvergessenheit.
Und vom yogī, der zur letzten Meisterschaft gediehn ist, heißt es: Tadā vivekanimnaṃ kaivalyaprāgbhāraṃ cittaṃ, Da hat abseit geneigt Vollendung sich erkoren das Gemüt, Yogasūtram IV 25.
Auf das oben im Text voranstehende Merkwort »einsam beschirmt«, ekārakkho, darf das schöne Gespräch über den ekavihārī, den einsam Weilenden, bezogen werden, Saṃyuttakanikāyo ed. Siam. vol. II p. 251 (PTS 282). Bei Rājagaham hielt sich einst einer der älteren Mönche auf: der lebte einsam und pries das einsame Leben. Er ging allein nach dem Dorf um Almosenbrocken, allein kehrte er zurück, allein pflegte er verborgen zu sitzen, allein auf- und abzuwandeln. Über diesen wird dem Meister berichtet. Der läßt ihn zu sich berufen und fragt ihn, ob er wirklich ein so einsames Leben führe. Auf die bejahende Antwort erwidert nun Gotamo: »Es ist das, Würdiger, ein einsames Leben, ich sage nicht, daß es das nicht sei. Wie aber, Würdiger, das einsame Leben weiterhin vollständig wird, das höre und merke wohl, ich werd' es dir sagen. Da hat man, Würdiger, was vergangen ist aufgegeben, was künftig wird abgestoßen, und bei den gegenwärtigen Beziehungen auf den eigenen Zustand den Willensreiz beharrlich vertrieben. So aber, Würdiger, ist das einsame Leben weiterhin vollständig geworden.
Allüberwinder, Allerkenner, kundig,
Von allen Dingen ewig abgeschieden,
Verlassend alles, durstversiegt entwesen:
Er, sag' ich, ist es, der da lebt alleinsam.«
1040 Der vor Gotamo nicht gekannte Ausdruck von den heiligen Zuständen, ariyavāsā, ist inschriftlich durch Asoko bestätigt, auf dem 2. Bairāter Edikt Zeile 5; siehe die vorangehende Anm. 1034 gegen Ende. – Meister ECKHART hat aus einer gleichen Erfahrung gesprochen über die »lautere Stillniß, die stille Ewigkeit, die Tiefe der Stillheit, die heimliche Stillheit der Einigkeit, die stete Stillheit«, ed. PFEIFFER p. 120, 375, 517, 520, 600.
Wie der Jünger noch über die letzten, feinsten, zähesten Fesseln des Geistes hinwegkommen muß, zeigt ein Gespräch zwischen Sāriputto und Anuruddho, im Anguttaranikāyo, [982] Tikanipāto No. 131 (PTS 128), ed. Siam. p. 368. Eines Tages begab sich der ehrwürdige Anuruddho dorthin wo der ehrwürdige Sāriputto weilte, tauschte höflichen Gruß und freundliche, denkwürdige Worte mit ihm, setzte sich beiseite nieder und sprach dann also: »Ich kann da, Bruder Sāriputto, mit dem himmlischen Auge, dem geläuterten, über menschliche Grenzen hinausreichenden, tausend Welten überblicken. Auch habe ich mir Kraft erworben, unbeugsame, gewärtig die Einsicht, unverrückbar, beschwichtigt ist der Körper, unregsam, gesammelt das Gemüt, einig geworden. Aber trotzdem wird mein Gemüt nicht ohne Anhangen vom Wahne frei.« Sāri putto antwortet darauf: »Wenn es dir, Bruder Anuruddho, so ergeht: ›Ich kann mit dem himmlischen Auge, dem geläuterten, über menschliche Grenzen hinausreichenden, tausend Welten überblicken‹, so ist Dünkel dabei. Wenn du ferner, Bruder Anuruddho, bekennst: ›Auch habe ich mir Kraft erworben, unbeugsame, gewärtig die Einsicht, unverrückbar, beschwichtigt ist der Körper, unregsam, gesammelt das Gemüt, einig geworden‹, so ist Stolz dabei. Und wenn du dann, Bruder Anuruddho, bemerkt hast: ›Aber trotzdem wird mein Gemüt nicht ohne Anhangen vom Wahne frei‹, so ist Unmut dabei. Gut wär' es denn, wenn der ehrwürdige Anuruddho von diesen drei Dingen lassen, dieser drei Dinge vergessen möchte, um das Gemüt unsterblicher Artung nahezubringen.« Da hat nun der ehrwürdige Anuruddho im Verlaufe der Zeit von jenen drei Dingen gelassen, jener drei Dinge vergessen und das Gemüt unsterblicher Artung nahegebracht. Auch einer war dann alsbald der ehrwürdige Anuruddho der Heiligen geworden. – Dem geschichtlichen Beobachter sei zu einiger Beachtung empfohlen, daß über dieses letzte Ziel des indischen Mönchs bei uns im Abendlande schon vor dritthalb Jahrhunderten berichtet wurde: kurz, aber erheblich besser als in allen mir bekannten neueren Darstellungen des Gegenstandes. Es ist der Père LE GOBIEN von der Mission in China gewesen, der über die Bramenes, wie er die indischen Asketen im allgemeinen nennt, so vortrefflich gesprochen hat, daß seine Angaben dem soeben mitgeteilten Text aus dem Anguttaranikāyo vollkommen gemäß bestehn. Er sagt: »Les Bramenes asseurent que le Monde n'est qu'une illusion, un songe, un prestige; et que les corps, pour exister véritablement, doivent cesser d'estre en eux-mesmes, et se confondre avec le néant, qui par sa simplicité fait la perfection de tous les Estres ... Leur Morale est encore plus outrée que celle de nos Stoïciens. Car il poussent si loin l'apathie ou l'indifférence, à laquelle ils rapportent toute la sainteté, qu'il faut devenir pierre ou statue, pour en acquérir la perfection. Non seulement ils enseignent que le Sage ne doit avoir aucune passion; mais qu'il ne lui est pas permis d'avoir mesme aucun desir. De sorte qu'il doit continuellement s'appliquer à ne vouloir rien, à ne penser à rien, à ne sentir rien, et à bannir si loin de son esprit toute idée de vertu et de sainteté, qu'il n'y ait rien, en lui de contraire à la perfaite quiétude de l'ame. C'est, disent-ils, ce profond assoupissement de l'esprit, ce repos de toutes les puissances, cette continuelle suspension des sens, qui fait le bonheur de l'homme: en cet estat, il n'est plus sujet au changement, il n'y a plus pour lui de transmigration, plus de vicissitude, plus de crainte pour l'advenir, parce qu'à proprement parler, il n'est rien, ou si l'on veut qu'il soit encore quelque chose, il est sage, parfait, heureux, et pour dire en un mot, il est Dieu, et parfaitement semblable au Dieu Fo: ce qui asseurément approche un peu de la folie. C'est contre cette ridicule doctrine, que les Philosophes Chinois déploient toute la force de leur éloquence. Ils regardent l'indifférence parfaite comme un monstre dans la Morale, et comme le renversement de la société civile.« BAYLE, Dictionaire historique s.v. Brachmanes fol. 653n. K. Natürlich hat man auch bei uns wie in China die Schlußfolgerung des Missionars [983] als die Hauptsache angesehn: während der Bericht selbst, in seiner durchaus zutreffenden und bewundernswert klaren Fassung, die den Ernst jenes Forschers im schönsten Lichte zeigt, kaum beachtet wurde.
1041 Ist der Abschluß des berühmten Gleichnisses vom Rennpferd, am Ende der 65. Rede der Mittleren Sammlung, S. 481: unermüdliche Zucht und Erziehung, immer wiederholte Übung nur kann den Mönch wie das edle Roß zur untrüglichen Tauglichkeit bringen. Dasselbe Gleichnis hat Meister ECKHART angewandt, in der Nachlese bei JOSTES p. 102: »Denn ihm geschieht wie den wilden Rossen: so man die zu dem ersten reiten soll, so sind sie gar zaghaft und scheuen alle kleinen Dinge«, usw. Aber allmählich wird der Mensch »bereit zu aller Arbeit, und daß ihm nichts zu groß ist zu leiden und zu tun.« Mit dem Bild in Gedanken hatte Sankt BERNHARD gesagt: Voluntas facit usum, usus exercitium, exercitium vires in omni labore subministrat: De exercitio, Opp. Par. 1621 fol. 2146. Ebenso hat, um die tausend Qualen des Lebens zu beschwichtigen, CRISTÓBAL DE CASTILLEJO seine Consolatoria estando con mil males mit dem prachtvollen Spruch beschlossen:
No faltes, esfuerzo;
Que males y afan
Su fin se ternán.
Sei, Kraft, mir unbeugsam;
Daß Leiden und Weh
Am Ende vergeh'.
1042 uṭṭhahitvā mit S zu lesen, wie zu Ausgang der 53. Rede der Mittleren Sammlung.
1043 Mittlere Sammlung, Ende der 149. Rede, 1075, besprochen.
1044 »Unermüdlichkeit ist das eine Ding, das, geübt und gepflegt, ein doppeltes Gedeihen umspannend aufzieht: was schon hienieden, sichtbar gedeiht und auch was darüber hinausgedeiht«, Anguttaranikāyo VI No. 53.
1045 Mittlere Sammlung 897 und 956.
1046 Vergl. die 117. Rede der Mittleren Sammlung, 877-880.
1047 Mittlere Sammlung S. 914; vergl. ebenda das Register I s.v. Ichheit. Im Anguttaranikāyo IV No. 199, ed. Siam. p. 298 (PTS fehlerhaft) wird gesagt: »Wenn es, ihr Mönche, ein ›ich bin‹ gibt, gibt es ein ›das bin ich‹, ein ›so bin ich‹, ein ›anders bin ich‹, ein ›wesend bin ich‹, ein ›denkend bin ich‹; gibt es ein ›seiend‹, ein ›das seiend‹, ein ›so seiend‹, ein ›anders seiend‹, ein ›vielleicht seiend‹, ein ›vielleicht das seiend‹, ein ›vielleicht so seiend‹, ein ›vielleicht anders seiend‹; gibt es ein ›sein werden‹, ein ›das sein werden‹, ein ›so sein werden‹, ein ›anders sein werden‹. Es sind achtzehn Arten, wie der Durst umherschweift und nach innen angehangen bleibt. – Das ist, ihr Mönche, der Durst, der wie ein Netzwerk sich hinstreckt, verbreitet, ausgreift, worin diese Welt aufgerieben wird, eingehaspelt ist, als Garn verflochten, als Knäul vernestelt, Bast und Bindfaden geworden, und kann nicht dem Abweg, der üblen Fährte, dem Verderben, der Wandelwelt entkommen.« Hierzu noch oben S. 218u. Anm. 341. Dieselbe Antinomie haben die Jainās mit der wohlbekannten Frage übernommen, am Anfang des Āyāraṃgasuttam usw.: ke aham āsī, ke vā io cue peccā bhavvissāmi, »was bin ich, und was werde ich, von hier abgeschieden, nach dem Tode werden?« Wie aber überhaupt die Vorstellung einer Ichheit zustande kommt, ist im Saṃyuttakanikāyo III 41 (PTS 46) derart gezeigt, daß ein unerfahrener, gewöhnlicher [984] Mensch Form oder Gefühl, Wahrnehmung oder Unterscheidung oder Bewußtsein als sich selbst betrachtet, oder sich selbst als diesen ähnlich, oder in sich selbst diese, oder in diesen sich selbst: »auf solche Weise aber ist er eben da zu dieser Vorstellung von ›Ich bin‹ gekommen. Ist man aber erst, ihr Mönche, zur Vorstellung des ›Ich bin‹ gekommen, dann ist auch schon der Eintritt der fünf Sinne erfolgt, Gesicht, Gehör, Geruch, Geschmack, Getast. Es gibt, ihr Mönche, ein Denken, es gibt Dinge, es gibt eine Art Unwissen (atthi avijjādhātu S etc.). Wird nun, ihr Mönche, ein unerfahrener, gewöhnlicher Mensch von einer Empfindung getroffen, die aus Berührung mit Unwissen entsteht, so kommt ihm wohl etwa vor ›Ich bin‹, oder kommt ihm auch vor ›Das bin ich‹, oder kommt ihm auch vor ›Ich werde sein‹, oder ›Ich werde nicht sein‹, oder auch etwa ›Formhaft werde ich sein‹, oder ›Unformhaft werde ich sein‹, oder kommt ihm auch vor ›Bewußt werde ich sein‹, oder ›Unbewußt werde ich sein‹, oder ›Weder bewußt noch unbewußt werde ich sein.‹ Nun bestehn zwar, ihr Mönche, da wohl die fünf Sinne: aber dabei geht dem erfahrenen, heiligen Jünger das Unwissen unter, das Wissen geht auf. Weil ihm da der Reiz des Unwissens geschwunden und das Wissen aufgegangen ist, kommt ihm nun nicht mehr vor ›Ich bin‹, kommt ihm auch nicht mehr vor ›Das bin ich‹, es kommt ihm nichts mehr vor von ›Ich werde sein‹ oder ›Ich werde nicht sein‹, von ›Formhaft werde ich sein‹ oder ›Unformhaft werde ich sein‹, von ›Bewußt oder unbewußt oder weder bewußt noch unbewußt werde ich sein‹.« So wird der Dünkel der Ichheit aufgehoben, wie oben Sāriputto, im Hinblick auf solche Erfahrung, bezeugt. Die Persönlichkeit ist zerstoben,
Par levibus ventis volucrique simillima somno:
Gleichwie ein zarter Hauch, so ganz ähnlich dem flüchtigen Traume.
1048 Mittlere Sammlung S. 11-15.
1049 Bruchstücke der Reden v. 747f. nebst den Anmerkungen.
1050 So das Ende der 128. Rede der Mittleren Sammlung S. 956. – Unveränderliche Dinge: das sind Dinge, die nicht anders werden können, anders nicht möglich sind, die nicht anders als so und nur so sind; unveränderlich als unabänderlich: das bedeutet anaññathā. Vergl. Saṃyuttakanikāyo vol. V p. 430f.: »Diese vier, ihr Mönche, sind wirklich, nicht unwirklich, sind unveränderlich: und zwar welche vier? ›Das ist das Leiden‹: das ist wirklich, ihr Mönche, das ist nicht unwirklich, das ist unveränderlich; ›Das ist die Leidensentwicklung‹, ›Das ist die Leidensauflösung‹, ›Das ist der Pfad zur Leidensauflösung‹: das sind, ihr Mönche, die vier, die wirklich sind, nicht unwirklich, die unveränderlich sind.« Bemerkenswert ist der gleiche sprachliche Ausdruck bei GONGORA »sin mudanza«, als er eine seiner schönsten Romanzen so anstimmt:
¡Oh cuán bien que acusa Alcino,
Orfeo de Guadiana,
Unos bienes sin firmeza
Y unos males sin mudanza!
Über ein buddhistisches Diptychon, das dort noch in der letzten Strophe zu finden ist, habe ich im Wahrheitpfad Anm. zu v. 342f. gesprochen. HERDERS Wiedergabe in den Stimmen der Völker Buch II Νο. 28 ist unzulänglich. Die unveränderliche Veränderlichkeit als das unabänderliche Weltwesen hat Prospero im Sturm großartig gezeigt, an der oft genannten Stelle IV 1, 127-133: Die wolkengekrönten Türme, die [985] herrlichen Paläste, die feierlichen Tempel, der große Erdball selbst, ja alles was daran Erbe hat, wird zerfallen und, wie dies wesenlose Schauwerk ist entschwunden, zurück nicht lassen auch nur eine Spur. Wir sind von solchem Stoff wie Träume sind bestanden, und unser karges Leben ist rings in Schlaf getaucht. – Ein halbes Jahrhundert später hat ein anderer Prospero, der weltweise Indienfahrer des Seicento, seine innere und äußere Lebenskunde und Lebenserfahrung als eigenen Nachsatz hierzu ausgesprochen: Soleva dire de' costumi degli uomini, che i vizi e le virtù erano in ogni luogo; e che i beni e i mali per tutto si trovavano seminati; non avere conosciuta cosa migliore e peggiore dell' uomo; potentissimi essere l'opinione e l'uso; ciascuno professare di sapere, comune essere l'ignoranza; moltissime essere le disgrazie, poche le prosperità: quelle star sempre apparecchiate, queste succedere a noi raramente ... Diceva in fine, che tra tante cose vedute una sola gli restava da vedere, che aveva cercato invano, in tanti viaggi di tanti anni, in tanti luoghi, nell'umile, nell'alta, e nella regia fortuna; e questa era, di non aver mai rincontrato un uomo iritieramente felice; benchè al contrario moltissimi, e senza numero, ne avesse trovati infelicissimi: Vita di PIETRO DELLA VALLE il pellegrino, von BELLORI, Rom 1662, gegen Ende. SEUSE aber sagt im Büchlein der Ewigen Weisheit, am Schluß des zehnten Abschnitts: was die Welt bietet, »das verheißt viel und leistet wenig, es ist kurz, unstet und wandelbar; heut Liebes viel, morgen Leides ein Herze voll: sieh', das ist der Zeiten Spiel.« Es mutet an wie ein Rezitativ zum Arioso in den Bruchstücken der Reden v. 588:
Denn je mehr sie mehr vermeinen,
Immer wandelbarer wird es,
Und ist alsobald entschwunden:
Sieh', das heißt man Weltenwandel.
1051 Hierzu 15. Rede S. 224 und Anm. 349. Der Begriff ist die Person, das Bild ihre Erscheinung: diese ist ihre Form, jener ihr Name. Wundervoll ist die ähnliche, sehr alte Anschauung bei den Griechen, da Achill des Patroklos ψυχη και ειδολον unterscheidet, wer er war und wie er war, Ilias 23 104.
1052 Vergl. S. 40 und die Meisterrede im Upāyavaggo, dem zweiten Khandhavāravaggo des Saṃyuttakanikāyo, ed. Siam. vol. III p. 62-64. Da Sāriputtos Hinweis oben gerade auf sie und ähnliche wohlbekannte Ausführungen Bezug nimmt, sei das kurze Stück hier zum Verständnis gleich angeschlossen. »Das hab' ich gehört. Zu einer Zeit weilte der Erhabene bei Vesālī, am Großen Walde, in der Halle der Einsiedelei. Da ist denn Mahāli der Licchavier zum Erhabenen herangekommen, hat den Erhabenen ehrerbietig begrüßt, freundliche, denkwürdige Worte gewechselt und beiseite Platz genommen. Beiseite sitzend hat dann Mahāli der Licchavier zum Erhabenen also gesprochen: ›Pūrano, o Herr, der Kassapide, verkündet dies: »Es gibt keinen Anlaß, es gibt keinen Grund der Verderbnis der Wesen: ohne Anlaß, ohne Grund werden die Wesen verderbt; es gibt keinen Anlaß, es gibt keinen Grund der Läuterung der Wesen: ohne Anlaß, ohne Grund werden die Wesen lauter.« Was sagt nun der Erhabene dazu?‹ – ›Es gibt, Mahāli, einen Anlaß, es gibt einen Grund der Verderbnis der Wesen: aus einem Anlaß, aus einem Grunde werden die Wesen verderbt; es gibt, Mahāli, einen Anlaß, es gibt einen Grund der Läuterung der Wesen: aus einem Anlaß, aus einem Grunde werden die Wesen lauter.‹ – ›Was ist das aber, o Herr, für ein Anlaß, was für ein Grund, daß die Wesen verderbt werden, wie werden die Wesen aus einem Anlaß, aus einem Grunde verderbt?‹ – ›Wäre wohl etwa, Mahāli, die Form einzig leidvoll bestanden, nur mit Leiden versetzt, Leiden verquickt, unverquickt mit [986] Freude, so würden sich da die Wesen an der Form nicht ergetzen: weil nun aber, Mahāli, die Form zur Freude gereicht, mit Freuden versetzt, mit Freuden verquickt, nicht nur mit Leid verquickt ist, darum ergetzen sich die Wesen an der Form, schließen sich ergetzt an sie an, und angeschlossen werden sie verderbt; das aber ist, Mahāli, ein Anlaß, das ist ein Grund, daß die Wesen verderbt werden: und somit werden die Wesen aus einem Anlaß, aus einem Grunde verderbt. Wäre wohl etwa, Mahāli, das Gefühl, die Wahrnehmung, die Unterscheidung, das Bewußtsein einzig leidvoll bestanden, nur mit Leiden versetzt, Leiden verquickt, unverquickt mit Freude, so würden sich da die Wesen am Gefühl, an der Wahrnehmung, an der Unterscheidung, am Bewußtsein nicht ergetzen: weil nun aber, Mahāli, das Gefühl, die Wahrnehmung, die Unterscheidung, das Bewußtsein zur Freude gereicht, mit Freuden versetzt, mit Freuden verquickt, nicht nur mit Leid verquickt ist, darum ergetzen sich die Wesen am Gefühl, an der Wahrnehmung, an der Unterscheidung, am Bewußtsein, schließen sich ergetzt an dies an, und angeschlossen werden sie verderbt; das aber ist, Mahāli, ein Anlaß, das ist ein Grund, daß die Wesen verderbt werden: und somit werden die Wesen aus einem Anlaß, aus einem Grunde verderbt.‹ – ›Was ist es aber, o Herr, für ein Anlaß, was für ein Grund, daß die Wesen lauter werden, wie werden die Wesen aus einem Anlaß, aus einem Grunde lauter?‹ – ›Wäre wohl etwa, Mahāli, die Form einzig freudvoll bestanden, nur mit Freuden versetzt, Freuden verquickt, unverquickt mit Leid, so würden sich da die Wesen an der Form nicht verdrießen: weil nun aber, Mahāli, die Form zum Leide gereicht, mit Leiden versetzt, Leiden verquickt, nicht nur mit Freude verquickt ist, darum verdrießen sich die Wesen an der Form, wenden sich verdrossen von ihr ab, und abgewandt werden sie lauter; das aber ist, Mahāli, ein Anlaß, das ist ein Grund, daß die Wesen lauter werden: und somit werden die Wesen aus einem Anlaß, aus einem Grunde lauter. Wäre wohl etwa, Mahāli, das Gefühl, die Wahrnehmung, die Unterscheidung, das Bewußtsein einzig freudvoll bestanden, nur mit Freuden versetzt, Freuden verquickt, unverquickt mit Leid, so würden sich da die Wesen am Gefühl, an der Wahrnehmung, an der Unterscheidung, am Bewußtsein nicht verdrießen: weil nun aber, Mahāli, das Gefühl, die Wahrnehmung, die Unterscheidung, das Bewußtsein zum Leide gereicht, mit Leiden versetzt, Leiden verquickt, nicht nur mit Freude verquickt ist, darum verdrießen sich die Wesen am Gefühl, an der Wahrnehmung, an der Unterscheidung, am Bewußtsein, wenden sich verdrossen davon ab, und abgewandt werden sie lauter; das aber ist, Mahāli, ein Anlaß, das ist ein Grund, daß die Wesen lauter werden: und somit werden die Wesen aus einem Anlaß, aus einem Grunde lauter.‹« Der Anlaß, der Grund hierzu ist aber auch in dem kantischen Worte gelegen: »der Zweck der Existenz der Natur selbst muß über die Natur hinausgesucht werden«; wozu dann der große Mann, bei all seiner kategorischen Liebe zur Menschheit, noch den höchst bedenklichen Satz anfügt: »und man sieht nicht, warum es denn nötig sei, daß Menschen existieren«: Kritik der teleologischen Urteilskraft I § 672. Absatz. Damit hatte er aber, durchaus im oben befundenen Sinne, zugleich die ganze Philosophie Hamlets bestätigt, in dessen Nußschale: »And yet, to me, what is this quintessence of dust? man delights not me; no, nor woman neither.« Auch kann man hier den alten Abgesang anschließen:
Toll, toll the bell!
Greatness is o'er,
The heart has broke,
To ache no more;
[987] An unsubstantial pageant all –
Drop o'er the scene the funeral pall.
Der Spruch scheint aus dem Zeitalter SHAKESPEARES zu stammen; SCOTT nennt ihn »Old Poem«, zu Eingang des 33. Kapitels der Anne of Geierstein: die vorletzte Zeile weist aber sicher auf Tempest IV 1, 130 hin.
1053 dve ñāṇāni: khaye etc. mit S.
1054 Mittlere Sammlung 1075 und 1082f. im Zusammenhang ausgeführt.
1055 Die Verzweigung und Mannigfaltigkeit dieser drei Hauptarten von Gefühl ist in der 59. Rede der Mittleren Sammlung besprochen, 429-433. Im Saṃ yuttakanikāyo ist dazu eine Veranschaulichung gegeben. »Gleichwie etwa, ihr Mönche, im Raume gar mancherlei Winde wehen; von Osten her wehen da Winde und von Westen her, von Norden her wehen da Winde, und von Süden her, staubige Winde und staublose Winde, kühle Winde und heiße Winde, sanfte Winde und heftige Winde: ebenso nun auch, ihr Mönche, kommen an diesem Körper gar mancherlei Gefühle hervor; es kommen da Wohlgefühle hervor und wiederum Wehgefühle, und es kommen Gefühle hervor ohne Weh und Wohl.« Auch wird der Körper einer Herberge verglichen, in der die Gefühle Aufenthalt nehmen wie Reisende aus aller Herren Länder, Fürsten und Priester, Bürger und Bauern, von gemeiner und auch von ungemeiner Art, als Wohlgefühl, Wehgefühl oder weder Wohl- noch Wehgefühl: ed. Siam. vol. IV p. 169-171 (PTS 218f.). Oder es wird gesagt: Wie der Töpfer einen glühenden Krug aus dem Brennofen nimmt und auf den Erdboden stellt, so daß nun die Hitze hier eben nach und nach sich verziehn kann, bis nur mehr das Tongut übrigbleibt: so läßt auch der Mönch bei sich alle noch so schmerzhaften Empfindungen hienieden schon auskühlen, so daß am Ende des Lebens nur mehr das Leichengut übrigbleibt, ib. II 77f. (83). Solch ein Vollendeter, der sich aller Einflüsse entäußert hat, der die Feuchtigkeit und die Düfte des Lehms aus dem irdenen Kruge verdampft hat, leergebrannt ist, innen und außen verglast, ist schon in der Ṛksaṃhitā X 136, 3 angedeutet, mit den Worten der entrückten Wanderer: »Die Leiber nur an unserstatt, ihr Erdensöhne, seht ihr da«, cf. Anm. 47; und im Kanon des brahmischen Wandels wird der Dahingelangte, einig mit der vedischen wie gotamidischen Satzung, dehamātrāva iṣṭaḥ genannt, »einer, von dem nur mehr der Körper übriggeblieben«, yaḥ so 'vadhūtaḥ sa kṛtakṛtyo bhavati, »wer so ausgeräumt hat, hat getan was zu tun war«, am Ende der Turīyātītāvadhūtopaniṣat, Bombayer Ausgabe p. 633 ab. Man könnte daher auch wohl sagen, er sei einer, der mit dem prometheischen Feuer den Lehmkloß in Asche verwandelt hat; oder auch, der sich selbst verbrannt hat wie der Phönix, freilich für immer, ohne Wandel, ohne Verjüngung, ohne Wiederkehr. GOETHE hat bewundernd eine persische Variante aus dem NISĀMĪ kennengelernt und in den »Noten und Abhandlungen zu besserem Verständnis des West-östlichen Divans« No. 22 besprochen: das rechte Wort brennt so tief in das Herz des Menschen, daß er einer durchglühten Muschel ähnlich wird. GOETHE nennt das ein vortreffliches Gleichnis und behandelt es recht ausführlich um es noch weiter »anschaulich zu machen«. Er beschreibt sie als Muscheln, diese Wesen, die »lebendig im Meere sich nährend und wachsend, noch kurz vorher der allgemeinen Lust des Daseins nach ihrer Weise genossen und jetzt nicht etwa verbrennen, sondern, durchgeglüht, ihre völlige Gestalt behalten, wenn gleich alles Lebendige aus ihnen weggetrieben ist.« Wenn sie aber nun, zur Kalkbereitung verwendet, von der erregten Flamme durchgeglüht werden und dem Auge des Beschauers bei Nacht wirklich glühend erscheinen, »so läßt sich kein herrlicheres Bild einer tiefen, heimlichen [988] Seelenqual vor Augen stellen«. Diese läuternde Glut ist dieselbe beim Muschelrest wie beim Tongut oben. Wer eine solche Läuterung erfahren, ist nicht mehr am Leben, no más con vida, wie beide Sprachen je besonders weise für lebendig sagen: d.h. er ist nicht mehr mit Teilhaber an den Bedingungen, die den Zustand der Lebenserscheinung hervorbringen. Das Gleichnis vom ausgeglühten Kruge ist späterhin in das Sāṃkhyam übergegangen, aber auf andere Weise behandelt worden, Sāṃkhyakārikā 67, Sāṃkhyapravacanabhāṣyam III 80: kulālacakramadhyastho vicchinno 'pi bhramed ghaṭaḥ, »noch dreht sich auf dem Töpferrad, schon abgelöst, der Krug herum.« Auf dieser jüngeren Nebenlinie des Sāṃkhyam ist die Parabel in Indien allgemein bekannt und berühmt geworden, und in neuerer Zeit auch bei uns, seitdem sie SCHOPENHAUER, nach COLEBROOKE, angesichts der damals eben erst erschlossenen Mittel verhältnismäßig recht gut, ja bewundernswert erklärt hatte, Hauptwerk, I. Anm. zu § 68 des 1. Bandes. Unsere obige Darstellung im Saṃyuttakanikāyo zeigt das Gleichnis in seiner ursprünglichen, von Gotamo gegebenen Fassung, viel kräftiger im Ausdruck. Hieran schließt sich ein Spruch, als Stempel gegeben im Saṃyuttakanikāyo vol. V p. 264 (PTS 263), Anguttaranikāyo, Chakkanipāto No. 29, in den Bruchstücken der Reden v. 502 und 203, Liedern der Mönche v. 396, der Nonnen 83:
Wie Dieses ist ist Jenes dort,
Wie Jenes wieder Dieses da,
Das Unten gleich dem Oben hier,
Das Oben hier dem Unten gleich.
In FREIDANKS »Bescheidenheit« ist der Spruch, über manche Transposition hinweg, im wundersam beibehaltenen Ton und Rhythmus nachgeklungen, mit einer Einleitung zu raschem Verständnisse:
Sus sprechent die dâ sint begraben,
Beide zen alten und zen knaben:
»Daz ir dâ sît, daz wâren wir,
Daz wir nû sîn, daz werdet ir.«
Dieser oft wiederholten und variierten naturgemäßen Ansicht haben die großen indischen Dichter immer und überall mit Vorliebe sich zugewandt, haben sie in unerschöpflicher Fülle kunstreich nachgebildet, am reizendsten wohl Kālidāsas im Ṛtusaṃhāram III 13u. VI 10, Kumārasaṃbhavam V 13, wenn er z.B. an erster Stelle den Wandel im Herbste besingt:
Von Tanzesfreude freigewordnen Pfauen abgewandt,
In Schwänen schwingt die Liebeslust mit holdem Sange fort;
Von Nelken wie von Rosen weg, Jasmin und Königsbaum,
Im Siebenblatt ist aufgegangen neu die Blütenpracht.
Dieselbe wechselweise Beziehung ist, sozusagen als Gegenstrophe, im letzten Gesang der Sappho LEOPARDIS angedeutet:
Jeder frohere
Tag unsres Daseins verduftet alsbald.
Es schleicht sich die Krankheit ein, und das Alter,
Und der Schatten des eisigen Todes.
[989] Reichliche weitere Belege in Anm. 332. Wie aber Kālidāsas alltägliche Dauer im Wechsel darzustellen vermochte, war auch GOETHE, durchaus geistesverwandt, mit der zunächst nur befremdlichen Anschauung so vertraut geworden, daß es ihm in einem voll kommen gleichartigen Bilde sie vorzuführen gelang:
Und was sich an jener Stelle
Nun mit deinem Namen nennt,
Kam herbei wie eine Welle,
Und so eilt's zum Element.
Noch einmal, aber da aus den Tiefen der Vorwelt emporgeholt und daher unseren alten Urkunden am nächsten verwandt, im Gesang der Lemuren bei der Grablegung Fausts, wo die Oberstimme fragt: Wer hat das Haus so schlecht gebaut – Wer hat den Saal so schlecht versorgt – und der Chor mit der Antwort verhallt:
Es war auf kurze Zeit geborgt;
Der Gläubiger sind so viele.
Selbst Dogberrys volkstümlicher Spruch, der überdies mit Humor versetzt ist, lehrt die Natur der Sache vortrefflich kennen: siehe Anm. 815. Auch GRACIAN meint scherzhaft den wechselnden Übergang, wenn er sagt: die Schönen sind Teufel in Gestalt von Weibern, und die Häßlichen sind Weiber in Gestalt von Teufeln, Criticòn, Antwerpener Ausgabe 1702 S. 299a. Breit ausgeführt ist diese ganze Art der Betrachtung, als eine schon bei hoch und niedrig bekannte Vorstellungsbrücke, in dem sonst recht wüsten und unerquicklichen mongolischen Heldenepos von den Taten Bogda Gesser Chans, namentlich im Kapitel vom Kampfe gegen den zwölfköpfigen Riesen, 2. Hälfte des 4. Abschnittes der Übersetzung 1. J. SCHMIDTS, St. Petersburg 1839, S. 136-158. – Das oben genannte scheinbar stoische Ergebnis, weder Wohl- noch Wehgefühl mehr zu empfinden, hat MOLINOS in seinem Geistlichen Führer, im 3. Buch Ende des 12. Kapitels, auf folgende Weise dem Mitkämpfer nähergebracht. Manche, sagt er, lassen von allen Dingen, aber nicht lassen sie von ihrer Eigenart, von ihrem Willen und sich selber; und darum gibt es so wenig wirklich Einsame. Denn löst sich das Gemüt nicht ab von seiner Eigenart, von seinem Begehren und seinem gewohnten Willen, von geistiger Fülle und Befriedigung, und zwar im Geiste selbst: dann wird es nicht jene höchste Seligkeit der inneren Einsamkeit erreichen können. Guida spirituale, ed. AMENDOLA, Neapel 1908, p. 283. So hatte auch TASSO, hundert Jahre vorher, in seinem Dialog über die Flucht vor der Menge von der »nobil fuga« gesprochen: »volendo fuggir la moltitudine, conviene che lasciamo tutti gli umani pensieri, e facciamo quella fuga che si dice da solo al solo.« Ganz nüchtern, rein sachlich ist das Verhältnis im Saṃyuttakanikāyo IV 256-259 (PTS 207-210) am besten erklärt: Der erfahrene, heilige Jünger wird geradeso wie der unerfahrene, gewöhnliche Mensch von Wehgefühl getroffen; aber während dieser davor Widerwillen empfindet, sehnsüchtig an Wohlgefühl zurückdenkt, weil er eine Befreiung von Wehgefühl anders nicht kennt, ist dagegen der Fall bei jenem so, daß er nur ein körperliches Wehgefühl empfindet und kein geistiges: ohne zu widerstreben denkt er nicht mehr sehnsüchtig an Wohlgefühl zurück, und warum nicht? Weil der erfahrene, heilige Jünger weiß, daß die Befreiung von Wehgefühl anders als durch Wohlgefühl zu bewirken ist. Er wird den Anreiz beider meiden lernen, bei Wehgefühl wie bei Wohlgefühl im Geiste davon abgelöst werden. Empfindet er nun ein Wehgefühl oder Wohlgefühl oder weder Weh- noch Wohlgefühl, so empfindet er es abgelöst: und so ist er abgelöst vom Leiden. Das [990] ist der große Unterschied, mahāviseso, zwischen dem erfahrenen Jünger und dem gewöhnlichen Menschen. Weiter noch ib. II 23: Beim Toren wie beim Weisen ist der Körper da so zustande gekommen, daß er aus Dürsten sich gebildet hat, umschlungen von Unwissen. So ist eben der Körper da, und außen Bild und Begriff. Auf solche Weise ist immer doppelt bedingt Berührung, eben das sechsfache Reich, worin betroffen der Tor wie der Weise Wohl und Weh empfindet, von der oder der Seite her, durch Gesicht, Gehör, Geruch, Geschmack, Getast, Gedenken. Was ist da nun für Besonderes, was für Bewandtnis, was für Verschiedenheit zwischen dem Weisen und dem Toren? Von was für Unwissen umwunden, von was für Dürsten gebildet der Körper da beim Toren zustande kommt: ebendieses Unwissen hat der Tor nicht abgetan, und dieses Dürsten nicht versiegen lassen; und warum nicht? Es hat ja der Tor kein Asketenleben gelebt zur völligen Leidensversiegung. Darum wird der Tor, bei der Auflösung des Körpers, wieder körperhaft werden. Wieder körperhaft geworden, wird er nicht frei von Geburt, Alter und Tod, von Kummer, Jammer, Schmerz, von Gram und Verzweiflung, er wird nicht frei vom Leiden, sage ich. Von was für Unwissen umwunden, von was für Dürsten gebildet der Körper da beim Weisen zustande kommt: ebendieses Unwissen hat der Weise abgetan, und dieses Dürsten versiegen lassen; und warum das? Es hat der Weise das Asketenleben gelebt zur völligen Leidensversiegung. Darum wird der Weise, bei der Auflösung des Körpers, nicht mehr körperhaft werden. Nicht mehr körperhaft geworden, wird er frei von Geburt, Alter und Tod, von Kummer, Jammer, Schmerz, von Gram und Verzweiflung, er wird frei vom Leiden, sage ich. Das ist das Besondere, das ist die Bewandtnis, das ist die Verschiedenheit zwischen dem Weisen und dem Toren, und zwar das Asketentum.
1056 paṭippassaddhiladdho mit S etc.
1057 Über den innigen Zusammenhang dieser Stücke, der ganz ebenso wie bei jener entgegengesetzten Reihe in unserer 15. Rede (217ff.) durch eine bedingte Entstehung zustande kommt, ist zu Beginn des Ekādasanipāto im Anguttaranikāyo No. 1-5 gesprochen. Alle fünf Ausführungen sind wichtig zum Verständnisse. Als Beispiel folge hier No. 2. »Wer tüchtig ist, ihr Mönche«, sagt Gotamo, »in Tugend bestanden, braucht nicht zu sorgen: ›Möchte mir keine Reue aufgehn‹; bestimmte Art ist es, ihr Mönche, daß dem Tüchtigen, der in Tugend bestanden ist, keine Reue aufgeht. Wer keine Reue kennt, ihr Mönche, braucht nicht zu sorgen: ›Möchte mir Frohsinn aufgehn‹; bestimmte Art ist es, ihr Mönche, daß dem Reuelosen Frohsinn aufgeht. Der Frohsinnige, ihr Mönche, braucht nicht zu sorgen: ›Möchte mir Heiterkeit aufgehn‹; bestimmte Art ist es, ihr Mönche, daß dem Frohsinnigen Heiterkeit aufgeht. Heiter geworden, ihr Mönche, braucht man nicht zu sorgen: ›Möchte mein Körper sich beschwichtigen‹; bestimmte Art ist es, ihr Mönche, daß der Körper des heiter gewordenen sich beschwichtigt. Der Körperbeschwichtigte, ihr Mönche, braucht nicht zu sorgen: ›Möchte mir wohl sein‹; bestimmte Art ist es, ihr Mönche, daß dem Körperbeschwichtigten wohl ist. Wem wohl ist, ihr Mönche, der braucht nicht zu sorgen: ›Möchte mein Geist einig werden‹; bestimmte Art ist es, ihr Mönche, daß wem wohl ist der Geist einig wird. Wer einig geworden, ihr Mönche, braucht nicht zu sorgen: ›Der Wahrheit gemäß will ich wissen und sehn‹; bestimmte Art ist es, ihr Mönche, daß wer einig geworden der Wahrheit gemäß weiß und sieht. Wer der Wahrheit gemäß weiß und sieht, ihr Mönche, braucht nicht zu sorgen: ›Ich will überdrüssig werden‹; bestimmte Art ist es, ihr Mönche, daß wer der Wahrheit gemäß weiß und sieht überdrüssig wird. Der Überdrüssige, ihr Mönche, braucht nicht zu sorgen: ›Ich will mich abwenden‹; bestimmte Art ist es, ihr Mönche, daß wer überdrüssig [991] ist sich abwendet. Der Abgewandte, ihr Mönche, braucht nicht zu sorgen: ›Die Wissensklarheit der Erlösung will ich verwirklichen‹; bestimmte Art ist es, ihr Mönche, daß der Abgewandte die Wissensklarheit der Erlösung verwirklicht. – So hat denn, ihr Mönche, die Abkehr als Ergebnis und Gewinn die Wissensklarheit der Erlösung, der Überdruß als Ergebnis und Gewinn die Abkehr, der Wahrheit gemäß wissen und sehn als Ergebnis und Gewinn den Überdruß, die Einigung als Ergebnis und Gewinn der Wahrheit gemäß wissen und sehn, das Wohlsein als Ergebnis und Gewinn die Einigung, die Beschwichtigung als Ergebnis und Gewinn das Wohlsein, die Heiterkeit als Ergebnis und Gewinn die Beschwichtigung, der Frohsinn als Ergebnis und Gewinn die Heiterkeit, keine Reue empfinden als Ergebnis und Gewinn den Frohsinn, heilsame Tüchtigkeit als Ergebnis und Gewinn keine Reue empfinden. So aber, ihr Mönche, fließt ein Ding in das andere über, geht ein Ding mit dem anderen in Erfüllung, daß man von hüben hinübergelangen kann.«
Das letzte Stück der Wissensklarheit von der Erlösung ist als Giebel der gotamidischen Darstellung in jeder diesbezüglichen Rede zu finden: so Mittlere Sammlung 26f., 384, 1071 und so fort. »›Im Erlösten ist die Erlösung‹«, heißt es da stets, »diese Erkenntnis geht auf. ›Versiegt ist die Geburt, vollendet das Asketentum, gewirkt das Werk, nicht mehr ist diese Welt‹ versteht er da.« Die Grundlagen des Gedankengebäudes waren freilich schon längst von vedischen Sehern festgefügt worden, Ṛksaṃhitā X 136, Atharvasaṃhitā XI 5: siehe Anm. 84 und 625. Auf jenem Fundament wurden dann die Seitenflügel zweier Upanischaden errichtet, Kaṭhopaniṣat V 1 vimukta ca vimucyate, »erlöst aber findet er die Erlösung«: entsprechend unserem Ausdruck vimuttasmiṃ vimuttam, »im Erlösten ist die Erlösung«; und in der Bṛhadāraṇyakā IV 4, 8 sagt Yājñavalkyas, daß von einem solchen die Atemzüge nicht ausziehn, sondern »eben hier sich auflösen«, atraiva amavalīyante (BÖHTLINGK hat onīyante, dagegen richtig olīyante im Zitat Vedānta sāras am Ende, vergl. oben die 1038 Anm.; auch Mittlere Sammlung 462 »die letzten Atemzüge«): »ganz heil geworden geht er nur ein in das Heil«, brahmaiva san brahmāpyeti. Diese zwei höchst bedeutsamen Stellen der beiden sicher alten Upanischaden gelten aber nach dem Vedāntasāras als die Urüberlieferung, ityevam ādi ruteḥ. Und eben diese vedische Urkunde und Urbotschaft ist es, die Gotamo auch hier fortgesetzt und vollendet hat: gleichwie das na jāyate mriyate vādi der Kaṭhopaniṣat II 18 erst vollkommen ausgeführt ist in der 140. Rede der Mittleren Sammlung, S. 1031, ed. Siam. p. 408 durch das na jāyati na jiyyati na miyyati nādi, »er entsteht nicht, vergeht nicht, erstirbt nicht« usw.; während es auch von anderer Seite verarbeitet wurde, in die Bhagavadgītā II 20 aufgenommen und dort mehr allgemein verständlich.
1058 Vergl. Anm. 1003. Um die Durchschauung der sechs inneren Bereiche mit Erfolg zu üben ist weiterhin noch an zahlreichen Stellen im Saṃyuttakanikāyo Wink und Anleitung dem ehrlich und ernst Vorschreitenden, dem rüstigen Kämpfer, dem vertrauten und zielbewußten Mönche, zu möglichst raschem Gelingen übermittelt, so z.B. vol. II p. 99, wo die Art und Weise gezeigt wird, wie man sich bei der Berührung durch das Gesicht, Gehör usw, zu verhalten habe: der heilige Jünger durchblickt die Berührung, die sechsfach immer reizt und reißt, d.h. er sieht sie als Nährboden an wie bei der geschundenen Kuh, die noch lebendig, wo immer sie auch sei, an einer Mauer, an einem Baume, am Wasser, am Felde, mit ihrem offenen Fleisch eben überall Bremsen und Mücken, Asseln und Käfern, Würmern und Milben, und was sonst noch irgend von Lebewesen an Wasser oder an Luft gebunden ist, als Gegenstand des Angriffes dient; wer also Berührung durchblickt hat, hat alles Gefühl durchblickt: und [992] hat er alles Gefühl durchblickt, so bleibt ihm nichts mehr zu tun übrig. Es sind also die sechs Sinnesbereiche nur der Nährboden, der da den Einflüssen, āsavā, von Gier, Haß und Irre jederzeit offensteht; ist aber das Gefühl richtig durchblickt, so kann man die Einflüsse versiegen lassen und den stetigen Kampf und Zwiespalt der wechselnden Gebilde untereinander aufheben, das heißt die Bedingungen auflösen, deren eine immer nur durch die andere besteht und selbst wieder aufgerieben wird: man kann es dahinbringen, daß jene Einflüsse und Krankheiterreger keine geeignete Stätte mehr finden um den Giftstoff zu erzeugen und wieder neu zu übertragen, es geht durch die planmäßig nach und nach durchgeführte Vertrocknung der Gefühle die brandige Lebenserscheinung zu Ende. Damit ist die Gesundheit errreicht: im Indischen nur ārogyam, d.i. Nichtkrankheit, genannt. Es kann also Gesundheit oder besser Nichtkrankheit mit Gefühl nicht bestehn; ganz wie KANT, rein theoretisch, es durchschaut hat: die negative Wirkung auf Gefühl ist bei ihm, »so wie aller Einfluß auf dasselbe, und wie jedes Gefühl überhaupt, pathologisch.« Siehe Anm. 808, 3. Absatz. So ist aber auch nach dem klassischen Bilde VERGILS das Gefühl der Geier, der tief in der Brust wohnt und unaufhörlich die Leber zerpflückt: nec fibris requies datur ulla renatis, Aen. VI 600. Die geschundene Kuh und die zerpflückte Leber: beide Gleichnisse, die sich nach außen und innen ergänzen und entsprechen, sind dann von dem unbekannten Frankfurter Ritter gegen Ende des 43. Kapitels seiner Deutschen Theologie sehr glücklich unter einem antithetischen Titel vereint worden: »Darum so ist der böse Geist und die Natur eins, und wo die Natur überwunden ist, da ist auch der böse Geist überwunden; und hinwiderum, wo Natur nicht überwunden ist, da ist auch der böse Feind nicht überwunden.« – Das Verhältnis der inneren Bereiche zur Außenwelt wird ferner auch in einer längeren Parabel veranschaulicht, Saṃyuttakanikāyo IV 198-300. Da werden die sechs Sinne auseinanderstrebenden, ganz verschiedenartigen Tieren verglichen, die ein Mann mit einem starken Seile verstrickt hätte, und deren jedes sehnsüchtig anderswo sich ergetzen, anderswohin entweichen möchte: eine Schlange zum Termitenbau, ein Delphin zum Wasser, ein Stoßvogel in die Luft, ein Hund nach dem Dorfe, ein Schakal nach dem Leichenplatz, ein Affe in den Wald. Aber der Mönch als Herr dieses Getiers hat ein jedes gefesselt und sie insgesamt an die feste Säule der auf den Körper gerichteten Einsicht gebunden; in dem so begrenzten Umkreis müssen sie nun bleiben: so daß die Schlange oder das Auge nicht den angenehmen Gestalten nachgleiten kann und an die unangenehmen gewöhnt wird, so daß das Ohr oder der Delphin usw., der Geist oder der Affe nicht den angenehmen Gedanken nachschweifen kann und an die unangenehmen gewöhnt wird. Das ist der Schutz, den sich der Mönch schafft: denn sonst wäre er ja im Bereich der sechs Sinne der Willkür jedes einzelnen verfallen, und welches der Tiere je zuweilen das stärkere wäre, dem müßten die anderen nachgeben, nachgehn, folgen; gleichwie wenn ein Mann das Seil, mit dem er sie alle an der Säule festhalten kann, etwa locker ließe. Das aber geschieht alltäglich hundertmal beim gewöhnlichen, unerfahrenen Menschen, der darum nie seiner Pein zu entrinnen vermag, dem schwachen Herrn, dem das Getier gebietet: ohne Gnade und Rast wird es ihn in alle Ewigkeit herumziehn und hetzen wie den verdammten Wilden Jäger, der durch Wald und Feld dahinflieht, laut heulend Weh und Ach;
Doch durch die ganze weite Welt
Rauscht bellend ihm die Hölle nach.
Herr sein ist eben auch hier: bis an die Zähne bewaffnet sein; si vis pacem, para belum. [993] Wie wär's auch anders möglich? »Denn das ganze Leben ist ein Kampf«, nach SCHOPENHAUERS letzter Maxime, »Jeder Schritt wird uns streitig gemacht und VOLTAIRE sagt mit Recht: on ne réussit dans ce monde qu'à la pointe de l'épée, et on meurt les armes à la main.« Kürzer, besser VERGIL: pulchrumque mori succurrit in armis, Aen. II 317; ganz schlicht SENECA: Atqui vivere, Lucili, militare est, Epist. 96. Diese Stimmen der Römer wiederholt MONTAIGNE im zweiten Teil seines letzten Essais, wo er den Menschen als »soldat volontaire« darstellt.
Die folgenden sechs Durstkreise sind in der 22. Rede, 392-395, vollständig gezeigt. Die Erfahrung von der Unersättlichkeit des Verlangens, der Unstillbarkeit des Dürstens, ist in einer Sage behandelt, die saftig und urwüchsig aus dem Osten, wie schon GRIMM bemerkt hat, uns durch spätere Mittler zugekommen, auch in Finnland und anderwärts erhalten ist. GRIMM gibt sie, nach RUNGES Aufzeichnung in der behäbigen pommerschen Mundart, als sein 19. Märchen. Ein Fischer hatte einen Butt gefangen, auf dessen Bitte aber wieder ins Meer entlassen. Der war nun ein verwunschener Prinz, und die Frau des Fischers drängt ihren Mann, für die gute Tat doch einen Lohn zu fordern. Der Fischer geht also an das Gestade, beschwört den Fisch und bittet, wie die Frau ihm aufgetragen, an Stelle des ekligen Pissputt, wo sie hausen, um eine kleine Hütte an der See. Der Wunsch wird erfüllt. Aber das Weib wünscht nun bald ein Schloß. Als sie das haben, will die Frau die Königswürde. König geworden will sie Kaiser werden. Auch das erfüllt der zaubermächtige dankbare Butt. Als Kaiser aber will sie der Papst werden; und nachdem sie sogar das geworden ist, kann sie es nicht aushalten und hat keine ruhige Stunde mehr, weil sie nicht selbst kann Sonne und Mond aufgehn lassen, aus eigener Macht: sie will also der liebe Gott werden – und da sitzt sie denn wieder im Pissputt, wie die Geschichte vom Durst immer endet. GRIMMS Vorlage geht zuletzt auf die Sage von König Mandhātā zurück, dem schon in der Ṛksaṃhitā X 134 genannten, hochberühmten Weltbeherrscher Māṃdhātā, der dann in Smṛti und Purāṇam eine volkstümliche Gestalt wurde. Die Legende über ihn ist kurz im 258. Jātakam, ausführlich im 17. Divyāvadānam p. 210-228 erzählt. Er hatte viele Jahrtausende als König Erderoberer in unermeßlicher Fülle und Macht geherrscht, konnte aber den Wunschesdurst nicht stillen, unzufrieden gequält. Im Vollgefühl seiner hohen Verdienste schätzte er die Kaiserwürde gering, er rüstete sich und zog mit seiner Heeresmacht aus, um die himmlischen Reiche der vier Weltgegenden zu erobern. Dann herrschte er auch dort lange Zeiten hindurch, konnte aber auch so den Durst nicht stillen, unzufrieden gequält. Darum zog er denn immer weiter empor, bis zum nächsthöheren Gipfel des formhaften Daseins, und eroberte den Himmel der Dreiunddreißig Götter. Dort führte er dann, von Sakko dem Götterherrn freundlich empfangen und anerkannt, ebenbürtig mit ihm, dem lieben Gott jener mittleren himmlischen Sphären, die Oberherrschaft unermeßliche Zeiten hindurch; er hatte endlich sechsunddreißigmal immer einen lieben Gott um den anderen dort überlebt: auch Sakko nämlich schwindet und erscheint wieder im Wandel der Jahrmillionen, nur Amt und Würde besteht unter wechselnder Person gleichmäßig fort. Wie nun so die Äonen dahinflossen, wuchs ihm der Wunschesdurst heftig und immer nur heftiger an: »Was soll mir gemeinsame Herrschaft? Ich will Sakko umbringen und Alleinherrschaft haben.« Nun kann aber Sakko der Götterherr nicht umgebracht werden, und der Durst danach war schon Verderben. Denn er wurde alsogleich greis und gebrechlich, schwand hinweg aus der Götterwelt, kam herab in seinen Erdenhof und starb da. Darum heißt es in den Liedern der Nonnen v. 486:
[994] Der Weltbeherrscher Mandhātā,
Genossen hat er höchste Lust;
Doch ungesättigt starb auch er:
Sein Sehnen, das war nicht gestillt.
Bei den loniern und Italern ist daraus der Mythos vom erdgebornen Riesen Tityos geworden, dessen unstillbarer Durst nach Genuß und immer weiterer Macht ihm dann in der Unterwelt die unsterbliche Leber (immortale iecur, Aeneis VI 598) erzeugt und sie von Geiern links und rechts immer wieder zerhacken läßt, Odyssee XI 576/79; was aber dort in der tiefen Unterwelt vorgehn soll, das geschieht alles in unserem Leben, sagt LUKREZ dazu, III 976ff., während PHAEDRUS das ganze so erklärt, Appendix No. 5:
Novem porrectus Tityos est per iugera,
Tristi renatum suggerens poenae iecur;
Quo quis maiorem possidet terrae locum,
Hoc demonstratur cura graviore adfici,
Consulto involvit veritatem antiquitas,
Ut sapiens intellegeret, erraret rudis.
Weitere verwandte Stellen sind oben am Ende der 798. Anmerkung gegeben. Vergl. noch das Wort des hundertjährigen Faust, wo er immer noch vom Weiterschreiten spricht, »Er, unbefriedigt jeden Augen blick«, 11452. KANT hat hierzu, einige vierzig Jahre früher, den Kommentar geschrieben. Wenn wir auch, sagt er, die Geschicklichkeit uns eingebildete Zwecke zu verschaffen noch so hoch steigern wollten: so würde doch, was der Mensch unter Glückseligkeit versteht, von ihm nie erreicht werden; »denn seine Natur ist nicht von der Art, irgend wo im Besitze und Genusse aufzuhören und befriedigt zu werden.« Kritik der Urteilskraft § 83, 2. Absatz.
1059 Die ersten fünf der hier genannten sechs zu verwirklichenden Dinge haben bei Gotamo offenbar nicht viel gegolten. Denn der Meister stellt einmal an den ehrwürdigen Udāyī (s. oben Anm. 860) die Frage: »Wieviel sind es wohl, Udāyī, der Dinge, an die man sich erinnern soll?« Worauf der Jünger erst keine Antwort weiß, dann aber von der Erinnerung an früheres Dasein usw. spricht. Da wendet sich Gotamo an Ānando und sagt: »Ich hab' es ja gewußt, Ānando, daß dieser Udāyī, verwirrt, wie er ist, keinem hohen Gedenken nachhängt; wieviel gibt es also, Ānando, der Dinge, an die man sich erinnern soll?« – »Fünf Dinge gibt es, o Herr«, erwidert Ānando, »an die man sich erinnern soll: und welche fünf?« Es sind, wie der besser erfahrene Jünger nun ausführt, die ersten drei Schauungen, sodann die Entwicklung des selbstleuchtenden Gemütes (siehe oben S. 567) und zuletzt die Körperbetrachtung (wie in unserer 22. Rede 385f.), die zu der vierten Schauung einmündet. Diese Darstellung billigt der Meister gern und fügt abschließend hinzu: »So magst du dir denn, Ānando, noch das als sechstes Ding zur Erinnerung merken: da ist, Ānando, ein Mönch wohlbewußt beim Kommen, wohlbewußt beim Gehn, wohlbewußt steht er, sitzt er und liegt er, wohlbewußt versieht er sein Werk. Das ist, Ānando, ein Ding zur Erinnerung, das also geübt, also gepflegt, zur Erwerbung klaren Bewußtseins taugt.« Anguttaranikāyo, Chakkanipāto No. 29. Das erste der sechs zu verwirklichenden Dinge, das Sāriputto oben im Text angibt, nämlich die Machtentfaltung mit ihren verschiedenen magischen Phänomenen, ist ebenda No. 41 gleichsam an der Wurzel der Entwicklung bloßgelegt. Als der ehrwürdige Sāriputto eines Tages [995] mit anderen Brüdern vom Geierkulm bei Rājagaham herabstieg, sah er am Wege einen großen Baumstrunk daliegen. Bei diesem Anblick nun wandte er sich also an die Jünger: »Ein Mönch, ihr Brüder, der machtbegabt ist, den Geist in seiner Gewalt hat, kann wohl, wenn ihn danach verlangt, diesen Baumstrunk schlechthin als Erde ansprechen: und warum das? Es ist, ihr Brüder, an diesem Baumstrunk Art der Erde bestanden, und darauf gestützt kann wohl ein Mönch, der machtbegabt ist, den Geist in seiner Gewalt hat, den Baumstrunk da schlechthin als Erde ansprechen. Ein Mönch, ihr Brüder, der machtbegabt ist, den Geist in seiner Gewalt hat, kann wohl, wenn ihn danach verlangt, diesen Baumstrunk schlechthin als Wasser, als Luft, als Feuer, als schön, als unschön ansprechen: und warum das? Es ist, ihr Brüder, an diesem Baumstrunk Art des Wassers, Art der Luft, Art des Feuers, schöne Art, unschöne Art bestanden, und darauf gestützt kann wohl ein Mönch, der machtbegabt ist, den Geist in seiner Gewalt hat, den Baumstrunk da schlechthin als Wasser, als Luft, als Feuer, als schön, als unschön ansprechen.« Hier zeigt sich klar, daß die Machtentfaltung des Mönchs, der den Geist in seiner Gewalt hat, nichts anderes als eine geistige Übung sein soll, ein Mittel um die Dinge und ihre Veränderlichkeit zu durchschauen. Das ist das gotamidische Wissensziel. Die anderen Mirakel, die genannt werden, hätte er, wenn ihn danach verlangte, mit allen übrigen Wundertätern gemein, elfte Rede S. 149f.: er wäre dann bloß ein gandhāriko oder Zauberkünstler, Thaumaturg, einer der das ϑαυματοποιικον μοριον betreibt, nach PLATONS schön beistimmender Erklärung am Ende des Sophistes, kurz ein »zahorí«, wie man Leute mit dergleichen Fähigkeiten in Spanien genannt hat und noch antrifft. Die gänzliche Geringschätzung aller magischen und sonstigen außerordentlichen Taten und Eigenschaften solcher Art kommt aber nirgends stärker zur Geltung als im Gespräch mit Susīmo, Saṃyuttakanikāyo ed. Siam. vol. II p. 113-121 (PTS 119-127). Zu einer Zeit als Gotamo und seine Jünger schon in hohem Ansehn standen, hielt sich der Pilger Susīmo mit vielen Nachfolgern auch wie Gotamo in der Umgebung von Rājagaham auf. Da nun Susīmo und die Seinen nicht sehr geschätzt wurden, bewogen ihn diese beim Asketen Gotamo um Aufnahme zu bitten, damit er ihnen später dessen Lehre und Ordnung mitteilen könne: so würden auch sie dann zu Ansehn gelangen und reichlichen Unterhalt finden. Susīmo der Pilger war damit einverstanden. Er begab sich zu Ānando und bat in den Orden aufgenommen zu werden. Ānando geleitete ihn zu Gotamo, trug das Anliegen vor, und der Meister ließ alsbald Susīmo mit der Ordensweihe belehnen. Um diese Zeit aber hatten viele Mönche beim Erhabenen die Gewißheit kundgetan: ›Versiegt ist die Geburt, vollendet das Asketentum, gewirkt das Werk, nicht mehr ist diese Welt.‹ Als Susīmo davon erfahren hatte, suchte er solche Mönche auf und fragte sie, ob das wahr wäre. Da sie es bestätigten, forschte er weiter, ob sie, bei solchem Wissen, bei solchem Anblick, etwa die Machtentfaltung in verschiedener magischer Wirkung auch richtig erworben hätten. Das verneinten jene. Ob sie aber doch wohl, bei solchem Wissen, bei solchem Anblick, das himmlische Gehör, die Kenntnis der Herzen, die Erinnerung an frühere Daseinsformen, das überirdische Gesicht von der Wiederkehr der Wesen je nach den Taten, die ruhsamen Freiungen jenseit aller Formen errungen hätten? Auch darauf wird nein gesagt. Ist nun das, ihr Ehrwürdigen, erwidert Susīmo, die Aufklärung, und daß man jene Dinge nicht eingegangen ist, wie steht es dann mit dem ›Nein, Bruder?‹ – In Weisheit sind wir erlöst, Bruder Susīmo, antworten jene Mönche. Eine so kurzgefaßte Rede kann aber Susīmo, wie er sagt, nicht so ohneweiters verstehn und bittet daher um gütige, nähere Angaben, damit er den Sinn ausführlich begreifen lerne. Jene aber sagen nur: Ob du es nun, Bruder Susīmo, [996] verstehn oder nicht verstehn magst: wir sind eben in Weisheit erlöst. Daraufhin begibt sich der ehrwürdige Susīmo zum Erhabenen hin und berichtet die ganze Unterredung, die er mit jenen Mönchen gehabt. Der Meister aber sagt zu ihm: »Erst kommt da, Susīmo, die Kenntnis vom Bestand der Dinge, dann die Kenntnis von der Erlöschung.« Auch das vermag Susīmo nicht zu begreifen und bittet auch hier um genauere Aufklärung. Gotamo wiederholt: »Ob du es nun, Susīmo, verstehn oder nicht verstehn magst: die Kenntnis vom Bestand der Dinge kommt da zuerst, dann die Kenntnis von der Erlöschung. Was meinst du wohl, Susīmo: ist die Form unvergänglich oder vergänglich?« – »Vergänglich, o Herr.« – »Was aber vergänglich, ist das weh' oder wohl?« – »Weh', o Herr.« – »Was aber vergänglich, wehe, wandelbar ist, kann man etwa davon behaupten: ›Das gehört mir, das bin ich, das ist mein Selbst?‹« – »Gewiß nicht, o Herr.« – »Ist Gefühl, Wahrnehmung, Unterscheidung, Bewußtsein vergänglich oder unvergänglich«, usw. Es ist vergänglich, wehe, wandelbar, und man kann nichts als sein eigen ansprechen, gibt Susīmo zu. Bei solcher Betrachtung, führt nun Gotamo weiter aus, die alle Zeiten und Räume, innen und außen, grob und fein, gemein und edel gleich gültig umspannt, gleich weise durchschaut, wird der erfahrene heilige Jünger der Form überdrüssig, er wird des Gefühls, der Wahrnehmung, der Unterscheidung, des Bewußtseins überdrüssig. Überdrüssig wendet er sich ab. Abgewandt löst er sich los. ›Im Erlösten ist die Erlösung‹, diese Erkenntnis geht auf. ›Versiegt ist die Geburt, vollendet das Asketentum, gewirkt das Werk, nicht mehr ist diese Welt‹, versteht er da. »›Durch Geburt bedingt ist Alter und Tod‹: siehst du das, Susīmo?« – »Ja, o Herr.« – »›Durch Werden bedingt ist Geburt‹: siehst du das, Susīmo?« – »Ja, o Herr.« – »Durch Anhangen bedingt Werden, durch Durst bedingt Anhangen, durch Gefühl bedingt Durst, durch Berührung bedingt Gefühl, durch sechsfaches Reich bedingt Berührung, durch Bild und Begriff bedingt sechsfaches Reich, durch Bewußtsein bedingt Bild und Begriff, durch Unterscheidung bedingt Bewußtsein, durch Nichtwissen bedingt Unterscheidung: siehst du das, Susīmo?« –»Ja, o Herr.« – »Und siehst du, Susīmo, daß durch die Auflösung der Geburt Alter und Tod aufgelöst wird, durch die Auflösung des Werdens die Geburt aufgelöst wird, durch die Auflösung des Anhangens das Werden aufgelöst wird, durch die Auflösung des Durstes das Anhangen, durch die Auflösung des Gefühls der Durst, durch die Auflösung der Berührung das Gefühl, durch die Auflösung des sechsfachen Reiches die Berührung, durch die Auflösung von Bild und Begriff das sechsfache Reich, durch die Auflösung des Bewußtseins Bild und Begriff, durch die Auflösung der Unterscheidung das Bewußtsein, daß durch die Auflösung des Nichtwissens die Unterscheidung aufgelöst wird: siehst du das, Susīmo?« – »Ja, o Herr.« – »Und magst du da nun, Susīmo, bei solchem Wissen, bei solchem Anblick, an verschiedener magischer Machtentfaltung dich ergetzen?« – »Gewiß nicht, o Herr.« – »Oder magst du da etwa, Susīmo, bei solchem Wissen, bei solchem Anblick, das himmlische Gehör, die Kenntnis der Herzen, die Erinnerung an mancherlei einstige Daseinsform, das überirdische Gesicht von der Wiederkehr der Wesen je nach den Taten, die ruhsamen Freiungen jenseit aller Form dir erwerben?« – »Gewiß nicht, o Herr.« – »Ist nun das, Susīmo, die Aufklärung, und daß man jene Dinge nicht eingegangen ist, wie steht es dann mit dem ›Nein‹, Susīmo?« (kathan ti mit S.) Dem rechten Jünger haben demnach außerordentliche Machterscheinungen als minderwertig zu gelten. Hat er sie aber im Verlaufe seiner Übungen doch etwa in sich verwirklichen gelernt, so wird er damit keinesfalls großtun. Denn jede höhere Eigenschaft, die er erwirbt, hat er verborgen zu halten. Dies geht so weit, daß der Mönch sich ohne zureichenden Grund auch nicht äußern [997] darf, er habe diese oder jene Schauung, oder Vertiefung, oder Befreiung, oder einen heiligen Wandel erworben, ja daß er nicht einmal bekennen darf: »Ich weile gern in leerer Zelle«; ein Verbot, das ihm bei der Aufnahme in den Orden, heute noch wie einst, eingeschärft wird, da er sonst der Ordensgemeinschaft verlustig würde: gleichwie etwa eine Palme, der die Krone abgeschnitten ist, nicht mehr emporwachsen kann, so ist auch ein solcher Mönch kein Asket mehr, kein Jünger des Sakyersohnes, Upasampadākammavācā, ed. DICKSON p. 6. Ebenso hat St. BERNHARD in seiner Doctrina bestimmt: Absconde super omnia huiusmodi studia tua, et dissimula apud alios meditationes tuas sanctas quantum potes, ed. 1621 fol. 1750. Und von Bruder AEGIDIUS sind Quaedam verba valde notabilia erhalten, deren erstes lautet: Cordis arcana non publices, Die Geheimnisse des Herzens enthülle nicht, Documenta antiqua Franciscana, ed. LEMMENS pars I, Quaracchi 1901 p. 63.
1060 suāiṭṭhā honti S etc. richtig. Das Gleichnis ist in der 22. Rede der Mittleren Sammlung, S. 153 gegeben und in der 54. Rede, 399, ausführlich vorgetragen. Dazu gehört noch die weitere großartige Entwicklung ebendieses Gleichnisses in der 75. Rede, 541-543. Sāriputto spricht nur wieder das Merkwort hierzu, als kürzeste Induktion. Es ist das häufige Beispiel dieser Methode unserer Texte, die übrigens auch von ARISTOTELES als der λογος επακτικος mit Recht gerühmt wird.
1061 Ähnlich Mittlere Sammlung S. 530. Vergl. noch unsere Anm. 598 Ende. Der Begriff des Wahns ist in Anm. 961 untersucht.
1062 Siehe vorher S. 604 die vier Pfeiler der Einsicht als die vier auszubildenden Dinge. Durch deren Pflege und Ausbildung, sagt der ehrwürdige Anuruddho, kann man zur großen Erkenntnis gelangen: wo man dann die gewöhnlichen Dinge als gewöhnlich, die mittelmäßigen Dinge als mittelmäßig, die erlesenen Dinge als erlesen verstehn lernt: Saṃyuttakanikāyo vol. V p. 295 (PTS 298). Diese letzteren auszulesen, herauszufinden, das ist die seltene Kunst. »Das ganze menschliche Wissen (wenn nach der Meinung des Sokrates überhaupt jemand weiß) beschränkt sich nunmehr auf die Gewandtheit einer weisen Auslese«, so beginnt GRACIAN sein Kapitel über den Hombre de buena eleccion im Discreto; und er sagt am Ende: »No hay perfeccion donde no hay eleccion.«
1064 Mit S etc. Idh' āvuso bhikkhu satthāraṃ vā; wie hier auch früher, S. 579, garuṭṭhāniyo zu lesen.
1065 So in der 33. Rede der Mittleren Sammlung, S. 251.
1066 Eine Ausführung der hier wie früher S. 595-597 vorgetragenen Gedanken, über die Schwierigkeit und Seltenheit das Rechte kennenzulernen, findet man im Anguttaranikāyo I 1 No. 19, übersetzt in meiner Buddhistischen Anthologie, Leiden 1892, S. 104-108. Besonders wichtig ist auch das zugehörige Gleichnis von der Schildkröte, in der 129. Rede der Mittleren Sammlung gegeben, 961f. Es ist im Saṃyuttakanikāyo, ed. Siam. vol. V p. 433 (PTS 456f.) wiederholt, und zwar ist es an letzterem Orte, genau unserem obigen Gedankengang entsprechend, etwas ausführlicher behandelt: daher es hier folgen mag. »Gleichwie etwa, ihr Mönche, wenn diese große Erde gänzlich mit Wasser bedeckt wäre, und es hätte ein Mann eine einkehlige Reuse hineingeworfen; die würde da vom östlichen Winde nach Westen getrieben, vom westlichen Winde nach Osten getrieben, vom nördlichen Winde nach Süden getrieben, vom südlichen Winde nach Norden getrieben; und es wäre da eine einäugige Schildkröte, die von hundert zu hundert Jahren immer je einmal emportauchte; was meint ihr nun, Mönche: sollte da etwa die einäugige Schildkröte, die von hundert zu hundert [998] Jahren immer je einmal emportaucht, in jene einkehlige Reuse mit ihrem Halse hineingeraten?« – »Nur selten mag es sein, o Herr, daß eine solche einäugige Schildkröte, die von hundert zu hundert Jahren immer je einmal emportaucht, in jene einkehlige Reuse mit ihrem Halse hineingeraten kann.« – »So selten auch nur ist es, ihr Mönche, daß man die Menschheit erlangt; so selten auch nur ist es, ihr Mönche, daß ein Vollendeter in der Welt erscheint, ein Heiliger, vollkommen Erwachter; so selten auch nur ist es, ihr Mönche, daß eine von einem Vollendeten kundgetane Lehre und Ordnung in der Welt leuchtet. Da ist jetzt, ihr Mönche, die Menschheit erlangt, und ein Vollendeter ist in der Welt erschienen, ein Heiliger, vollkommen Erwachter, und eine von einem Vollendeten kundgetane Lehre und Ordnung leuchtet in der Welt. Darum aber, ihr Mönche, soll man nun ›Das ist das Leiden‹ zu verstehn suchen, ›Das ist die Leidensentwicklung‹ zu verstehn suchen, ›Das ist die Leidensauflösung‹ zu verstehn suchen, ›Das ist der zur Leidensauflösung führende Pfad‹ zu verstehn suchen.« Dieses Gleichnis zeigt ungemein anschaulich wie selten es sein mag, daß im Wandel der unermeßlichen Sternläufe hie und da einmal die Rettung aus dem Meere des Daseins gefunden werden kann: der Bedingungen hierzu sind in Zeit und Raum verschwindend wenige. Es sind eben, wie Sāriputto in seiner Rede oben sagt, Dinge, die schwer zu treffen sind. Mit einem heiteren Ausblick vertröstet uns GOETHE:
Das Leben wohnt in jedem Sterne:
Er wandelt mit den andern gerne
Die selbsterwählte reine Bahn;
Im innern Erdenball pulsieren
Die Kräfte, die zur Nacht uns führen
Und wieder zu dem Tag heran.
Und von dieser kreisenden Kraft in uns, nach unten, oder glücklich empor, sagt der Dichter der Kûdrûn, v. 649:
Gelücke daz ist sinewel dicke alsam ein bal. –
Hier sei nun noch darauf hingewiesen, daß unser Gleichnis von der einäugigen Schildkröte in die christlichen Evangelien übergegangen ist, wo es in die Parabel vom Kamel und dem Nadelöhr umgearbeitet wurde: etwas heftig verschroben allerdings, weil es sich anderen Leuten und anderer Anschauung anpassen mußte,
Uccio, uccio,
Sento puzzo di cristianuccio,
und dabei die ursprüngliche, nach indischen Begriffen schlichte Verständlichkeit in eine unmögliche Hyperbel verwandelt hat. Immerhin: unter Blinden ist der Einäugige König, da mag auch der einäugige Chelone als Kamel gelten, und εν αμουσοις και Κορυδος φϑεγγει. Die in diesem Fall obwaltenden Verhältnisse und Beziehungen hat zuerst DE LORENZO erkannt und besprochen, in der Flegrea, Neapel, 1901, S. 410f. Ich habe dann 1902 im dritten Bande der Mittleren Sammlung Anm. 472 die ganze Frage eingehend untersucht und die Vermittlung aufzeigen können, die durch eine Epistel des BARNABAS erfolgt war, nach der Hauptstelle derselben in der Mitte des zehnten Kapitels, wo dieser ältere und echtere Apostel und Glaubensbruder des PAULUS die Schlechten und Frevler den Polypen und anderen Tieren der Seetiefe vergleicht, ὡς και ταυτα τα ιχϑυδια μονα επικαταρατα εν τῳ βυϑῳ νηχεται, μη κολυμβωντα [999] ὡς τα λοιπα, κτλ. In späterer Zeit hat noch SYNESIOS, Bischof zu Ptolemaïs um 410, sicher Kenntnis dieses Gedankenganges gehabt, da er in einer seiner Hymnen, III v. 725, den Wunsch ausspricht »dem Lichte sich zu vereinen, nie wieder zu versinken in der Unterwelt Elend«,
Φωτι μιγεισαν,
Μηκετι δυναι
Ες χϑονος αταν.
Auch der ältere CHALKIDIOS, um 340 Diakon in Karthago, hat in seinem Kommentar zu PLATONS Timaios § 187 unseren Gemeinplatz beschriften; wozu man weitere wertvolle Belege findet in DE CHAUFEPIÉS Supplement zu BAYLES Dictionaire, Amsterdam 1750, 2. Foliant s.v. HAKEM Anm. D. Wie berühmt unser Gleichnis gewesen sein muß, ist noch durch den tibetischen Kanon bestätigt, wo es in das vorletzte Kapitel des Dsanglun verarbeitet wurde. Während aber in der syrischen Wüste aus der Riesenschildkröte ein Kamel geworden war, hatte sich ebenso der Umgebung anpassend in der hochasiatischen Steppe mit ihren Salzseen der Meerechs des indischen Ozeans in »einen großen schlangenähnlichen Wurm mit vier Füßen« gewandelt, der am Grunde eines unsauberen Tümpels sein Wesen treibt und, im Wasser umherirrend, zuweilen emportaucht, um dann auf der Wasserfläche hin und her zu schwimmen, unermeßliche Weltperioden hindurch der tiefen schlammigen Nacht da unten verfallen, bis er die vor dem als Mensch begangene Schuld überstanden haben und vielleicht einmal diesem höllischen Pfuhl entrinnen kann: I.J. SCHMIDT, Dsanglun, Der Weise und der Tor, St. Petersburg 1843, I 319-321, übersetzt II 399-401. Das Verhältnis der indischen zur syrischen Parabel hat, beiläufig bemerkt, schon elf Jahre nach meiner vorher genannten Untersuchung in der Mittleren Sammlung, FRITZ MAUTHNER auch richtig erkannt und darüber gesprochen, in seiner, sonst durch wenig Sachkenntnis getrübten, Novelle »Der letzte Tod des Gautama Buddha«, München 1913, S. 145. Das war recht brav, nur scheint er freilich seinem dichterischen Kritizismus allzu viel aufzubürden, insofern er den Fund und Befund als eigenen ausgibt; so erfreulich es anderseits gewiß wäre, wenn der gar seltsame Zusammenhang als ganz mühelos und wie von selbst verständlich sich dem Auge des Poeten und Philosophen wie einem zweiten Sankt FIACRIUS alsogleich erschlossen hätte. Unsere Indologen sind etliches minder scharfsinnig. Selbst der gediegene GARBE z.B. hat da Bedenken gegen mich geäußert und über das Verhältnis der beiden Gleichnisse erst jüngst gemeint: »Hier ist alles verschieden mit Ausnahme der Vorstellung, daß ein Tier auf unglaubliche Weise in ein Loch gerät, literarischer Zusammenhang also so gut wie ausgeschlossen«, Indien und das Christentum, Tübingen 1914, S. 44. Das tertium comparationis, worauf sich alles bezieht, hat er nicht bemerkt: die höchst seltene Möglichkeit einer Erlösung. Das nämlich ist der Humor der Sache, das allein ist es, was beide Gleichnisse veranschaulichen wollen, und was ihnen auch, je nach dem Standpunkte, großartig gelungen ist. Die Arbeit des Tübinger Gelehrten ist jedoch als eine sehr fleißige, sehr anregende Besprechung der einschlägigen Fragen warm zu empfehlen: nur, leider, fehlt manchmal das Beste; so auch wieder bei den Nachrichten über Krischnas, S. 217, der locus palmarius, nämlich der älteste und gewichtigste Beleg aus unserer 3. Rede, cf. Anm. 632 Ende, usw. – Zu adhiccam »nur selten« oben Anm. 877. Über die angrenzenden Länder, »die fremdartigen, wo es keine Kundigen gibt«, weiß ich keinen besseren Kommentar als den folgenden: »Barbaren von alters [1000] her, durch Fleiß und Wissenschaft und selbst durch Religion barbarischer geworden, tiefunfähig jedes göttlichen Gefühls, verdorben bis ins Mark zum Glück der heiligen Grazien, in jedem Grad der Übertreibung und der Ärmlichkeit beleidigend für jede gut geartete Seele, dumpf und harmonienlos, wie die Scherben eines weggeworfenen Gefäßes ... Herren und Knechte, Jungen und gesetzte Leute, aber keine Menschen ... Nothwerk sind sie nur, aus feiger Angst, mit Sklavenmühe, dem wüsten Herzen abgedrungen ... nichts Reines lassen sie unverdorben, nichts Heiliges unbetastet mit den plumpen Händen ... bei ihnen eigentlich ist das Leben schaal und sorgenschwer und übervoll von kalter, stummer Zwietracht ... Und wehe dem Fremdling, der aus Liebe wandert, und zu solchem Volke kömmt« usw. HÖLDERLIN, Hyperion, vorletztes Kapitel. Auch hier ist indogermanische Verwandtschaft aufgewiesen, aber in der Richtung wo der Pilgerschwan haṃso zur Gans als Martinsbraten wird. Nach Zeit und Ort abgefaßt besteht die Schilderung heute für jedes beliebige Volk, längst über die Zackinger Grenzen hinausreichend und internationale Gunst verbürgend. In nuce GONGORA, 63. Letrilla:
Hay unos hombres de bien
En este nuestro arrabal,
Que de todo dicen mal,
Y dicen bien.
Menschen gibt es, leben recht,
In unserm Winkelbürgerhaus,
Sagen übers ganze: Graus,
Und sagen recht.
Bei gleicher Erfahrung und einem gleichen Gedankengange folgend entschließt sich Al-Hafi allen Reichtum der Barbaren aufzugeben und unverzüglich, »Knall und Fall«, wie er sagt, als Pilger von dannen zu ziehn, fernhin bis zum Ganges, in der Überzeugung »Am Ganges, am Ganges nur gibt's Menschen«; und er enteilt mit einem letzten »Lebt wohl!« Nathan der Weise aber sieht ihm nach, tief ergriffen, von Herzen zustimmend:
Wilder, guter, edler –
Wie nenn' ich ihn? – Der wahre Bettler ist
Doch einzig und allein der wahre König!
Dabei ist noch denkwürdig, ja höchst bewundernswert, wie echt buddhistisch diese Gestalt hier vom Dichter schon erschaut worden war: vollkommen gemäß dem über ein Jahrhundert später erst zugänglichen Selasuttam, Mittlere Sammlung S. 704 und Bruchstücke der Reden v. 554; vergl. auch oben S. 351 mit Anm. 619. Und noch einmal merkwürdig: LESSING wollte dem Nathan sogar ein Nachspiel unter dem Titel: »Der Derwisch« folgen lassen; wo also Al-Hafi als der wahre Mensch unter Menschen, als König Bettler am Gestade des Ganges gezeigt worden wäre. Dieser zweite Teil, die Vollendung und Krönung des ganzen, ist aus äußeren Gründen, wie man annimmt, unterblieben. Es werden aber vielmehr innere Gründe gewesen sein, der Mangel an Quellen, die damals durchaus unzulängliche Kenntnis der Realien, ohne die selbst der größte Künstler nicht aus kommen kann.
1067 Vergl. Lieder der Mönche v. 990 und die zusammenfassenden Nachweise in Anm. 668. – Die ersten sieben Gedanken sind, wie es im Aṉguttaranikāyo vol. IV p. 228 [1001] bis 235 sehr schön ausgeführt wird, dem ehrwürdigen Anuruddho, während er einsam zurückgezogen weilte, zum Bewußtsein gekommen: der Meister billigt sie und gibt dem Jünger noch den letzten als achten Gedanken eines großen Mannes zur Erwägung, wo sich das Herz in der Auflösung der Sonderheit erhebt, erheitert, beschwichtigt und beruhigt. – Von einem solchen Selbstgewaltigen, Schicksalgestaltenden, der mit der Auflösung der Sonderheit zum All geworden ist, akiñcano kevalī yatatto, entwesen ist, alleigen, selbstgewaltig, wie es in den Bruchstücken der Reden v. 490 heißt, von dem kann wohl das vergilische Wort gelten, Georgica II 490, ja von ihm nur verwirklicht worden sein:
Felix qui potuit rerum cognoscere causas,
Atque metus omnes et inexorabile fatum
Subiecit pedibus, strepitumque Acherontis avari.
Er ist der Glückliche geworden, von dem ein Jünger des heiligen BERNHARD sagte: Et felix qui de saeculo non quasi de coeno, sed quasi de lavacro ascendit; non habens necesse ut aliquid in se lavet, sed est mundus totus: »Und glücklich wer aus dem Zeitlichen nicht wie aus dem Schlamme, sondern wie aus dem Bade emporsteigt; er hat nicht mehr nötig etwas in sich abzuspülen, denn lauter ist er durchaus.« Das ist die Lauterkeit ohne Sonderheit, ohne Ziel und Zweck, ohne Himmel und Hölle, tota teres atque rotunda. So aber wird nun der tiefe Doppelsinn klar: est mundus totus, lauter ist er durchaus, zugleich: er ist die ganze Welt. Domini GILLEBERTI Cisterciensis Sermo XXIII, Opera etc. fol. 1834. Vergl. den letzten Absatz der Anm. 978.
1068 Mittlere Sammlung 571f. und wiederholt vorgetragen, auch oben S. 593f. dazu Anm. 1037. Als Beispiel für die weiße Farbe wird an dieser Stelle immer zuerst der Morgenstern genannt: »Gleichwie etwa der Morgenstern weiß ist, weiß schimmert, weiß scheint, weiß aussieht« usw. Man kann auch in unseren Breiten beobachten wie ausgezeichnet gerade dieses Beispiel gewählt ist, wenn man am klaren Morgenhimmel den im reinsten Weiß schimmernden Planeten erblickt. Es ist bemerkenswert, daß JEAN PAUL dies gleich scharfsichtig wahrgenommen hat, da er sagt: »Es stand noch nichts weiter vom Morgen am Himmel – als der kühle, weiße Morgenstern«, Über den Tod nach dem Tode, Berliner Ausgabe 1828 Bd. 51 S. 105. – Wie die Freude an Farben und Formen und allen Erscheinungen zu überwinden ist, so die Freude an Tönen, also das ganze Reich dessen, was wir Kunst nennen; aber nicht minder der Gegensatz davon, die Freude am Groben, Ungeschlachten, Grausigen. Es gibt vier Arten von Menschen in der Welt, sagt Gotamo, Aṉguttaranikāyo IV No. 65: da ist einer, der mehr für Formen Sinn hat, an Formen sich freut; und wieder einer, der mehr für Töne Sinn hat, an Tönen sich freut; da ist einer, der mehr für das Grobe Sinn hat, am Grausigen sich freut; und wieder einer, der mehr für das Rechte (dhammo) Sinn hat, am Rechten sich freut. Diese vier Arten von Menschen, ihr Mönche, finden sich in der Welt vor. – In verjüngtem Maße heißt es bei GOETHE:
Wie sind die Vielen doch beflissen!
Und es verwirrt sie nur der Fleiß.
Sie möchten's gerne anders wissen
Als Einer, der das Rechte weiß.
1069 Die Ansicht vom Überdruß ist ein kennzeichnendes Merkmal der Satzung: so in der Mittleren Sammlung am Ende der 74. Rede, S. 536, der 109. Rede, 834, der [1002] 1064 und 1071 etc.; Nachweise noch ebenda, Anm. 529, Bruchstücke der Reden Anm. 739. Vergl. auch oben Anmerkung 962, ferner Anm. 1052 und 1057. Insbesondere sind es drei Begriffe, die diesen Überdruß anzeigen: nibbindam, an nichts etwas finden, also der eigentliche Überdruß wie oben, der Ekel, was HORAZ languor genannt hat, das fastidium des »Fastidito«, als den sich BRUNO am Titelblatt des Candelajo zu erkennen gibt, der academico di nulla academia, mit dem Motto: In tristitia hilaris, in hilaritate tristis: sabbe dhammā nālam abhinivesāya, das Merkwort der 37. Rede der Mittleren Sammlung, unser Vanitas vanitatum, oder wie PERSIUS beginnt: O curas hominum, o quantum est in rebus inane, des BAKCHYLIDES Χρη κεινο λεγειν ο τι και μελλει τελειν, der Tag lohnt nicht die Mühe, daher MICHELANGELO gerade das Titanenhaupt des Giorno in der MEDICI-Kapelle höchst sinnreich unvollendet gelassen, nicht zufällig versäumt hat; und sabbaloke anabhiratasaññā, die Wahrnehmung von der Freudlosigkeit an der ganzen Welt, unten in der 1072. Anmerkung und oft zu finden. Dieser letzte Begriff kehrt bei LENAU wieder, der in seiner »Einsamkeit« die gleiche Wahrnehmung zur Erkenntnis verklingen läßt:
Die ganze Welt ist zum Verzweifeln traurig.
Aus Überdruß am Wahne der Welt ihr den Rücken kehren, sagte TATIAN: Αποϑνησκε τῳ κοσμῳ, παραιτουμενος την εν αυτῳ μανιαν, Oratio ad Graecos cap. II. Gegensatz zu diesem Überdruß ist die Freude am jīvalokaḥ kṣaṇasundaro vidyutsphuritabhaṃgu raḥ, an der lebendigen Welt mit ihren schönen Augenblicken, die wie Lichtblitze ein Verweilen vortäuschen, die Götterlust, die wie ein Meteor verschwindet, Kathāsaritsāgaras 66, 33; es ist die »schöne, freundliche Gewohnheit des Daseins und Wirkens«, die immer neu und anders genährte Hoffnung, das immer nur Weiterwollen der »sehnsuchtsvollen Hungerleider nach dem Unerreichlichen«, Faust 8203/5, der unersättliche Genußwurm, das bohrende Heimweh, kirrende Erinnerung an den »Anklang froher Zeit«, alles
was die Seele
Mit Lock- und Gaukelwerk umspannt,
Und sie in diese Trauerhöhle
Mit Blend- und Schmeichelkräften bannt.
Dieses Verhältnis hat der früh gefallene Don JORGE MANRIQUE so vorausgesehn (bei GRACIAN, Agudeza, Discurso XLIII):
Quan presto se và el plazer,
Como despues de passado
Da dolor;
Como à nuestro parecer
Qualquiera tiempo passado
Fue mejor.
Wie eilig schwindet hin die Lust,
Alsbald auch schon gewesen
Spende Leid;
Es bleibt der Wahn nur in der Brust,
Als wäre was gewesen
Bessre Zeit.
[1003] Dem nun entsprechend ist all dies zusammengefaßt in einem der Stempel SHAKESPEARES, Ende des ersten Aktes von Henry IV 2:
O thoughts of men accurst!
Past, and to come, seem best; things present, worst.
Unübertrefflich kurz aber sagt Cleopatra, IV 13, 42: Wishers were ever fools. – Es ist mit den Handschriften und Ausgaben keinerlei yathārūpam etc., sondern recht zu lesen samāhitacitto yathābhūtaṃ jānāti passati, yathābhūtam etc. Aus einer Erfahrung und Erkenntnis, die der hier von Sāriputto vorgetragenen Gedankenfolge verwandt ist, hat der heilige BERNHARD eine ähnliche Ableitung gezogen: Mors animae oblivio, de qua morte suscitatur hoc modo: per memoriam sentit, per obedientiam audit, per intelligentiam videt, per circumspectionem olfacit, et gustat per dilectionem: Opera ed. Par. 1621 fol. 492. Solche, aus feinster Kenntnis des menschlichen Herzens entwickelte Gliederung und Gruppierung ist eine Fähigkeit, die den großen Zisterzienser vor den geistlichen Vätern und Führern seiner Zeit merklich auszeichnet und ihn den indischen Vorfahren oft ungemein nahebringt. Einige Beispiele der Art noch in den Anmerkungen 316, 452, 694 und insbesondere sehr zart und bis zur letzten Sauberkeit geführt in der Mittleren Sammlung, Anm. 506.
1070 Die ersten sieben Erfordernisse, die der Reinheit vorangehn, sind im Gleichnisse von der Eilpost in der 24. Rede der Mittleren Sammlung prachtvoll veranschaulicht; das letzte Erfordernis allumfassend im Aṉguttaranikāyo IV No. 194 Ende, wo der heilige Jünger eben durch Ablösung die rechte Erlösung erreicht. Dasselbe Ergebnis hat, auf den Spuren der Odyssee XI 601, TASSO vorgetragen, am Ende des Dialogs über die Idole, wo er vom Mysterium des Herakles spricht: sein Abbild ist in der Unterwelt, sein Geist im Himmel. Hätte sich Herakles der Schauung zugewandt, so wäre er ganz zu den Göttern eingegangen: denn die Schauung läßt ihnen gleichwerden. Aber man sagt, daß sein Bildnis in der Unterwelt sei infolge der Betätigung, die bewirkt, daß der Verstand sich den unteren Dingen zukehrt. Die Vorstellung ist ja gleichsam ein Spiegel: wenn also der schauende Geist sich ganz dem Himmel zuwendet, dann bleibt ihm kein bildlicher Eindruck mehr, der nach unten zusteht; neigt er sich aber den Dingen der Erde zu, dann muß er daran haften. – Zu dieser Ansicht stimmt auch das erstaunliche Wort GOETHES: »Das Höchste, das Vorzüglichste am Menschen ist gestaltlos«, Wahlverwandtschaften II 7. Das ist der ideale Punkt ohne Schlagschatten.
1071 Hierzu die Stelle von der verschiedenartigen Welt, in unserer 21. Rede S. 377; zum ganzen Gedankengang S. 220 der 15. Rede. Schwer zu treffen, schwer zu durchbohren ist die Verschiedenheit, nānattā; das heißt: schwer zu erwerben ist der durchbohrende Blick, der alle Verschiedenheit, alle Vielheit der bunten Welt durchdringt und durchschaut als schillernden Schein des Verstandes, als ein waberndes Blinken von Natur und Mortur, »Geburt und Grab, Ein ewiges Meer, Ein wechselnd Weben, Ein glühend Leben«, wo Sekunde um Sekunde einer geboren wird und einer stirbt, bei immerwährendem Todesröcheln und Lustgestöhn. JOHNSON, der Herausgeber SHAKESPEARES, hat darüber einen, seiner Zeit vielgenannten, Vers gemacht, der zwar nur ein nüchterner Gemeinplatz ist aber nichtsdestoweniger erbärmlich wahr bleibt:
In bed we laugh, in bed we cry,
And born in bed, in bed we die;
[1004] The near approach a bed may show,
Of human bliss and human woe.
Großartig aber kommt uns dieser Gegensatz im Finale des Don Juan zum Bewußtsein, beim üppigen Freudenmahl, zu dem der steinerne Gast aus einer anderen Welt herantritt, und der Taumel der Wünsche in die Offenbarung der Gruft übergeht; und wie nun beides unbeschreiblich durcheinanderströmt, ineinander wirkt, gegeneinander dasteht, dunkel und hell miteinander verteilt, kaṇhasukkasappaṭibhāgam, bald rotglühend bald aschenfahl, tot und lebendig im Wechselverhältnis, pariyāyena: die gewaltigste Doppelherme des Lebens, das enthüllte Geheimnis von Sais.
Doch der unerfahrene, gewöhnliche Mensch wendet sich von der schauderhaften Seite rasch ab, er sieht nicht gern hin, wenn die Welt, wie bei KONRAD VON WÜRZBURG V. 212, ihren Rücken zeigt, »Hie kume ich dir, daz schouwe dû«; durch die lustvolle Betrachtung läßt er sich trügen, trotzdem ihn sogar BOCCACCIO entblödet, in der Amorosa Visione XXX 40-42:
Tu t' abbagli te stesso in falsa erranza
Con falso immaginar per le presenti
Cose, che son di famosa mostranza.
Wer aber witzig geworden ist, der weiß, daß er auch die Kehrseite der »famosa mostranza« früher oder später erleben und beschauen muß und wird beides durchblicken lernen. Daher der in der 131.-134. Rede der Mittleren Sammlung so oft wiederholte Spruch, 977-990:
Und hat man immer Ding um Ding
Gewärtig in der Gegenwart:
Was keiner rauben, rütteln kann,
Durchbohrend finden mag man das.
Es ist eine Anschauung, die auf Yājñavalkyas und noch ältere Seher zurückweist, nach dem Bṛhadāraṇyakam IV 4, 21 und der Kaṭhopaniṣat IV 11:
Neha nānāsti kiṃ cana:
Verschiedensein, das gibt's hier nicht.
Gargas hatte ja einst schon gesungen, Ṛksaṃhitā VI 47, 18:
Indro māyābhiḥ pururūpa īyate:
Indras, in Zaubern vielgestaltig, zieht umher.
Recht geistesverwandt ist die Ansicht von der Auflösung aller Gleichungen und Gleichnisse dieser und jeder Welt, die LICHTENBERG gibt, wenn er so närrisch als tiefsinnig sagt, daß ihm oft schon ein Mann wie eine Einmaleins-Tafel vorgekommen, und die Ewigkeit wie ein Bücherschrank, und daß er den Satz des Widerspruchs als vortrefflich kühlend, ganz eßbar vor sich gesehn hatte: Empfindungen und Gedanken, »dergleichen man kurz vor dem Einschlafen oder im leichten Fieber hat«. – Bei Gotamo ist im letzten Grunde die Verschiedenheit durchbohren gleichbedeutend mit dem Ziel das eine zu treffen, worauf alles ankommt: das Ende des Leidens. Aus einem Gespräch mit ist darüber folgende Stelle erhalten, Saṃyuttakanikāyo ed. Siam. V 430f. (fehlerhaft PTS vol. V p. 453f.). Der ehrwürdige Ānando erzählt dem Erhabenen, [1005] wie er beim Almosengang durch Vesālī viele junge Licchavier vor der Halle ihres Herrenhauses gesehn habe, die sich da im Bogenschießen übten, aus weiter Entfernung den Pfeil nach einem Schlüsselloch richteten und ihn, Schuß um Schuß, durchbrachten, ohne zu fehlen. Bei diesem Anblick habe er sich gedacht: ›Geschickt sind sie, wirklich, diese jungen Licchavier, sehr geschickt, wahrhaftig, diese jungen Licchavier.‹ Gotamo aber fragt nun Ānando: »Wie denkst du darüber, Ānando, was mag da wohl etwa schwieriger auszuführen, etwa schwieriger zu erwirken sein: aus weiter Entfernung den Pfeil nach einem Schlüsselloch zu richten und ihn, Schuß um Schuß, durchzubringen, ohne zu fehlen; oder eines siebenmal gespaltenen Haares Spitze gegen Spitze zu treffen?« – »Das wäre wohl, o Herr, gar schwieriger auszuführen und schwieriger zu erwirken, eines siebenmal gespaltenen Haares Spitze gegen Spitze zu treffen.« – »Und doch hat man, Ānando, schwieriger zu treffendes getroffen, wenn man ›Das ist das Leiden‹ richtig durchdringen kann, ›Das ist die Leidensentwicklung‹ richtig durchdringen kann, ›Das ist die Leidensauflösung‹ richtig durchdringen kann, ›Das ist der Pfad zur Leidensauflösung‹ richtig durchdringen kann.« Hier sei noch beiläufig angemerkt, daß die Auflösung des Leidens als letztes Ziel, über das kein Gedanke hinausreichen, wo keine Verschiedenheit mehr bestehn kann, der Exponent einer sehr besonnenen, höchst scharfsinnigen Schlußfolgerung ist, die HUME gibt, in seiner Enquiry concerning the Principles of Morals, Appendix I No. V (Essays and Treatises, London 1772, vol. II p. 362): »Ask a man, why he uses exercise; he will answer, because he desires to keep his health. If you then enquire, why he desires health, he will readily reply, because sickness is painful. If you push your enquiries farther, and desire a reason, why he hates pain, it is impossible he can ever give any. This is an ultimate end, and is never referred to any other object.«
1072 Diese Dinge sind in einer Meisterrede behandelt, die im Sattakakanipāto des Aṉguttaranikāyo erhalten ist, No. 49, PTS No. 46. Bald nach der Einleitung heißt es da: »Ein Mönch, ihr Mönche, der die Wahrnehmung der Unsauberkeit im Geiste durchprüft, eingehend untersucht, dem wird das Gemüt abwendig vom Gedanken der Paarung zu pflegen, schrumpft zusammen, dreht sich ein, dehnt sich nicht mehr hervor: Gleichmut oder Ekel hält bei ihm an. Gleichwie etwa, ihr Mönche, eine Hahnenfeder oder ein Bindfaden, ins Feuer geworfen, abwendig wird, zusammenschrumpft, sich eindreht, sich nicht mehr hervordehnt: ebenso nun auch, ihr Mönche, wird bei einem Mönche, der die Wahrnehmung der Unsauberkeit im Geiste durchgeprüft, eingehend untersucht hat, das Gemüt abwendig vom Gedanken der Paarung zu pflegen, es schrumpft zusammen, dreht sich ein, dehnt sich nicht mehr hervor: Gleichmut oder Ekel hält bei ihm an.« Bei der Wahrnehmung des Sterbens wendet sich das Gemüt des Mönchs von der Liebe zum Leben ab; bei der Wahrnehmung von der Widerwärtigkeit der Nahrung vergeht ihm der Durst nach Geschmack; bei der Wahrnehmung von der Freudlosigkeit an der ganzen Welt macht er sich keine Gedanken mehr über die Welt; bei der Wahrnehmung der Vergänglichkeit werden ihm Gaben, Ehre und Ruhm gleichgültig; bei der Wahrnehmung des Leidens der Vergänglichkeit überkommt ihn, als ob ein Mörder mit gezücktem Schwerte hinter ihm stände, ein heftiger Schauder vor Gemächlichkeit, Trägheit, Sichgehnlassen, Ausspannen, sich nicht anstrengen, die Dinge nicht gründlich betrachten; und wenn der Mönch die Wahrnehmung der Nichtigkeit des Leidens im Geiste durchprüft und eingehend untersucht, wird ihm der Sinn, bei allen äußeren Eindrücken auf diesen mit Bewußtsein behafteten Körper da, vom Dünkel der Ichheit und Meinheit lauter werden, über die Zwieheit hinwegkommen, zur Ruhe gänzlicher Freiheit eingehn. »Das sind, ihr [1006] Mönche, sieben Wahrnehmungen, die, geübt und gepflegt, hohen Lohn verleihen, hohe Förderung, in Unsterblichkeit eintauchen, in Unsterblichkeit überführen.« – Vergl. noch Mittlere Sammlung S. 367 Kakusandhos Ansprache an seine Jünger. So sagt auch König Dhruvasenas I, am Ende einer seiner Inschriften der Valabhī-Stiftung: anityāny ai varyyāṇy asthira[ṃ] mānuṣya[ṃ], »Vergänglich ist Herrenmacht, unstet Menschentum«, Epigraphia Indica vol. XI p. 107 l. 24; im allgemeinen Echo, noch tausend Jahre nach Gotamo, auf den Spruch vom Ende unserer 17. Rede, S. 318, den berühmtesten in der ganzen asiatischen Welt. Freilich ist das recht wenig, gegenüber dem Reichtum unserer Urkunden. Denn auch die herrlichsten Kuppelmale und Felsendome, Säulenhallen und Pyramiden sind immer noch unbedeutend gegen die unermeßliche Höhe und Schönheit großer Gedanken in ewiger Gestaltung. Die Steine zu fügen und die Worte zu fügen ist nicht dasselbe, sagte ARIOSTO: porvi le pietre e porvi le parole non è il medesimo. Das Feine und Feinere des Menschen war überall, und somit auch in Indien, rasch vergessen und verschollen; an Stelle des einstigen Herakles finden wir schließlich, bestenfalls, einen Apoxyomenos. Das hat JEAN PAUL merkwürdig in unserem Zusammenhang einmal verglichen, Zerstreute Blätter, Leipzig 1826, II 193f. (aus dem Morgenblatt 1822 No. 1): »Wenn, wie bekannt, der Dalai Lama niemals stirbt, sondern schon 700 Jahre lang lebendig vor dem Volke dasteht, weil bey jedes Dalai Lama's Tode, sorgfältig ein neues ihm ähnlichstes Gesicht im ganzen Lande ausgesucht und auf den Thron gehoben wird: so kann jeder von uns, in Europa, sich ungefähr vorstellen, was das letzte Lama-Gesicht nach sieben Jahrhundert physiognomischer Nachdrucke der Nachdrucke ungefähr noch von dem ursprünglichen mag übrig behalten haben. Auf ähnliche Weise kommen Religionen auf dem Durchgange durch die Köpfe der Jahrhunderte, unter lauter Vorausspieglungen der ungetrübtesten Unveränderlichkeit mit Familien-Unähnlichkeiten an, und manche Sonne trifft bloß als ihre eigne Nebensonne ein.« Bei alledem und trotz alledem ist die Wirksamkeit dessen, was man so Buddhismus nennt, auch durch das Mittel seiner zahllosen Nebensonnen eine außerordentliche gewesen. Man kann sie kaum schlichter zeichnen als wie es längst HERDER getan hat, der schon von ihrer größten Verbreitung auf der Erde berichtet: »nicht nur Tibet und Tangut«, sagt er, »der größte Theil der Mongolen, die Mandschu, Kalkas, Eluthen u.f. verehrten den Lama ... auch südlich zieht sich diese Religion weit hin; die Namen Sommona-Kodom, Schaktscha-Tuba, Sangol-Muni, Schigemuni, Buddo [sic], Fo, Schekia sind alle Eins mit Schaka und so geht diese heilige Mönchslehre, wenn gleich nicht überall mit der weitläufigen Mythologie der Tibetaner, durch Indostan, Ceylon, Siam, Pegu, Tonkin, bis nach Sina, Korea und Japan.« Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit, 3. Teil, Riga 1790, S. 33.
1073 Der Grundriß der zehn Tatengänge, nach rechts und nach links im Rundbogen doppelt bestanden, ist in der 176. Rede des Dasakanipāto im Aṉguttaranikāyo entworfen, in einem Gespräch mit Cundo, dem Goldschmied von Pāvā am Gebirge, wobei die Gebräuche und Gelübde der Priester im Tiefland, der Bettelpilger und Tempelbeter, der Feuerverehrer und Wasserbesprenger, betrachtet und auf ihre Wirksamkeit hin untersucht werden. Ob nun einer vom Aufstehn an bis zum Niederlegen immer die Erde berührt oder nicht berührt, feuchte Kuhfladen berührt oder nicht berührt, grüne Gräser berührt oder nicht berührt, dem Feuer dient oder nicht dient, sich vor der Sonne verbeugt oder nicht verbeugt, dreimal täglich ins Wasser herabsteigt oder nicht herabsteigt: nicht darauf kommt es an, sondern welche Seite der zehn Tatengänge man gewählt hat. Die unheilsame Seite ist eben nicht reinlich und beunreinigt. [1007] Hat man nun diesen Rundgang betreten, immer eifrig beschritten, so wird die höllische Welt offenbar, der tierische Schoß offenbar, das Gespensterreich offenbar, oder was irgend noch etwa eine andere üble Fährte sei. Aber die Seite der zehn heilsamen Tatengänge ist reinlich und bereinigt. Hat man da nun diesen Rundbogen betreten, immer eifrig beschritten, so werden die Götter offenbar, die Menschen offenbar, oder was irgend noch etwa eine andere gute Fährte sei. Vergl. auch Anm. 959; über die besonderen, sehr peinlichen Bußregeln Anm. 777, dann 746. Dort verdient noch weitere Beachtung die, an jener Stelle nur vom Anfang her beigebrachte, ganze Selbstbeschreibung Edgars im Lear II 3, wo das Betragen der Bedlam beggars oder Bettler vom Narrentempel, wie sie damals drüben zulande gesehn wurden, bis zu den einzelnen Kennzeichen herab die Gebräuche der indischen Kastiganten sozusagen im Hohlspiegel vor Augen führt: beide streben sie danach sich so nahe wie möglich dem Tier anzugleichen, beschmieren das Antlitz mit Schmutz, gehn entblößt einher, tragen verfilzte Haarsträhne, geben sich splitternackt den Unbilden von Sturm und Sonne preis, sie schlagen sich in die starrgewordenen, erstorbenen, dürren Arme Bolzen, Holzpflöcke, Nägel, Dornen ein, um auf so gräßliche Weise, mit heulender Stimme, unter wahnsinnigen Beschwörungen und auch wieder Gebeten, Almosen zu heischen. Es ist das ein Gesicht, in diesem altbritischen Büßerspiegel, von verblüffender Gegenständigkeit: auch da wird die höllische Welt offenbar, der tierische Schoß offenbar, das Gespensterreich offenbar, oder was irgend noch etwa eine andere üble Fährte sei, der Rundgang auf der unheilsamen Seite, wie er oben gezeigt ist. Trotz der sonst so ungeheueren Verschiedenheit von Ort und Zeit eine geistige Betätigung auf dem gleichen Abweg.
1074 sammāvimuttassa micchāvimutti nijjiṇṇā hoti mit S, wie auch so in der 117. Rede der Mittleren Sammlung. Die Stelle, die der rechten Erkenntnis zukommt, wird im Aṉguttaranikāyo, Dasakanipāto No. 121, so gezeigt: »Wenn die Sonne, ihr Mönche, zum Aufgange kommt, ist das die Vorankunft, das die Vorandeutung, und zwar das Frühmorgenrot. Ebenso nun auch, ihr Mönche, ist bei den heilsamen Dingen das die Vorankunft, das die Vorandeutung, und zwar die rechte Erkenntnis.«
Buchempfehlung
Chamisso, Adelbert von
Peter Schlemihls wundersame Geschichte
In elf Briefen erzählt Peter Schlemihl die wundersame Geschichte wie er einem Mann begegnet, der ihm für viel Geld seinen Schatten abkauft. Erst als es zu spät ist, bemerkt Peter wie wichtig ihm der nutzlos geglaubte Schatten in der Gesellschaft ist. Er verliert sein Ansehen und seine Liebe trotz seines vielen Geldes. Doch Fortuna wendet sich ihm wieder zu.
56 Seiten, 3.80 Euro
Im Buch blättern
Ansehen bei Amazon
Buchempfehlung
Geschichten aus dem Biedermeier II. Sieben Erzählungen
Biedermeier - das klingt in heutigen Ohren nach langweiligem Spießertum, nach geschmacklosen rosa Teetässchen in Wohnzimmern, die aussehen wie Puppenstuben und in denen es irgendwie nach »Omma« riecht. Zu Recht. Aber nicht nur. Biedermeier ist auch die Zeit einer zarten Literatur der Flucht ins Idyll, des Rückzuges ins private Glück und der Tugenden. Die Menschen im Europa nach Napoleon hatten die Nase voll von großen neuen Ideen, das aufstrebende Bürgertum forderte und entwickelte eine eigene Kunst und Kultur für sich, die unabhängig von feudaler Großmannssucht bestehen sollte. Michael Holzinger hat für den zweiten Band sieben weitere Meistererzählungen ausgewählt.
- Annette von Droste-Hülshoff Ledwina
- Franz Grillparzer Das Kloster bei Sendomir
- Friedrich Hebbel Schnock
- Eduard Mörike Der Schatz
- Georg Weerth Leben und Taten des berühmten Ritters Schnapphahnski
- Jeremias Gotthelf Das Erdbeerimareili
- Berthold Auerbach Lucifer
432 Seiten, 19.80 Euro
Ansehen bei Amazon
- ZenoServer 4.030.014
- Nutzungsbedingungen
- Datenschutzerklärung
- Impressum



